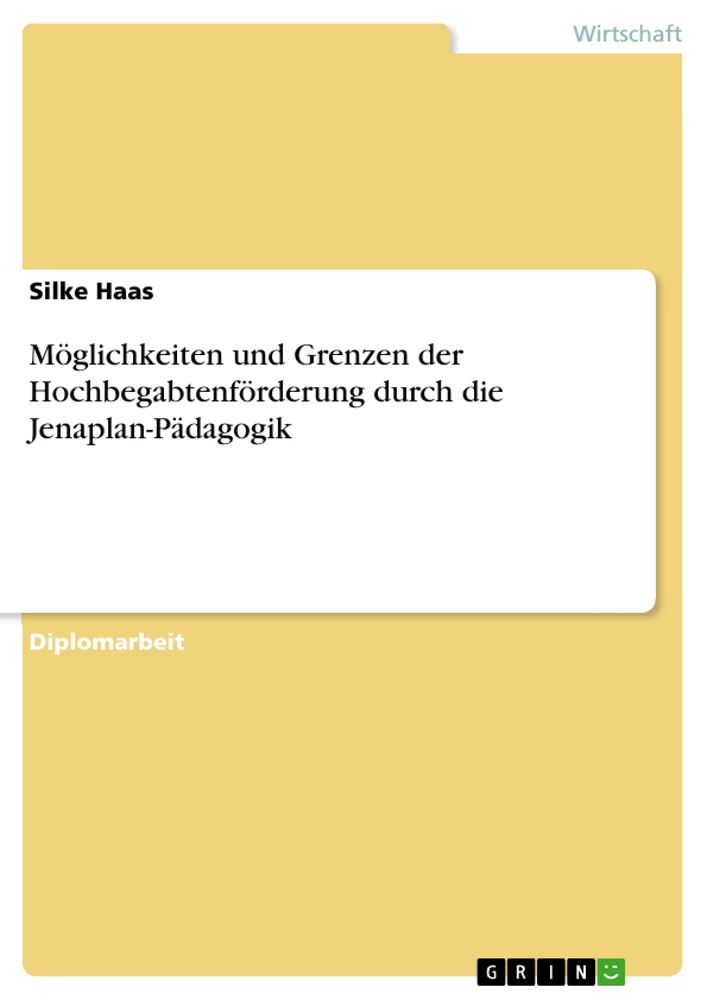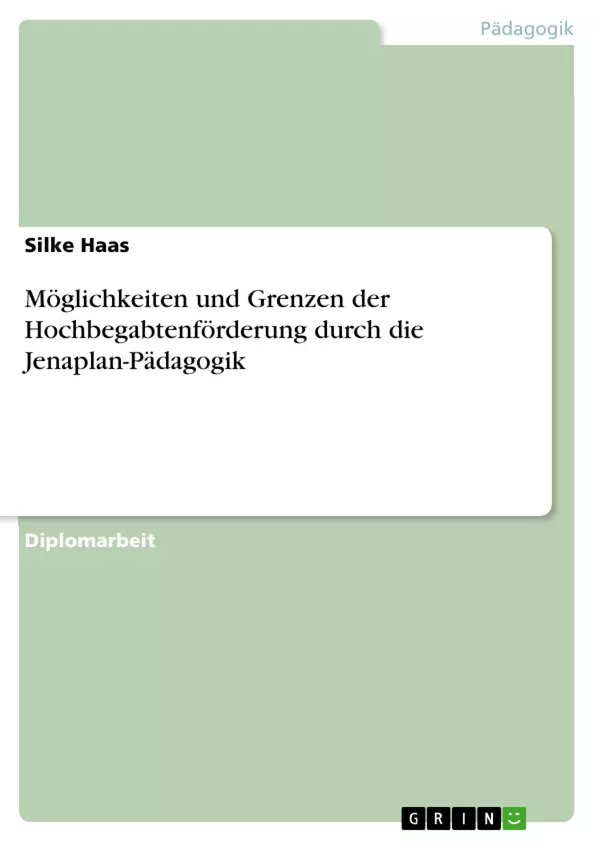Der Bildungsausschuss verfasste im Jahr 1990 im Auftrag der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung folgendes Konzept:
„Aufgabe des Bildungswesens ist es, allen Kindern und Jugendli-chen, eine ihre Fähigkeiten entsprechende Bildung zu vermitteln. …Auftrag an die Schule, jeden jungen Menschen gemäß seinen individuellen Begabungen und Neigungen zu fördern. Daher müssen besondere Begabungen frühzeitig erkannt und gefördert werden….Besondere Fördermaßnahmen sind erforderlich, um auch denjenigen die volle Entfaltung ihrer Begabung zu ermöglichen, die über das schulische Angebot hinausgehende Beratung und Förderung benötigen…“
Seit diesem Zeitpunkt werden Ressourcen in die Förderung von ...
Die Identifizierung und Förderung von Hochbegabten kann durch eine Selbst-, Eltern-, Lehrkraftnominierung sowie durch psychologische Fachkräfte stattfinden. Für die schulische Förderung stehen viele Ansätze zur Verfügung. Neben kostenneutralen Maßnahmen, wie z.B. die vorzeitige Einschulung und das Überspringen von Jahrgangsstufen, gibt es auch kostenintensive Programme, wie z.B. Sonderschulen und Internate. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen die reformpädagogischen Schulen, die zahlreiche Ansätze zur gezielten Förderung von Hochbegabten forcieren. Peter Petersen verfasste schon im Jahre 1916 ein Sammelband mit dem Titel: Der Aufstieg der Begabten. „Es waren Reformpädagogen, wie Petersen und Montessori, die die Individualität des Kindes in den Mittelpunkt des Unterrichts rückten.“
...
Im Zusammenhang mit der Förderung von Begabten wird das im Grundgesetz verankerte Recht auf Chancengleichheit diskutiert.
„Nicht Chancengleichheit, sondern Chancengerechtigkeit ist zu fordern, bei der jedes Kind nach seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten die ihm gemäße Behandlung erhält.“
...
Ziel dieser Arbeit ist es den reformpädagogischen Ansatz von Peter Petersen mit den geforderten Förderansätzen der Wissenschaft und Pädagogen in Bezug auf Hochbegabte zu diskutieren. Ausgehend von dieser Diskussion stellt sich die Frage, ob eine Begabtenförderung durch die Jenaplan-Pädagogik gewährleistet werden kann und wo diese an ihre Grenzen stößt.
Inhaltsverzeichnis
- Begabungsforschung und Begabtenförderung
- Definition Hochbegabung
- Modelle der Hochbegabung
- Drei-Ringe-Modell von Renzulli
- Triadisches Interdependenzmodell der Hochbegabung von Mönks
- Münchener Hochbegabungsmodell v. Heller, Perleth & Hany
- Aktiotop-Modell als komplexe Handlungstheorie
- Diagnostik der Hochbegabung
- Objektive Identifikationsverfahren
- Subjektive Identifikationsverfahren
- Schulleistungen
- Beobachtungsverfahren
- Lehrerurteil
- Peernomination
- Elternurteil
- Selbstrating und -nomination
- Schulische Förderung von Hochbegabung
- Notwendigkeit der schulischen Begabtenförderung
- Begabtenpädagogik
- Öffnung der Schule und Unterricht
- Begabungsförderndes Lernen
- Altersgemischte Jahrgangsklassen
- Formen der schulischen Begabtenförderung
- Integration versus Selektion
- Akzeleration
- Enrichment
- Unterrichtsinternes Enrichment
- Schulinternes Enrichment
- Außerschulische Enrichment-Möglichkeiten
- Rolle des Lehrers in der Begabtenförderung
- Petersen - Jena-Plan
- Erziehungswissenschaftliche und pädagogische Grundlagen
- Prinzip der Stammgruppe
- Führungslehre – Pädagogik des Unterrichts
- Lernraum
- Eltern und Schule
- Leistungsbeurteilung
- Begabte
- Begabtenförderung und Jenaplan-Pädagogik
- Bedeutung der Beobachtung in der Diagnostik
- Jahrgangsmischung und Hochbegabung
- Bedeutung des offenen Unterrichts und das begabungsfördernde Lernen für Hochbegabte
- Förderung verschiedenster Begabungsformen
- Prinzip der ganzheitlichen Förderung
- Grenzen der Begabtenförderung in der Jenaplan-Pädagogik
- Definition und Modelle der Hochbegabung
- Diagnostik und Förderung von Hochbegabung im Schulsystem
- Grundprinzipien und pädagogische Konzepte der Jenaplan-Pädagogik
- Möglichkeiten und Grenzen der Jenaplan-Pädagogik für die Förderung von Hochbegabten
- Bedeutung der Beobachtung, Jahrgangsmischung und des offenen Unterrichts für die Begabtenförderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Begabtenförderung durch die Jenaplan-Pädagogik. Dabei werden die theoretischen Grundlagen der Begabungsforschung und Begabtenförderung sowie die zentralen Elemente der Jenaplan-Pädagogik beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Potenziale und Herausforderungen, die sich aus der Anwendung der Jenaplan-Pädagogik für die Förderung von Hochbegabten ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer umfassenden Einführung in die Begabungsforschung und Begabtenförderung, wobei verschiedene Modelle der Hochbegabung vorgestellt und die Diagnostik von Hochbegabung beleuchtet wird. Anschließend werden die gängigen Formen der schulischen Begabtenförderung, wie Integration, Akzeleration und Enrichment, sowie die Rolle des Lehrers in diesem Kontext analysiert.
Im zweiten Kapitel wird die Jenaplan-Pädagogik in ihren erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Grundlagen vorgestellt. Dabei werden die Prinzipien der Stammgruppe, die Führungslehre, der Lernraum sowie die Rolle der Eltern und die Leistungsbeurteilung in der Jenaplan-Pädagogik erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, inwieweit die Jenaplan-Pädagogik zur Begabtenförderung geeignet ist. Die Bedeutung der Beobachtung in der Diagnostik, die Jahrgangsmischung und die Bedeutung des offenen Unterrichts für die Förderung von Hochbegabten werden diskutiert. Abschließend werden die Grenzen der Jenaplan-Pädagogik für die Begabtenförderung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Hochbegabung, Begabtenförderung, Jenaplan-Pädagogik, Diagnostik, Beobachtung, Jahrgangsmischung, offener Unterricht, Enrichment, Stammgruppe, Führungslehre, Lernraum, ganzheitliche Förderung, Grenzen der Förderung.
- Quote paper
- Silke Haas (Author), 2010, Möglichkeiten und Grenzen der Hochbegabtenförderung durch die Jenaplan-Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165033