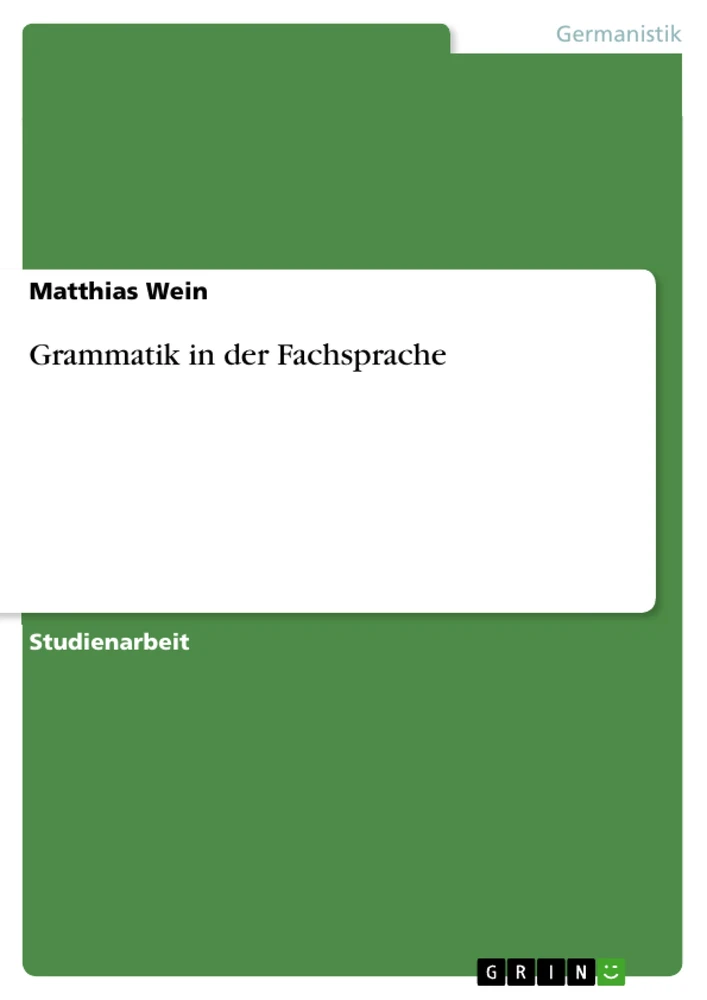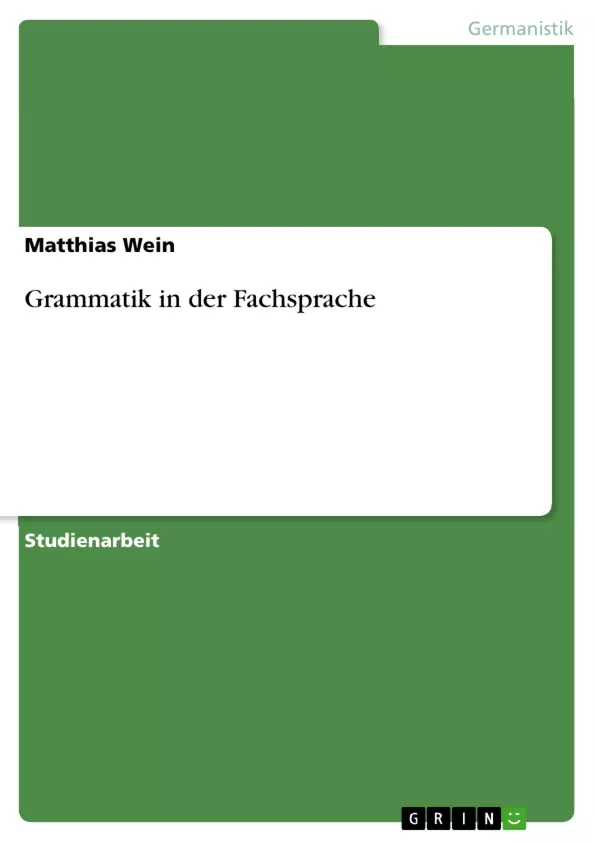„Verordnung zur Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung über die Festlegung eines Planungsgebietes zur Sicherung der Planung für den Neubau der Bundesautobahn 59 (BAB Duisburg-Wesel) in der Gemeinde Voerde, Kreis Wesel, vom 30. Januar 1981.“ So oder so ähnlich sehen heute besonders komplexe Sätze aus, die unter den Begriff „Fachsprache“ fallen. Wenn man von Fachsprache spricht, sollte man jedoch besser den Plural, also „Fachsprachen“, benutzen. Die Anzahl an Fachsprachen ist so groß, ihr „Aufgabenbereich“ so breit, dass man in allen Situationen des Lebens, hauptsächlich jedoch im Beruf auf Texte trifft, die sprachlich so speziell für ein Fachgebiet sind, dass sie nur mit großer Mühe verstanden werden können. Eine Definition von Fachsprache findet sich dementsprechend im Duden wieder. Dieser versteht unter dem Begriff „Fachsprache“ eine Sprache, die einen speziellen Wortschatz und spezielle Verwendungsweisen beinhaltet, für ein bestimmtes Fachgebiet gilt und eine genaue Verständigung und exakte Bezeichnungen innerhalb dieses Fachgebietes ermöglicht.
Meist sind solche Sätze wie obiges Beispiel noch länger, noch verschachtelter. Sie sind für Laien und fachfremde Menschen nur schwer zu verstehen und erfordern eine Einarbeitung in das jeweilige Fach. Der Grund hierfür ist schon – und auch hauptsächlich – im Bereich des Wortschatzes zu finden, der für jedes Sachgebiet individuell vorhanden ist. Fachsprache ist eigentlich „nur“ eine Variante der allgemeinen Sprache, die in Bereichen der Wissenschaft, Technik etc. Anwendung findet und, als entscheidendes Faktum, durch klar definierte Fachbegriffe gekennzeichnet ist. So kann ein Mediziner durchaus Begriffe wie „EKG“ oder ähnliche verstehen und zuordnen, er scheitert jedoch wahrscheinlich an fachsprachlichen Wörtern aus der Physik. Allgemeiner ausgedrückt heißt das: Vertreter von verschiedenen, voneinander unabhängigen Fachgebieten müssen ihren Wortschatz um eine Vielzahl neuer Begriffe erweitern, da sie sonst nicht oder wenigstens nicht mehr mit voller Sicherheit verständlich sind. Gerade Menschen, die mit Fachsprache – meist kommt es zu Begegnungen mit dieser im Beruf – zu tun haben, müssen folglich ihren Wortschatz erweitern um zu verstehen, was sie lesen oder hören. Allerdings erschwert nicht nur der Wortschatz das Verständnis von fachsprachlichen Texten. Auch die Grammatik, spezieller die Syntax und die Morphologie, leistet einen größeren Beitrag zur Eigenart einer Berufssprache.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegendes zu den grammatischen Mitteln und deren Einteilung
- Morphologie
- Wortbildungsmorphologie
- Flexionsmorphologie
- Syntax
- Satzarten
- Relativ- und Attributsätze
- Nominalisierungen
- Satzkomplexität
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Analyse der morphologischen und syntaktischen Mittel, die in Fachsprachen zum Einsatz kommen. Ihr Ziel ist es, die Verwendungswirkung dieser Mittel zu beschreiben und zu untersuchen, inwieweit sie dem Streben nach begrifflicher Präzision und objektiver wissenschaftlicher Denkweise entsprechen.
- Untersuchung der Syntax und Morphologie in Fachsprachen
- Analyse der Verwendungswirkung von syntaktischen Mitteln
- Beurteilung der Mittel hinsichtlich Deutlichkeit, Verständlichkeit, Ökonomie und Anonymität
- Vergleich der Fachsprache mit der Allgemeinsprache
- Anwendung der Erkenntnisse auf fachsprachliche Texte aus Jura und Technik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und definiert den Begriff der Fachsprache. Sie beschreibt die Herausforderungen, die sich aus der Verwendung fachsprachlicher Texte ergeben, insbesondere für fachfremde Leser. Die Einleitung führt in die Themen der Morphologie und Syntax in Fachsprachen ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar.
- Grundlegendes zu den grammatischen Mitteln und deren Einteilung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Unterscheidung zwischen quantitativer und qualitativer Anwendung von Grammatik in Fachsprache und Allgemeinsprache. Es erklärt den Begriff „Frequenzspezifika“ und die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Morphologie und Syntax für die wissenschaftliche Arbeit mit fachsprachlichen Texten. Es wird die Einteilung von Roelcke vorgestellt, die als Grundlage für die Analyse der Mittel dient.
Schlüsselwörter
Fachsprache, Syntax, Morphologie, Wortbildungsmorphologie, Flexionsmorphologie, Satzarten, Relativ- und Attributsätze, Nominalisierungen, Satzkomplexität, Deutlichkeit, Verständlichkeit, Ökonomie, Anonymität, Frequenzspezifika, Juristische Sprache, Technische Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert eine Fachsprache laut Duden?
Eine Fachsprache ist gekennzeichnet durch einen speziellen Wortschatz und spezielle Verwendungsweisen, die eine exakte Verständigung innerhalb eines Fachgebiets ermöglichen.
Welche Rolle spielt die Grammatik in der Fachsprache?
Neben dem Wortschatz prägen vor allem Syntax (Satzbau) und Morphologie (Wortbildung) die Eigenart einer Fachsprache, oft durch hohe Komplexität und Nominalisierungen.
Warum sind Fachtexte für Laien oft schwer verständlich?
Dies liegt an der hohen Satzkomplexität, dem Einsatz von Fachbegriffen und grammatischen Strukturen, die auf Präzision und Ökonomie statt auf allgemeine Verständlichkeit ausgelegt sind.
Was versteht man unter Morphologie in Fachsprachen?
Die Morphologie befasst sich mit der Wortbildung und Flexion. In Fachsprachen werden oft komplexe Komposita genutzt, um Sachverhalte präzise zu benennen.
Welche Ziele verfolgt die fachsprachliche Syntax?
Die Syntax in Fachsprachen strebt nach begrifflicher Präzision, Objektivität, Anonymität und sprachlicher Ökonomie, was oft zu verschachtelten Satzstrukturen führt.
- Arbeit zitieren
- Matthias Wein (Autor:in), 2010, Grammatik in der Fachsprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165057