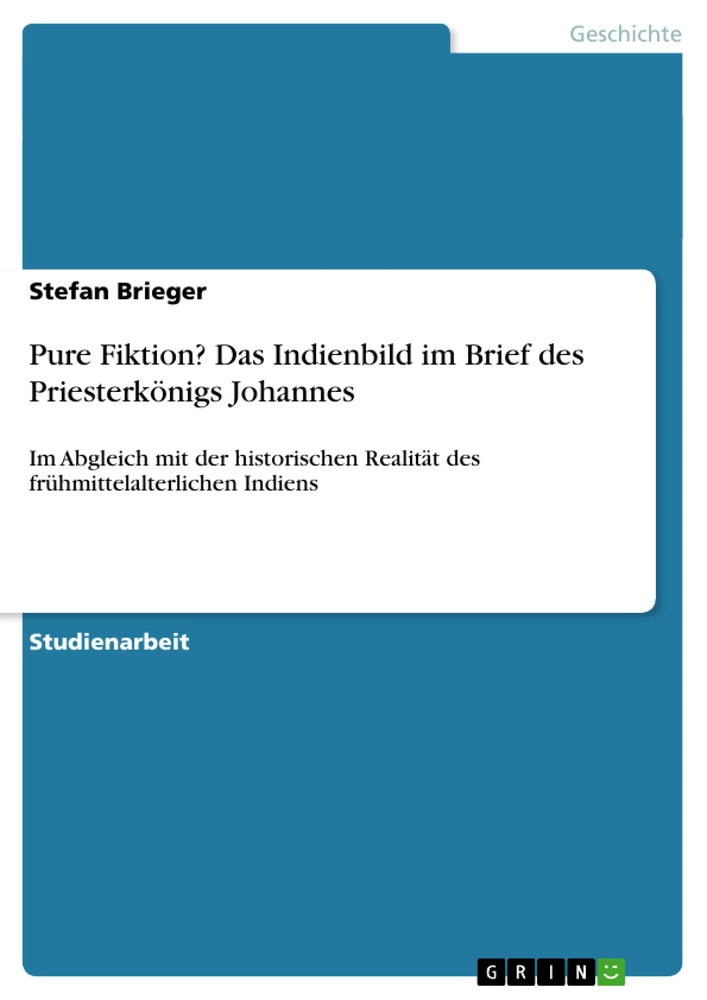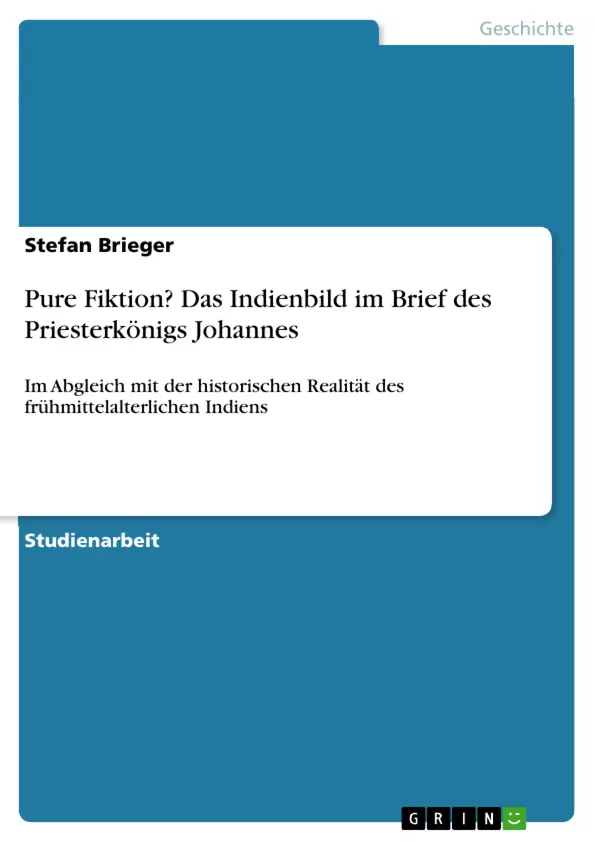Fiktion oder Realität - diese Frage stellte sich bei Priesterkönig Johannes lange nicht. Während heute die Forschung einig ist, dass die Figur ins Reich der Legenden gehört, diente sie im Mittelalter - und teils darüber hinaus - als Quell der Inspiration und Hoffnung, als Antrieb für Exkursionen, ja teils als Argument militärischer Überlegungen. Zu verlockend war die Vorstellung, im Rücken des islamischen Feindes, am sagenumwobenen Ende der Welt, einen Verbündeten der christlichen Welt gefunden zu haben.
So fiktiv die Figur des Priesterkönigs, so erfunden war sein vermeintlicher Brief an den byzantinischen Kaiser. Eine verschriftliche Machtdemonstration, gleichzeitig Dokument einer gesellschaftlichen Utopie - Historiker sehen darin ein Medium, die politischen und religiösen Ansichten des unbekannten Autors zu verbreiten. Gleichwohl ist es Zeugnis über Kenntnisse und Mythen, welche in Europa damals über ein weit entferntes und nahezu unerreichbares Gebiet vorhanden waren - Indien, die angebliche Heimat des Priesterkönigs.
Ziel dieser Arbeit ist, anhand dreier Themenfelder das Indienbild des Johannes-Briefs mit der mittelalterlichen Realität auf dem Gebiet Indiens abzugleichen. Die Schwerpunkte liegen auf politischer Struktur, der Religion sowie der Architektur. Es geht dabei bewusst nicht um den Versuch, die Authentizität der Priesterkönig-Figur an sich zu bestimmen. Dies ist bereits mehrfach geschehen. Vielmehr soll untersucht werden, inwieweit sich die Fiktion des damaligen Indiens deckt mit historischen Tatsachen. Es wird zunächst kurz geklärt, ob das fiktive Indien des Johannes mit dem realen Indien der damaligen Zeit geographisch übereinstimmt. Zusätzlich wird der Untersuchungszeitraum definiert. Dabei wird vor allem auf die Arbeiten Friedrich Zarnckes und Ulrich Knefelkamps zurückgegriffen. Auf dem kleinen Gebiet der Priesterkönig-Forschung sind beide Autoren wegweisend.
In der vorliegenden Arbeit werden anschließend in drei Kapiteln ausgewählte Textpassagen des Briefes historischen Fakten und Forschungsergebnissen gegenübergestellt. Über den Abgleich politischer Vorstellungen wird die religiöse Kultur im mittelalterlichen Indien analysiert, um letztlich auf dem Gebiet der Architektur zu einer Synthese geistlicher und weltlicher Strukturen zu finden. Abschließend werden die Vergleiche zusammengefasst und in ein Fazit gebunden.
Inhaltsverzeichni
Einleitung Seite
Geographische Definition und zeitliche Eingrenzung
Vergleichsebene I: Politische Strukturen
Vergleichsebene II: Religion
Vergleichsebene III: Architektur
Fazit Seite
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Fiktion oder Realitat - diese Frage stellte sich bei Priesterkonig Johannes lange nicht. Wahrend heute die Forschung einig ist, dass die Figur ins Reich der Legenden gehort, diente sie im Mittelalter - und teils daruber hinaus - als Quell der Inspiration und Hoffnung, als Antrieb fur Exkursionen, ja teils als Argument militarischer Uberlegungen. Zu verlockend war die Vorstellung, im Rucken des islamischen Feindes, am sagenumwobenen Ende der Welt, einen Verbundeten der christlichen Welt gefunden zu haben.
So fiktiv die Figur des Priesterkonigs, so erfunden war sein vermeintlicher Brief an den byzantinischen Kaiser. Eine verschriftliche Machtdemonstration, gleichzeitig Dokument einer gesellschaftlichen Utopie - Historiker sehen darin ein Medium, die politischen und religiosen Ansichten des unbekannten Autors zu verbreiten. Gleichwohl ist es Zeugnis uber Kenntnisse und Mythen, welche in Europa damals uber ein weit entferntes und nahezu unerreichbares Gebiet vorhanden waren - Indien, die angebliche Heimat des Priesterkonigs.
Ziel dieser Arbeit ist, anhand dreier Themenfelder das Indienbild des Johannes-Briefs mit der mittelalterlichen Realitat auf dem Gebiet Indiens abzugleichen. Die Schwerpunkte liegen auf politischer Struktur, der Religion sowie der Architektur. Es geht dabei bewusst nicht um den Versuch, die Authentizitat der Priesterkonig-Figur an sich zu bestimmen. Dies ist bereits mehrfach geschehen. Vielmehr soll untersucht werden, inwieweit sich die Fiktion des damaligen Indiens deckt mit historischen Tatsachen. Es wird zunachst kurz geklart, ob das fiktive Indien des Johannes mit dem realen Indien der damaligen Zeit geographisch ubereinstimmt. Zusatzlich wird der Untersuchungszeitraum definiert. Dabei wird vor allem auf die Arbeiten Friedrich Zarnckes und Ulrich Knefelkamps zuruckgegriffen. Auf dem kleinen Gebiet der Priesterkonig-Forschung sind beide Autoren wegweisend.
In der vorliegenden Arbeit werden anschliefiend in drei Kapiteln ausgewahlte Textpassagen des Briefes historischen Fakten und Forschungsergebnissen gegenubergestellt. Uber den Abgleich politischer Vorstellungen wird die religiose Kultur im mittelalterlichen Indien analysiert, um letztlich auf dem Gebiet der Architektur zu einer Synthese geistlicher und weltlicher Strukturen zu finden. Abschliefiend werden die Vergleiche zusammengefasst und in ein Fazit gebunden. Als Quelle fur alle folgenden Zitate des Johannes-Briefes - kursiv gedruckt - dient die deutsche Ubersetzung durch Ulrich Knefelkamp.1
2. Geographische Definition und zeitliche Eingrenzung
"In den drei Indien herrscht Unsere Magnifizenz und Unser Land erstreckt sich vom jenseitigen Indien, in dem der Korper des heiligen Apostels Thomas ruht, durch die Wuste und weiter bis zum Aufgang der Sonne und kehrt zuruck durch den Untergang zum verlassenen Babylon neben dem Turm zu Babel."
Das fiktionale Herrschaftsgebiet des Priesterkonigs mit heutigen Landern zu vergleichen, ist nicht einfach. Gleichwohl lassen die Angaben im Brief gewisse Eingrenzungen zu. "Das Herrschaftsgebiet des Presbyters Johannes reicht vom jenseitigen Indien bis zum verlassenen Babylon, also wohl vom heutigen Bangla-Desh bis in den Irak", erklart Ulrich Knefelkamp.2 Damit wird durch die Legende jenes Gebiet, welches die reale, historische Indien-Forschung beschreibt, (grofizugig) eingeschlossen.
Auch Friedrich Zarncke geht davon aus, dass Johannes' Indien auf das tatsachliche Indien zuruckzufuhren ist. "Mit den sagenhaften Erzahlungen von dem Priester Johannes [...], haben sich fruhe [sic] schon Berichte eines Patriarchen Johannes von Indien gemischt. Diese letzteren gehen zuruck auf ein wirkliches Ereignis, das im Jahre 1122 in Rom unter dem Papst Calixtus statt fand. Die Berichte zeugen von den marchenhaften Vorstellungen, die man sich von Indien zu bilden geneigt war, und wir konnen diese sagenhaft ausgeschmuckte Erzahlung des Patriarchen Johannes wohl einen Vorlaufer der Sage vom Priester Johannes nennen."3
Knefelkamp betont ebenfalls den Einfluss ohnehin vorhandener Indien-Bilder auf den Verfasser und damit den Inhalt des Johannes-Briefes. Der Autor, den Knefelkamp als Kleriker identifiziert, habe die Legende eines machtigen christlichen, gegen den Islam kampfenden Herrschers "mit den Informationen und allem wunderbaren Wissen uber Indien in einer Schrift verknupft, die er als anonymen Brief zuerst an den byzantinischen Kaiser adressierte, spater auch an Kaiser und Papst."4
Gleichzeitig liefert der Text des Briefes weitere geographische Angaben, die auf das tatsachliche Indien sowie Zentralasien hinweisen. So wird der Fluss "Ydonus" erwahnt, den Knefelkamp mit dem Indus gleichsetzt. Die Stadte Samarkand (heute in Usbekistan) und Susa (auf dem Gebiet des heutigen Iran), die ebenfalls zum Einflussbereich Johannes' gehoren sollen, sind beziehungsweise waren existent.
Zeitlich lasst sich der Brief auf das 12. Jahrhundert fixieren, wahrscheinlich auf die fruhe zweite Halfte desselben. Zarncke belegt, dass erste Legenden uber den Priesterkonig bereits in der ersten Halfte dieses Jahrhundert nachzuweisen sind, spater dann eine groBe Anzahl verschiedener Handschriften entstehen. Fur eine exaktere Datierung des Ur-Textes fehle es jedoch an "durchschlagenden Kriterien".5 Knefelkamp erganzt, dass 1177 ein Antwortschreiben Papst Alexanders III. entstehe.6
Eine weitere indirekte zeitliche Einordnung liefert eine Schlacht aus dem Jahre 1141. Zarncke widmet sich auf mehreren Seiten diesem Geschehen, welches Knefelkamp als vernichtende Niederlage des Seldschukensultans Sandschar gegen das Turkvolk Kara-Khitai zusammenfasst.7 In der katholischen Welt wurde diese Niederlage einer islamischen Armee bald in die Legendenbildung um Priesterkonig Johannes eingebunden.
Insgesamt lasst sich sagen, dass sich die Geographie des Reiches Johannes', obgleich fiktiver Natur, auf den GroBraum Indien/Zentralasien im 12. Jahrhundert festlegen lasst. Da davon auszugehen ist, dass das damalige Indien-Bild nicht nur von kontemporaren Einflussen, sondern auch durch Uberlieferungen fruherer Jahrhunderte gepragt war, wird sich die vorliegende Arbeit auch einem zeitlich etwas weiter zuruckreichenden Rahmen widmen.
Nicht eingefasst sind darin die diversen Transformationen des Johannes-Mythos in den Jahrhunderten nach Erscheinen des Briefes. Vom 14. Jahrhundert an etwa wird das Reich des Priesterkonigs in Athiopien verortet, eine Vorstellung, die vor allem bei portugiesischen Seefahrern Antrieb einiger Reisen war.8 Eins bleibt bei allen Verschiebungen gleich: Stets wird Johannes im Rucken des unchristlichen Feindes vermutet, oder wohl eher, erhofft. Auch dieses Muster legt den Bezug des Autors auf Indien nahe - enden doch heute noch an den westlichen Grenzen des Landes die zentralasiatischen islamischen Kulturkreise. Dass dem damals in der Realitat nicht ganz so war, zeigt das nachste Kapitel.
3. Vergleichsebene I: Politische Strukturen
"Wenn Du aber die Grofie und Erhabenheit Unserer Hoheit wissen willst und in welchen Landern Unsere Majestat gebietet, dann erkenne und glaube ohne Zweifel, dafi ich, der Priester Johannes, Herr bin uber die Herrschenden [...]. Zweiundsiebzig Provinzen dienen mir, [...] und eine jede von ihnen hat einen Konig uber sich, sie alle sind Uns tribut pflichtig."
Es ist nicht viel, was der Johannes-Brief uber die politischen Strukturen im Reich des Priesterkonigs preisgibt. Uber allem, so macht der Text Glauben, steht der machtige Johannes selbst, dem eine Vielzahl Provinzen untertanig sind. Geht man dabei von Knefelkamps Theorie aus, dass der Autor ein moralisches Ansinnen verfolgte, lasst dies den Schluss zu, Johannes' Reich sei eine Projektion der Herrschaftsstrukturen des Heiligen Romischen sowie des byzantinischen Reiches der damaligen Zeit.
Auch hier findet sich der im Brief beschriebene Vielvolker-Charakter, vor allem beim romisch- deutschen Kaiser auch die Bundelung kleinstaatlicher Provinzen unter einem Herrscher. Knefelkamp sagt dazu: "Also kam ich zu dem Schluss, dafi der Brief von einem staufischen Kleriker als eine Art Furstenspiegel verfafit wurde, um den byzantinischen Kaiser, aber auch Papst und Kaiser mit dem Bild des idealen Herrschers zu konfrontieren."9
Es scheint also durchaus moglich, dass der Autor die Verhaltnisse seiner Zeit in Europa als Vorbild nahm, den Handlungsort nach Indien verlegte und mit - aus seiner Sicht moralisch besseren - neuen Verhaltnissen ausstattete. Im realen Indien sahen damals die politischen Strukturen derweil anders aus.
Ein ubergeordnetes System der weltlichen Machtordnung, wie es etwa das Kaisertum in Zentraleuropa darstellte, gab es auf dem Subkontinent nicht. Vielmehr existierte eine Vielzahl eigenstandiger Territorien. "Die Regionalisierung des sudasiatischen Raumes [...] gipfelte [...] in den grofien Regionalreichen und Regionalkulturen des fruhen Mittelalters", sagt Hermann Kulke. Vom 7. bis 13. Jahrhundert hatten weder nordindische Herrscher noch andere Grofiregionen einen uberregionalen oder gar gesamt-indischen Staat errichten konnen.10 Kulke unterteilt Indien in diesem Zeitraum politisch-historisch in vier Zonen: Nord-, Ost-, Zentral- und Sudindien.11
Zur Zeit des Johannes-Briefes setzte sich demzufolge der Norden aus zahlreichen unabhangigen Rajputen-Furstentumem12 zusammen, die das Erbe des Gurjara-Pratihara-Reiches antraten, welches seit dem 7. Jahrhundert eine beachtliche Entwicklung genommen hatte, sich dann aber zunehmend in kriegerischen Auseinandersetzungen aufloste. "[Dieses Reich] wird [...] im Westen durch die Araber, im Osten durch die Palas und im Suden durch die Rastrakutas begrenzt", erlautert Ainslie T. Embree.13 Die einzelnen Rajputen-Fursten schafften es anschlieBend nicht, die Machtfulle der Gurjara-Pratihara-Herrscher zu konservieren, was 1206 schlieBlich zur Eroberung Nordindiens und zur Errichtung des muslimischen Delhi-Sultanats fuhrte.14
Im Osten, den heutigen Regionen Ostbihar und Bengalen, herrschte bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts das buddhistische Pala-Reich. Wie in Nordindien ging auch sein Zusammenbruch einher mit Kampfen gegen andere indische Regionalreiche, der Desintegration kleinerer Furstentumer auf eigenem Gebiet sowie letztlich dem Einfall der afghanischen Ghuriden, welcher auch in Bengalen zur Etablierung muslimischer Herrschaftsstrukturen fuhrte. "Das Ende der Pala- Dynastie vollzog sich in einer fur die fruhmittelalterlichen Reiche Indiens charakteristischen Weise", sagtKulke.15
Zentralindien, die westliche Hochebene des Dekkan, stand im 11. Jahrhundert unter der Dynastie der Chalukyas von Kalyani. Diese war - auch hier zeigt sich das Muster - einem machtigen GroBreich gefolgt (der Rastrakuta-Dynastie), welches durch anhaltende Kriege aber bis zum Zerfall geschwacht worden war. Die Verkleinerung des Furstentums setzte sich in weiteren Auseinandersetzungen fort, und schlieBlich kam es zu einer ganzlichen Aufsplitterung. "Dem Untergang der Chalyukas von Kalyani im spaten 12. Jahrhundert folgte dann aber nicht wie bisher der Aufstieg einer neuen regionalen GroBmacht, sondern die Grundung mehrerer Konigreiche innerhalb dieser GroBregion", erklart Kulke.16
In Sudindien vollzog sich laut Kulke "in besonders anschaulicher Weise die Abfolge regionaler Staatenbildungen." Uber die Jahrhunderte losten sich die Konigreiche faktisch ab, "unterwarfen die gesamte Region und ubten [...] hegemoniale Vormacht aus".17 Zur Zeit des Johannes-Briefes regierte die Chola-Dynastie, welche eine expansive Kriegsfuhrung - auch zu See - sowie ausgedehnte Handelsbeziehungen, etwa nach China, kennzeichneten. Auch hier gilt: Irgendwann war es zu aufWendig, das groBe Reich zu erhalten, wahrend gleichzeitig im Inneren kleinere Furstentumer aufbegehrten. "Die Chola-Dynastie bestand zwar noch bis in die zweite Halfte des 13. Jahrhunderts, doch hatte sich dass Reich langst zu einer Arena sich heftig bekampfender Nachfolgestaaten verwandelt."18
Mehrere Forscher weisen innerhalb dieser vier Reiche auf markante Unterschiede in der Entwicklungsgeschichte zwischen Nord- und Sudindien hin. So erklart etwa Savanne Veluthat: "There is a considerable difference between these phenomena19 in the context of the south und the pattern obtaining in the north, a major difference being the earlier graduation of the north to a state society."20 Auch Saiyid Nurul Hasan erkennt Diversitaten innerhalb des Subkontinentes hinsichtlich der sozialen Entwicklung und betont etwa den Einfluss, den auslandische Nachbarn offensichtlich auf Indiens Norden hatten.21 Kulke und Rothermund nennen den generellen Aufstieg sudindischer Regionalkulturen in diesem Zeitraum ab Mitte des ersten Jahrtausends historisch bedeutsam.22
Zusatzlich zu den lokalen GroBreichen in den vier Regionen existierten im mittelalterlichen Indien parallel diverse Stammeskulturen, "die am Rande oder auBerhalb der agrarischen Kerngebiete in schwer zuganglichen Dschungel- und Berggebieten bis in die Neuzeit ein weitgehend autonomes Stammesleben fuhrten", wie Kulke erklart. Auch in den Zwischengebieten zwischen den vier Machtzentren hatten sich einzelne, kleinere Reiche etablieren konnen. Als Beispiel nennt er das Grenzgebiet der heutigen Bundesstaaten Rajasthan und Madhya Pradesh. "Wie auch andere Zwischenregionen des Subkontinentes entwickelte dieses Gebiet eine hohe stadtische Kultur unter beachtlicher Abfolge prosperierender Konigreiche."23
In Anbetracht all dieser Erkenntnisse uber die Vielgestaltigkeit des politischen Indiens im 12. Jahrhundert lasst sich ein bedeutender Unterschied zwischen historischen Fakten und Johannesbrief-Fiktion feststellen. Zwar gab es, wie im Brief erwahnt, auf indischem Gebiet mehrere Provinzen (ob in der Summe der vier GroBreiche, kleinerer Furstentumer und Stammesgebiete 72 erreicht wird, sei dahingestellt24 )
[...]
1 Knefelkamp, Ulrich: Die Suche nach dem Reich des Priesterkonigs Johannes. Gelsenkirchen 1986.
2 Knefelkamp, Ulrich: Der Priesterkonig Johannes und sein Reich - Legende oder Realitat, in: Journal ofMedieval History 14/1988, Seite 337-355
3 Zarncke, Friedrich: Der Priester Johannes, in: Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Konigl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften 7/1879
4 Knefelkamp, Ulrich: Der Priesterkonig Johannes und sein Reich - Legende oder Realitat, in: Journal ofMedieval History 14/1988, Seite 337-355
5 Zarncke, Friedrich: Der Priester Johannes, in: Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Konigl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften 7/1879
6 Knefelkamp, Ulrich: Der Priesterkonig Johannes und sein Reich - Legende oder Realitat, in: Journal ofMedieval History 14/1988, Seite 337-355
7 ebd.
8 ebd.
9 Knefelkamp, Ulrich: Der Priesterkonig Johannes und sein Reich - Legende oder Realitat, in: Journal ofMedieval History 14/1988, Seite 337-355
10 Kulke, Hermann: Indische Geschichte bis 1750, in der Reihe: Oldenbourg Grundriss der Geschichte. Munchen 2005
11 ebd.
12 vgl. Kulke, Hermann und Rothermund, Dietmar: Geschichte Indiens. Munchen 1998. S. 122: "Das folgenreiche Erbe der kurzen Herrschaft der Hunnen in Nordindien [im 6. Jhd.] waren die Stamme, die in ihrem Gefolge in Nordindien EinlaB fanden und die dortige Geschichte grundlegend veranderten. Sie vermischten sich [...] mit den bisher wenig hinduisierten lokalen Stammen [...] und bestimmten als Gurjara und spater als Rajputen die Geschichte Nordindiens im Mittelalter."
13 Embree, Ainslie T.: Das nordliche Indien bis zum Einbruch des Islam. Aus: Weltgeschichte Band 17. Indien. Geschichte des Subkontinents von der Induskultur bis zum Beginn der englischen Herrschaft. Augsburg 2000
14 Kulke, Hermann: Indische Geschichte bis 1750, in der Reihe: Oldenbourg Grundriss der Geschichte. Munchen 2005
15 ebd.
16 ebd.
17 ebd.
18 Kulke, Hermann: Indische Geschichte bis 1750, in der Reihe: Oldenbourg Grundriss der Geschichte. Munchen 2005
19 Kesavan meint mit "phenomena" etwa Transformationen in der Landwirtschaft, Stadteentwicklung, Religionsgeschichte; siehe dazu: Veluthat, Kesavan: The Early Medieval in South India. New Delhi 2009
20 Veluthat, Kesavan: The Early Medieval in South India. New Delhi 2009
21 Saiyid Narul Hasan: Religion, State, And Society In Medieval India. Herausgegeben von Satish Chandra. New Delhi 2005
22 Kulke, Hermann undRothermund, Dietmar: Geschichte Indiens. Munchen 1998. S. 179
23 Kulke, Hermann: Indische Geschichte bis 1750, in der Reihe: Oldenbourg Grundriss der Geschichte. Munchen 2005
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Priesterkönig Johannes?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Ziel der Arbeit ist, anhand dreier Themenfelder das Indienbild des Johannes-Briefs mit der mittelalterlichen Realität auf dem Gebiet Indiens abzugleichen. Die Schwerpunkte liegen auf politischer Struktur, der Religion sowie der Architektur.
Welche Themenfelder werden im Bezug auf Indien untersucht?
Die Schwerpunkte der Analyse liegen auf politischer Struktur, der Religion und der Architektur im mittelalterlichen Indien, im Vergleich zu dem Bild, das im Johannesbrief dargestellt wird.
Welchen Zeitraum deckt die Untersuchung ab?
Der Brief lässt sich zeitlich auf das 12. Jahrhundert fixieren, wahrscheinlich auf die frühe zweite Hälfte desselben. Da davon auszugehen ist, dass das damalige Indien-Bild nicht nur von kontemporären Einflüssen, sondern auch durch Überlieferungen früherer Jahrhunderte geprägt war, wird sich die vorliegende Arbeit auch einem zeitlich etwas weiter zurückreichenden Rahmen widmen.
Welche geographische Region wird betrachtet?
Das fiktionale Herrschaftsgebiet des Priesterkönigs lässt sich mit dem Großraum Indien/Zentralasien im 12. Jahrhundert festlegen. Ulrich Knefelkamp erklärt das Herrschaftsgebiet des Presbyters Johannes vom heutigen Bangla-Desh bis in den Irak reicht.
Was sagt der Text über politische Strukturen im mittelalterlichen Indien?
Ein übergeordnetes System der weltlichen Machtordnung, wie es etwa das Kaisertum in Zentraleuropa darstellte, gab es auf dem Subkontinent nicht. Vielmehr existierte eine Vielzahl eigenständiger Territorien. Indien war politisch-historisch in vier Zonen unterteilt: Nord-, Ost-, Zentral- und Südindien.
Welche Reiche existierten im mittelalterlichen Indien?
Im Norden existierten zahlreiche unabhängige Rajputen-Fürstentümer. Im Osten herrschte das buddhistische Pala-Reich. Zentralindien stand unter der Dynastie der Chalukyas von Kalyani. In Südindien regierte die Chola-Dynastie.
Wer sind einige der genannten Forscher, die zu diesem Thema gearbeitet haben?
Friedrich Zarncke, Ulrich Knefelkamp, Hermann Kulke, Ainslie T. Embree, Savanne Veluthat, und Saiyid Nurul Hasan werden im Text als Forscher erwähnt, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben.
Worauf lag das Augenmerk der Portugiesischen Seefahrer in Bezug auf Priesterkönig Johannes?
Vom 14. Jahrhundert an wird das Reich des Priesterkönigs in Äthiopien verortet, eine Vorstellung, die vor allem bei portugiesischen Seefahrern Antrieb einiger Reisen war.
- Arbeit zitieren
- Stefan Brieger (Autor:in), 2010, Pure Fiktion? Das Indienbild im Brief des Priesterkönigs Johannes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165130