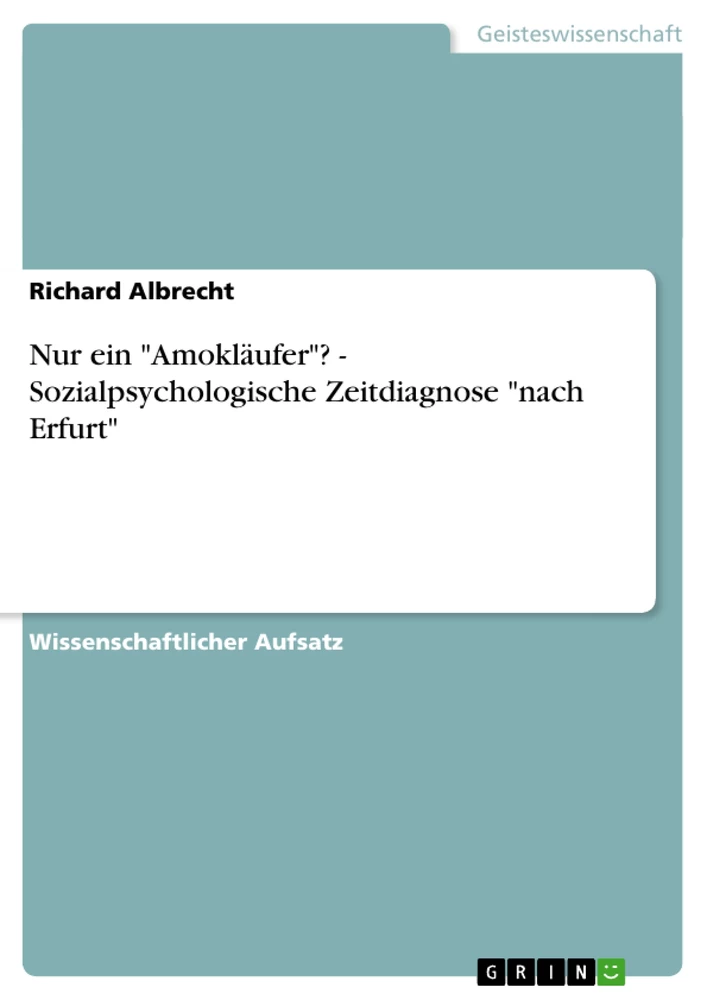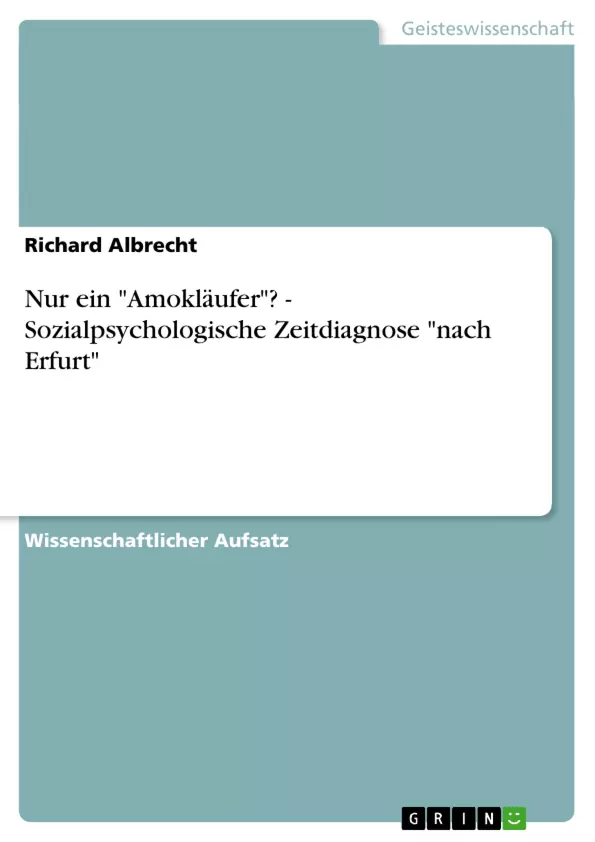Zum Text
Der hier nun auch als GRIN-Broschüre 2008 veröffentlichte Text von Richard Albrecht nahm den damaligen sogenannten Amoklauf Ende April 2002 an einem Erfurter Gymnasium zum Anlaß, um – ähnlich wie vorher schon (und unter ausdrücklichen Bezug darauf) Dr. Klaus Nikolaus Wenzel: Amoklauf ins Dritte Jahrtausend. Die Globalisierung anders gesehen (1999): http://www.multi-mediale-kompetenz.ag.vu/amoklauf.html [080208] – eine knappe Zeitdiagnose im Sinne Karl Mannheims („diagnosis of our time“) unter kulturanalytisch-sozialpsychologischer Perspektive zu skizzieren.
Richard Albrechts Text wurde 2002 in der Fachzeitschrift „Recht und Politik“, 38 (2002) 3, pp. 143-152, primarpubliziert und rasch unter anderem in den Zeitschriften „liberal“ (Heft 3, 2002) und „sinn-haft“ (Heft 13,2002) nachgedruckt. Die Schriftststellerin Dr. Karin Jäckel, die den Text damals auf ihrer Autorennetzseite placierte, lobte den Essay seinerzeit öffentlich „wegen des darin ausgebreiteten Wissens und der spürbaren emotionalen Komponente“.
Zum Autor
Richard Albrecht, PhD., ist Sozialwissenschaftler und Bürgerrechtler, Autor und - seit Sommer 2007 - Editor des unabhängigen Halbwochenmagazins moz.art1 (http://de.geocities.com/earchiv21/moz.art1.htm). Der Autor veröffentlichte zuletzt die Bücher StaatsRache - Justiz-kritische Beiträge gegen die Dummheit im deutschen Recht(ssystem). München: GRIN Verlag für akademische Texte, 2005; 2007² (http://www.wissen24.de/vorschau/36391.html). - „Demoskopie als Demagogie“ (Aachen: Shaker, 2007). - Genozidpolitik im 20. Jahrhundert (Aachen: Shaker, 2006/07, drei Bände). - Crime/s Against Mankind, Humanity, and Civilisation (München: GRIN 2007); Bürgerrechte – Staatspflichten – Rechtsprechung – Bürokratie (München: GRIN, 2008 [= Justizkritik 1]). - „Beleidigung“ – Materialien zur Kritik eines justiziellen Phantomdelikts (München: GRIN, 2008 [= Justizkritik 2]).
Korrespondenzadresse
dr.richard.albrecht@gmx.net
Inhaltsverzeichnis
- I. Amok: Begriff und Kontext
- II. Gesellschaftliche Umstände und Anomie
- III. Das Erfurter Ereignis: Kein Amoklauf
- IV. Monokausale Deutungen und Schuldzuweisungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Erfurter Schulmassaker vom 26. April 2002 und hinterfragt die gängige Etikettierung als „Amoklauf“. Ziel ist es, die gesellschaftlichen Bedingungen und Ursachen zu beleuchten, die zu solchen Taten beitragen können, anstatt sich auf individualpsychologische Erklärungen zu beschränken.
- Der Begriff „Amoklauf“ und seine kulturellen Konnotationen
- Der Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Anomie und Gewalt
- Alternative Beschreibungen des Erfurter Ereignisses
- Analyse monokausaler Deutungen und Schuldzuweisungen
- Die Rolle von Medien und Videospielen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Amok: Begriff und Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Amok“ aus verschiedenen Perspektiven. Es beginnt mit einer literarischen Beschreibung des Phänomens, gefolgt von einer etymologischen und soziologischen Analyse. Der Autor verweist auf den Zusammenhang zwischen dem Amoklauf und dem Zustand der gesellschaftlichen Harmonie. Die Frage nach der Motivation von Amokläufern und die oft vorgeschlagenen Lösungen wie Waffengesetze werden diskutiert.
II. Gesellschaftliche Umstände und Anomie: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen Umstände, die zum Erfurter Massaker beitrugen. Es betont die Bedeutung von Enttraditionalisierung, Bindungslosigkeit und Sinnverlust im Kontext der beschleunigten Modernisierung. Der Autor argumentiert, dass die sozialen Bedingungen und die gesellschaftliche Ausgeglichenheit maßgeblich destabilisiert wurden und dass dies ein relevanter Hintergrund für solche Ereignisse darstellt. Der Begriff der Anomie nach Emile Durkheim wird in diesem Kontext eingeordnet.
III. Das Erfurter Ereignis: Kein Amoklauf: Das Kapitel widerlegt die Bezeichnung des Erfurter Ereignisses als „Amoklauf“. Der Autor argumentiert, dass entscheidende konstitutive Elemente eines Amoklaufs fehlten: die Ungeplantheit und die Zufälligkeit der Opfer. Alternativ werden die Begriffe „plötzlicher Massenmord“ und „Schulmord“ vorgeschlagen, um das Ereignis angemessener zu beschreiben. Der Text vergleicht das Erfurter Ereignis mit anderen Schulmassakern und zeigt Parallelen und Unterschiede auf, ohne jedoch auf Einzelheiten der Tat einzugehen.
IV. Monokausale Deutungen und Schuldzuweisungen: Der letzte Abschnitt des Auszugs behandelt die einfachen und oft vereinfachenden Erklärungen nach dem Erfurter Massaker. Der Autor kritisiert monokausale Deutungen, die etwa die Medien oder Computerspiele als alleinige Ursache identifizieren. Die komplexe Problematik des Phänomens und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise werden hervorgehoben. Beispiele für solche vereinfachenden Erklärungen werden angeführt.
Schlüsselwörter
Amoklauf, Anomie, gesellschaftliche Destabilisierung, Schulmassaker, Erfurter Blutbad, Modernisierung, Individualisierung, Gewalt, Medien, Videospiele, monokausale Deutungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Analyse des Erfurter Schulmassakers"
Was ist der Hauptgegenstand des Textes?
Der Text analysiert das Erfurter Schulmassaker vom 26. April 2002 und hinterfragt die gängige Bezeichnung als „Amoklauf“. Er untersucht die gesellschaftlichen Bedingungen und Ursachen, die zu solchen Taten beitragen können, anstatt sich auf individualpsychologische Erklärungen zu beschränken.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Den Begriff „Amoklauf“ und seine kulturellen Konnotationen, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Anomie und Gewalt, alternative Beschreibungen des Erfurter Ereignisses, die Analyse monokausaler Deutungen und Schuldzuweisungen, sowie die Rolle von Medien und Videospielen. Der Text beleuchtet auch die gesellschaftlichen Umstände, die zum Massaker beitrugen, wie Enttraditionalisierung, Bindungslosigkeit und Sinnverlust im Kontext der beschleunigten Modernisierung.
Wie wird das Erfurter Ereignis im Text beschrieben?
Der Text widerlegt die Bezeichnung des Erfurter Ereignisses als „Amoklauf“, da entscheidende konstitutive Elemente eines Amoklaufs (Ungeplantheit und Zufälligkeit der Opfer) fehlten. Alternative Bezeichnungen wie „plötzlicher Massenmord“ oder „Schulmord“ werden vorgeschlagen. Der Text vergleicht das Erfurter Ereignis mit anderen Schulmassakern, ohne jedoch auf Einzelheiten der Tat einzugehen.
Welche Kritik übt der Text?
Der Text kritisiert monokausale Deutungen, die beispielsweise Medien oder Computerspiele als alleinige Ursache des Massakers identifizieren. Er betont die komplexe Problematik des Phänomens und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in diesen?
Der Text umfasst vier Kapitel:
- I. Amok: Begriff und Kontext: Untersucht den Begriff „Amok“ aus verschiedenen Perspektiven (literarisch, etymologisch, soziologisch) und diskutiert die Motivation von Amokläufern und Lösungsansätze.
- II. Gesellschaftliche Umstände und Anomie: Untersucht gesellschaftliche Umstände wie Enttraditionalisierung und Anomie als Hintergrund des Massakers.
- III. Das Erfurter Ereignis: Kein Amoklauf: Widerlegt die Bezeichnung „Amoklauf“ und schlägt alternative Beschreibungen vor.
- IV. Monokausale Deutungen und Schuldzuweisungen: Kritisiert vereinfachende Erklärungen und betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Amoklauf, Anomie, gesellschaftliche Destabilisierung, Schulmassaker, Erfurter Blutbad, Modernisierung, Individualisierung, Gewalt, Medien, Videospiele, monokausale Deutungen.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit dem Erfurter Schulmassaker.
- Quote paper
- Dr. Richard Albrecht (Author), 2002, Nur ein "Amokläufer"? - Sozialpsychologische Zeitdiagnose "nach Erfurt", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16515