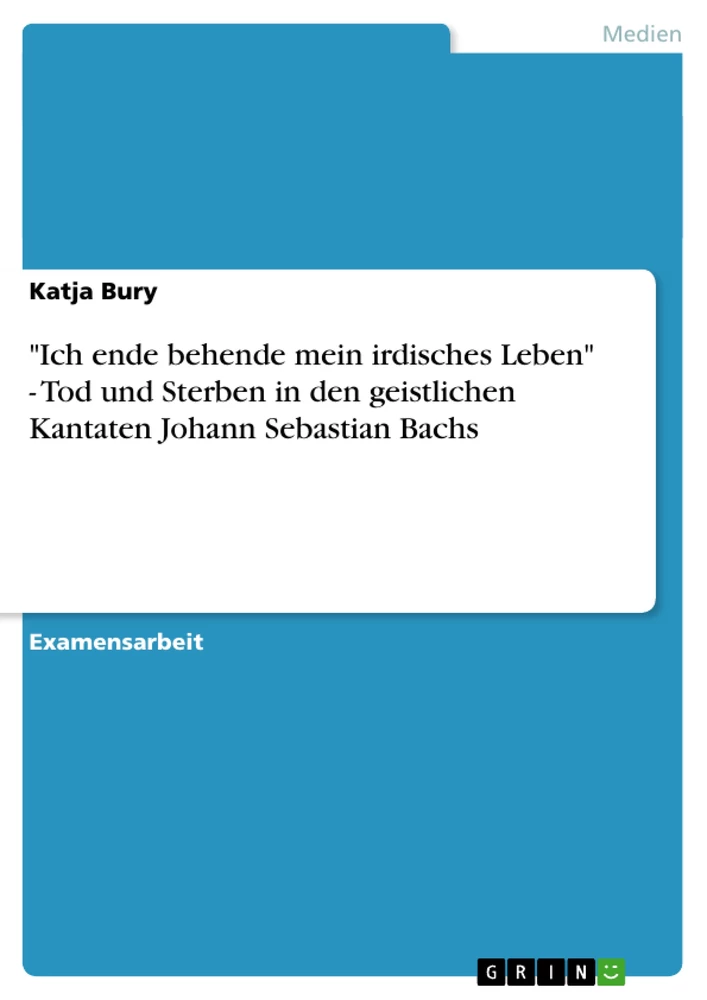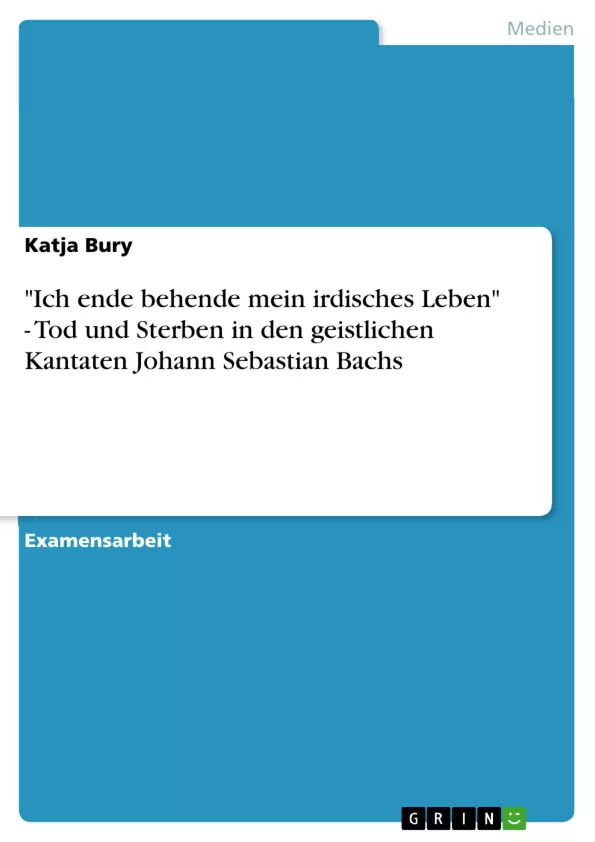Diese Arbeit entwickelt den speziellen Deutungsansatz, es handele sich bei den besprochenen Kantaten und eine ‚musizierte Ars moriendi‘. So wird eine bestimmte inhaltliche und funktionale
Thematik innerhalb des großen Korpus von Bach-Kantaten zusammengefasst und einem übergeordneten Verständnis zugeführt.
Am Beginn steht eine inhaltliche Klärung der Todeskonzeptionen, die für Bach relevant waren. Diese werden aus den Kantatentexten selbst entwickelt und mit theologischen und geistesgeschichtlichen
Ansätzen unterfüttert. Die Texte werden, den Bildgehalt und Sprachgestus einbeziehend, auf ihre Rezeptionsfähigkeit im Rahmen des Glaubenshorizonts des zeitgenössischen Hörers, nicht im Sinne einer abstrakten, zeitenthobenen theologischen Interpretation,
sondern historisch konkret, analysiert. Damit ist eine Basis für eine eingehende Betrachtung der vielfältigen musikalischen Reaktionen auf die inhaltliche Thematik geschaffen.
Im analytischen Teil wird ein ‚Vokabular des Todes‘ entfaltet. Dies geschieht anhand des Apparats der musikalisch-rhetorischen Figuren, wobei eine klare Abgrenzung zwischen normativen, etablierten und als spekulativ einzustufenden Zeichen und individueller Tonsatz-
Betrachtungen geschaffen wird. Die Perspektive weitet sich über die Analyse von Einzelsätzen hinweg aus, indem zwischen der Funktion von solistischen und chorischen Sätzen unterschieden wird und, in dem als Fallstudie beleuchteten Actus tragicus, die bis dahin etablierte
Stufenfolge der musikalischen Textdarstellungsebenen in eine komplexe Untersuchung eines Werkganzen mündet.
So kann die eingangs aufgestellte These, die betreffenden Kantaten als (musikalischen) Teil der Idee und Praxis einer Einübung in die ‚Ars moriendi‘ zu verstehen, als schlüssig betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einblick
- 2. Die Konzeption des Todes im Kantatentext
- 2.1. „Komm du süße Todesstunde“
- 2.2. „Ach! Wer doch schon im Himmel wär! Wie dränget mich die böse Welt!“
- 2.3. „Der Tod ist mein Schlaf worden“
- 2.4. „Jesu, meines Todes Tod“
- 2.5. „Das offne Grab sieht greulich aus“
- 2.6. „Herr, wie du willt, so schicks mit mir im Leben und im Sterben“
- 2.7. „Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind, bedenke dies, o Menschenkind!“
- 3. Die Chiffrierung des Todesbegriffes in Sprache und Musik
- 4. Musikalische Parameter zur Darstellung von Tod und Sterben
- 4.1. … auf melodischer Ebene
- 4.2. … auf kontrapunktischer Ebene
- 4.3. … auf harmonischer Ebene
- 4.4. … auf metrisch-rhythmischer Ebene
- 4.5. … auf der Ebene musikalisch-rhetorischer Figuren
- 4.6. … auf der Ebene der Instrumentation
- 4.7. …auf der Ebene der kontrastierenden Verwendung einzelner Parameter
- 4.8. … auf der Ebene eines bildlichen Ideenkomplexes
- 5. Exkurs: Die Darstellung des Todes in den Kollektivsätzen
- 6. Der „Actus tragicus“ (BWV 106) als eine musikalische Darstellung des Todes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Tod und Sterben in den geistlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs. Ziel ist es, die verschiedenen Konzeptionen des Todes im Kantatentext zu erörtern, die textlichen und theologischen Grundlagen zu analysieren und die musikalischen Mittel zu beschreiben, die Bach zur Darstellung dieser Thematik einsetzt.
- Textliche und theologische Grundlagen der Todeskonzeptionen in Bachs Kantaten
- Musikalische Parameter (melodisch, harmonisch, rhythmisch) zur Darstellung von Tod und Sterben
- Verwendung musikalisch-rhetorischer Figuren
- Rolle der Instrumentation
- Der "Actus tragicus" (BWV 106) als Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einblick: Die Einleitung präsentiert die vielfältigen Darstellungen des Todes in Bachs Kantaten, von der freudigen Erwartung des Todes bis hin zur barocken Mahnung des Memento mori. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit: Erörterung der textlichen und theologischen Grundlagen, Analyse der konkreten Realisierung des Todesbegriffes im Text, Untersuchung musikalischer Parameter und abschließende Betrachtung des "Actus tragicus" (BWV 106).
2. Die Konzeption des Todes im Kantatentext: Dieses Kapitel analysiert die heterogene Darstellung des Todes in den Kantatentexten. Es untersucht die barocke Lebensvorstellung mit ihrer Polarität von Tod und Leben, die Tradition des Memento mori und die christliche Erlösungsvorstellung, die den Tod als Übergang zum ewigen Leben interpretiert. Es werden verschiedene Konzeptionen des Todes vorgestellt, die sich nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen: der freudig ersehnte Tod, der Tod als Flucht vor der Welt, der Tod als Schlaf und der Tod als Anfechtung des Glaubens.
2.1. „Komm du süße Todesstunde“: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Kantaten, die eine freudig ersehnte Sterbensvorstellung zeigen. Die Analyse fokussiert auf die Transformation von biblischen Vorbildern (wie den Jüngern Jesu oder Stephanus) in die persönliche Situation des dichterischen Ichs und die Sehnsucht nach der Vereinigung mit Christus im Himmelreich. Der Bezug zu biblischen Texten und deren Auslegung in der lutherischen Orthodoxie wird hervorgehoben.
2.2. „Ach! Wer doch schon im Himmel wär! Wie dränget mich die böse Welt!“: Dieses Kapitel behandelt Kantaten, in denen der Tod als Flucht oder Errettung vor der "bösen Welt" und ihrer Eitelkeit dargestellt wird. Es wird der Gegensatz zwischen Himmel und Welt diskutiert, und wie der Tod als Rettung aus dem "Todesleben" in der Welt verstanden werden kann.
2.3. „Der Tod ist mein Schlaf worden“: Hier wird die Darstellung des Todes als Schlaf analysiert. Es wird gezeigt, wie dieser Topos im Alten Testament wurzelt und im christlichen Kontext die Hoffnung auf Auferstehung symbolisiert. Beispiele aus verschiedenen Kantaten illustrieren die verschiedenen Facetten dieser Metapher.
2.4. „Jesu, meines Todes Tod“: Dieser Abschnitt untersucht die theologische Grundlage der Umwertung des Todes ins Leben durch die Auferstehung Christi. Die Rolle Christi als Erlöser und Mittler, der den Tod besiegt und die Sünden vergibt, wird diskutiert. Die verschiedenen Bilder der Erlösung (Lösegeld, Schuldschein, Blut Christi) werden analysiert.
2.5. „Das offne Grab sieht greulich aus“: Dieses Kapitel untersucht Kantaten, die den Tod als Anfechtung des Glaubens oder als gefürchteten Tod darstellen. Es analysiert den Dialog zwischen Furcht und Hoffnung, den Zweifel am ewigen Leben und die Angst vor einem unvorbereiteten Tod. Die Tradition der Ars moriendi wird in den Kontext gesetzt.
2.6. „Herr, wie du willt, so schicks mit mir im Leben und im Sterben“: Dieser Abschnitt behandelt Kantaten, die den willig erduldeten Tod thematisieren. Der Fokus liegt auf der persönlichen Fügung in den Willen Gottes und dem Vertrauen auf seine Hilfe. Es wird der Bezug zu Evangelientexten über die Heilung von Kranken hergestellt.
2.7. „Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind, bedenke dies, o Menschenkind!“: Dieses Kapitel untersucht Kantaten, die die Aufforderung zur Umkehr im Angesicht des Todes enthalten. Die Angst vor einem unvorbereiteten Tod und die Bedeutung der Buße werden diskutiert. Der Bezug zum Memento mori und die Dringlichkeit der Vorbereitung auf das Seelenheil werden hervorgehoben.
3. Die Chiffrierung des Todesbegriffes in Sprache und Musik: Dieses Kapitel untersucht die Mechanismen der Textproduktion in Bachs Kantaten, insbesondere die Verwendung von Verweischarakteren und barocker Textproduktion. Es analysiert die Rolle der Musik als "praedicatio sonora" und die Aktualisierung der Bibellesung für den Einzelnen. Es werden verschiedene Vorgehensweisen bei der Darstellung des Todes erläutert, wie z.B. der Perspektivenwechsel und die Verwendung von Metaphern und Allegorien.
4. Musikalische Parameter zur Darstellung von Tod und Sterben: Dieses Kapitel analysiert verschiedene musikalische Mittel, die Bach zur Darstellung des Todes verwendet. Es werden melodische (tiefe Lage, alterierende Intervalle), kontrapunktische (Relationes non harmonicae), harmonische (verminderte und übermäßige Akkorde), metrisch-rhythmische (zeitliche Dehnung, Synkopen) und instrumentale Aspekte untersucht. Die Verwendung musikalisch-rhetorischer Figuren wie Katabasis und Passus duriusculus wird ebenfalls diskutiert.
5. Exkurs: Die Darstellung des Todes in den Kollektivsätzen: Dieser Exkurs betrachtet die Darstellung des Todes in Chorsätzen und Chorälen. Es wird festgestellt, dass die Reflexion über den Tod in diesen Sätzen im Vergleich zu solistischen Sätzen weniger prominent ist und sich oft auf eine allgemeine Perspektive beschränkt.
6. Der „Actus tragicus“ (BWV 106) als eine musikalische Darstellung des Todes: Dieses Kapitel analysiert den "Actus tragicus" als Fallbeispiel für die Darstellung des Todes. Es untersucht die textliche Grundlage, die Kombination von Bibelzitaten und die musikalische Gestaltung, die die verschiedenen Aspekte des Todes (Unumgänglichkeit, Vorbereitung, Erlösung) auf großformatiger Ebene darstellt.
Schlüsselwörter
Tod, Sterben, Johann Sebastian Bach, Geistliche Kantaten, Ars moriendi, Memento mori, Christliche Erlösungslehre, Musikalische Rhetorik, Bildlichkeit, Theologie, Barock.
Häufig gestellte Fragen zu: Darstellung von Tod und Sterben in den geistlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Tod und Sterben in den geistlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs. Sie analysiert verschiedene Konzeptionen des Todes im Kantatentext, die textlichen und theologischen Grundlagen und die musikalischen Mittel, die Bach zur Darstellung dieser Thematik einsetzt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt textliche und theologische Grundlagen der Todeskonzeptionen, musikalische Parameter (melodisch, harmonisch, rhythmisch) zur Darstellung von Tod und Sterben, die Verwendung musikalisch-rhetorischer Figuren, die Rolle der Instrumentation und den "Actus tragicus" (BWV 106) als Fallstudie.
Welche verschiedenen Konzeptionen des Todes werden in den Kantatentexten dargestellt?
Die Arbeit identifiziert verschiedene, sich teilweise überschneidende Konzeptionen: den freudig ersehnten Tod, den Tod als Flucht vor der Welt, den Tod als Schlaf, den Tod als Anfechtung des Glaubens und den willig erduldeten Tod. Auch die barocke Lebensvorstellung mit ihrer Polarität von Tod und Leben und die Tradition des Memento Mori werden berücksichtigt.
Wie werden die verschiedenen Konzeptionen des Todes musikalisch umgesetzt?
Die Analyse untersucht melodische (tiefe Lage, alterierende Intervalle), kontrapunktische (Relationes non harmonicae), harmonische (verminderte und übermäßige Akkorde), metrisch-rhythmische (zeitliche Dehnung, Synkopen) und instrumentale Aspekte. Die Verwendung musikalisch-rhetorischer Figuren wie Katabasis und Passus duriusculus wird ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielt der "Actus tragicus" (BWV 106)?
Der "Actus tragicus" dient als Fallbeispiel für die Darstellung des Todes. Die Arbeit analysiert seine textliche Grundlage, die Kombination von Bibelzitaten und die musikalische Gestaltung, welche die verschiedenen Aspekte des Todes (Unumgänglichkeit, Vorbereitung, Erlösung) auf großformatiger Ebene darstellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Einblick; 2. Die Konzeption des Todes im Kantatentext (mit Unterkapiteln zu einzelnen Kantatenbeispielen); 3. Die Chiffrierung des Todesbegriffes in Sprache und Musik; 4. Musikalische Parameter zur Darstellung von Tod und Sterben; 5. Exkurs: Die Darstellung des Todes in den Kollektivsätzen; 6. Der „Actus tragicus“ (BWV 106) als eine musikalische Darstellung des Todes.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Tod, Sterben, Johann Sebastian Bach, Geistliche Kantaten, Ars moriendi, Memento mori, Christliche Erlösungslehre, Musikalische Rhetorik, Bildlichkeit, Theologie, Barock.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Der methodische Ansatz beinhaltet die Erörterung der textlichen und theologischen Grundlagen, die Analyse der konkreten Realisierung des Todesbegriffes im Text, die Untersuchung musikalischer Parameter und eine abschließende Betrachtung des "Actus tragicus" (BWV 106).
Welche biblischen und theologischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Transformation biblischer Vorbilder in die persönliche Situation des dichterischen Ichs, die Sehnsucht nach der Vereinigung mit Christus, den Gegensatz zwischen Himmel und Welt, die Hoffnung auf Auferstehung, die Rolle Christi als Erlöser, die Angst vor einem unvorbereiteten Tod und die Bedeutung der Buße.
- Quote paper
- Katja Bury (Author), 2009, "Ich ende behende mein irdisches Leben" - Tod und Sterben in den geistlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165162