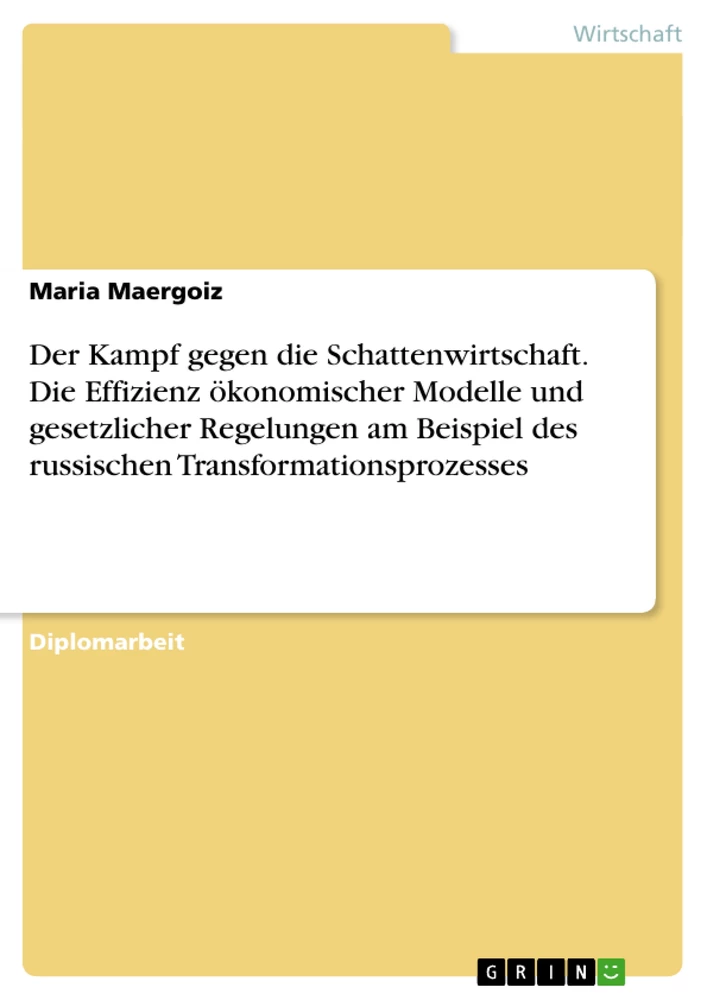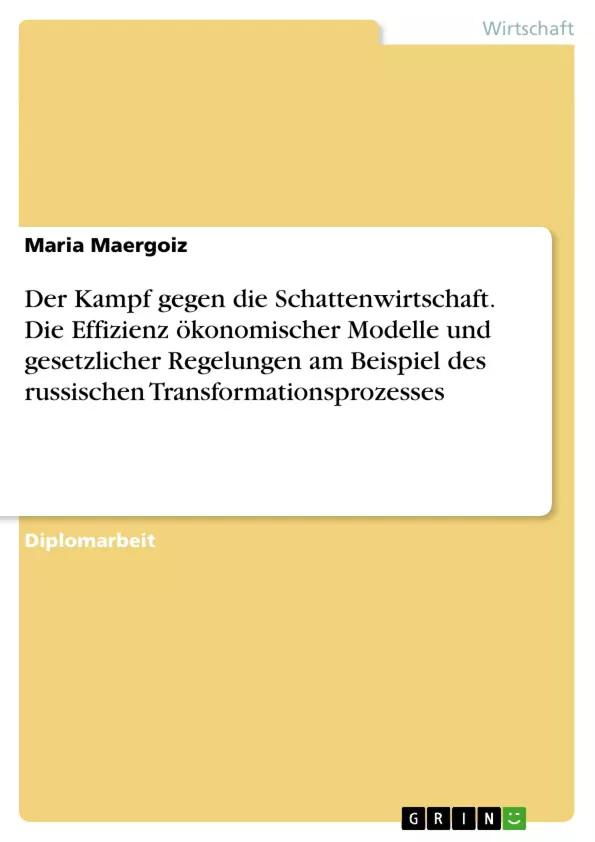Der erfolgreiche Wahlkampf des russischen Präsidenten Wladimir Putin im
Jahre 2000 lief unter dem bezeichnenden Motto “Diktatur des Gesetzes”. Wie
ist dies in einem Land zu beurteilen, dessen Schattenwirtschaft, nach unterschiedlichen
Schätzungen, 40 bis 80% des Bruttosozialprodukts ausmacht?
Nach den Berechnungen des Korruptionsindex durch Transparency International,
belegte Russland mit 2,7 Punkten (wobei 0 Punkte für hoch korrupt,
und 10 Punkte für ein sehr niedriges Korruptionsniveau stehen) im Jahre 2002
Platz 74 von 102 untersuchten Staaten - und gehört damit, neben anderen
Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu den korruptesten Länder der Welt. Seit
fast zwei Jahrzehnten beklagen russische Wirtschaft-, Rechts- und Sozialwissenschaftler,
genauso wie der postsowjetische Durchschnittsrusse die Allianz
von “Teneviki”, zu deutsch “Schattenmänner” und korrupten Beamten.
Allerdings erfordert die Beurteilung und erst recht die Bekämpfung des Phänomens
Schattenwirtschaft fundierte Kenntnisse darüber, was genau sich hinter
diesem Begriff verbirgt. Nach wie vor stellt die Erfassung der Schattenwirtschaft
ein Problem dar, wobei selbst die Anwendung in westlichen Industriel
ändern erprobter Methoden im Falle Russland häufig nicht oder nur mit Korrekturen
möglich ist. Hinzu kommt, dass der Bekanntheitsgrad einschlägiger
Werke in Russland noch recht niedrig ist, die Erfahrungen in der Anwendung
darin beschriebener Methoden fehlen beinahe völlig. Schweigen, Schönfärberei
und Verschleierung betrafen in der Sowjetunion nicht nur die schattenwirtschaftlichen,
sondern jegliche wirtschaftlichen Aktivitäten. Umso komplizierter
ist es, Klarheit über die herrschenden Verhältnisse zu schaffen.
Soll der russische Gesetzgeber nun die Gesetze verschärfen, mit drakonischen
Strafen gegen schattenwirtschaftliche Aktivitäten vorgehen und die Aufwendungen
für die Steuerpolizei verzehnfachen? Gibt es eine Möglichkeit, das optimale
Niveau der Bekämpfung inoffizieller Wirtschaftsaktivitäten zu ermitteln?
Welche Faktoren tragen zur Ausweitung der Schattenwirtschaft bei, was mindert
die Attraktivität einer inoffiziellen Zweitbeschäftigung?
Die vorliegende Arbeit soll nun dazu beitragen, etwas Licht in die russische
Schattenwirtschaft zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Phänomen Schattenwirtschaft
- 1.1 Definitions- und Abgrenzungsproblematik.
- 1.2 Zu den Wohlfahrtseffekten der Schattenwirtschaft
- 1.3 Modell zur Ermittlung des optimalen Umfangs der Bekämpfung.
- 1.3.1 Die individuelle Betrachtung.
- 1.3.2 Gesellschaftliche Wohlfahrt.
- 1.3.3 Optimale Höhe der Geldstrafe
- 1.3.4 Optimale Dauer der Haftstrafe.
- 1.3.5 Optimale Kombination aus Geld- und Haftstrafe.
- 1.3.6 Einige Modellerweiterungen
- 1.4 Methoden der Erfassung
- 1.4.1 Direkte Methoden.
- 1.4.2 Indirekte Methoden
- 2 Sozialistisches und privates Wirtschaften in der Sowjetunion
- 2.1 Vorbemerkungen zur Schattenwirtschaft im Sozialismus.
- 2.2 Die Ausgestaltung der Budgeteinnahmen des sowjetischen Staates
- 2.2.1 Budgeteinnahmen aus dem sozialistischen Sektor
- 2.2.2 Budgeteinnahmen von der Bevölkerung.
- 2.2.3 Budgeteinnahmen von ausländischen natürlichen sowie juristischen Personen, Joint Ventures und Erlösen sowjetischer Betriebe aus Exporten
- 2.3 Zur Bedeutung sowjetischer Steuern für die Schattenwirtschaft.
- 2.4 Einige Besonderheiten des sowjetischen Schattensektors
- 2.4.1 Preisbildung.
- 2.4.2 Produktion
- 2.4.3 Legale Privatwirtschaft
- 2.4.4 Landwirtschaft
- 2.5 Sowjetische Forschung
- 2.5.1 Historischer Abriss
- 2.5.2 Konzept der "farbigen Märkte"
- 3 Schattenwirtschaft im Transformationsprozess
- 3.1 Ursachen und Erklärungsansätze
- 3.2 Besonderheiten russischer Schattenwirtschaft
- 3.3 Korruption
- 3.4 Enwicklungen im russischen Steuersystem
- 3.5 Probleme der Erfassung der Schattenwirtschaft.
- 4 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Bekämpfung der Schattenwirtschaft und analysiert die Aussagekraft ökonomischer Modelle sowie die Effizienz gesetzlicher Regelungen, insbesondere im Kontext des russischen Transformationsprozesses.
- Definition und Abgrenzung der Schattenwirtschaft
- Analyse der Wohlfahrtseffekte der Schattenwirtschaft
- Entwicklung und Anwendung von Modellen zur Bestimmung des optimalen Umfangs der Bekämpfung der Schattenwirtschaft
- Untersuchung der Methoden zur Erfassung der Schattenwirtschaft
- Bedeutung der Schattenwirtschaft im russischen Transformationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 beleuchtet das Phänomen der Schattenwirtschaft, definiert und grenzt sie ab, untersucht die Wohlfahrtseffekte und entwickelt ein Modell zur Ermittlung des optimalen Umfangs der Bekämpfung. Weiterhin werden Methoden zur Erfassung der Schattenwirtschaft vorgestellt.
- Kapitel 2 analysiert das sozialistische und private Wirtschaften in der Sowjetunion, beleuchtet die Ausgestaltung der Budgeteinnahmen des sowjetischen Staates und diskutiert die Bedeutung sowjetischer Steuern für die Schattenwirtschaft. Besonderheiten des sowjetischen Schattensektors, wie Preisbildung und Produktion, werden ebenfalls betrachtet.
- Kapitel 3 fokussiert auf die Schattenwirtschaft im Transformationsprozess Russlands. Ursachen und Erklärungsansätze werden untersucht, Besonderheiten der russischen Schattenwirtschaft beleuchtet und die Rolle der Korruption analysiert. Die Entwicklungen im russischen Steuersystem und die Probleme der Erfassung der Schattenwirtschaft werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Schattenwirtschaft, Transformationsprozess, Russland, ökonomische Modelle, Effizienz, gesetzliche Regelungen, Wohlfahrtseffekte, Budgeteinnahmen, Korruption, Steuersystem, Methoden der Erfassung.
Häufig gestellte Fragen
Wie groß ist die Schattenwirtschaft in Russland?
Schätzungen gehen davon aus, dass sie zwischen 40 % und 80 % des Bruttosozialprodukts ausmacht.
Was bedeutet Putins Motto „Diktatur des Gesetzes“?
Es war ein Wahlkampfmotto aus dem Jahr 2000, das auf eine striktere Durchsetzung gesetzlicher Regelungen und die Bekämpfung von Korruption abzielte.
Wie wird die optimale Höhe von Strafen ermittelt?
Die Arbeit nutzt ökonomische Modelle, um die optimale Kombination aus Geld- und Haftstrafen zur Abschreckung inoffizieller Aktivitäten zu berechnen.
Warum ist die Erfassung der russischen Schattenwirtschaft so schwierig?
Methoden aus westlichen Industrieländern sind oft nicht direkt übertragbar, zudem erschweren Korruption und eine Tradition der Verschleierung aus Sowjetzeiten die Datenlage.
Welchen Einfluss hatte das sowjetische Steuersystem?
Die Arbeit analysiert, wie die Ausgestaltung der Budgeteinnahmen in der Sowjetunion bereits die Entstehung des Schattensektors begünstigte.
- Quote paper
- Maria Maergoiz (Author), 2003, Der Kampf gegen die Schattenwirtschaft. Die Effizienz ökonomischer Modelle und gesetzlicher Regelungen am Beispiel des russischen Transformationsprozesses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16518