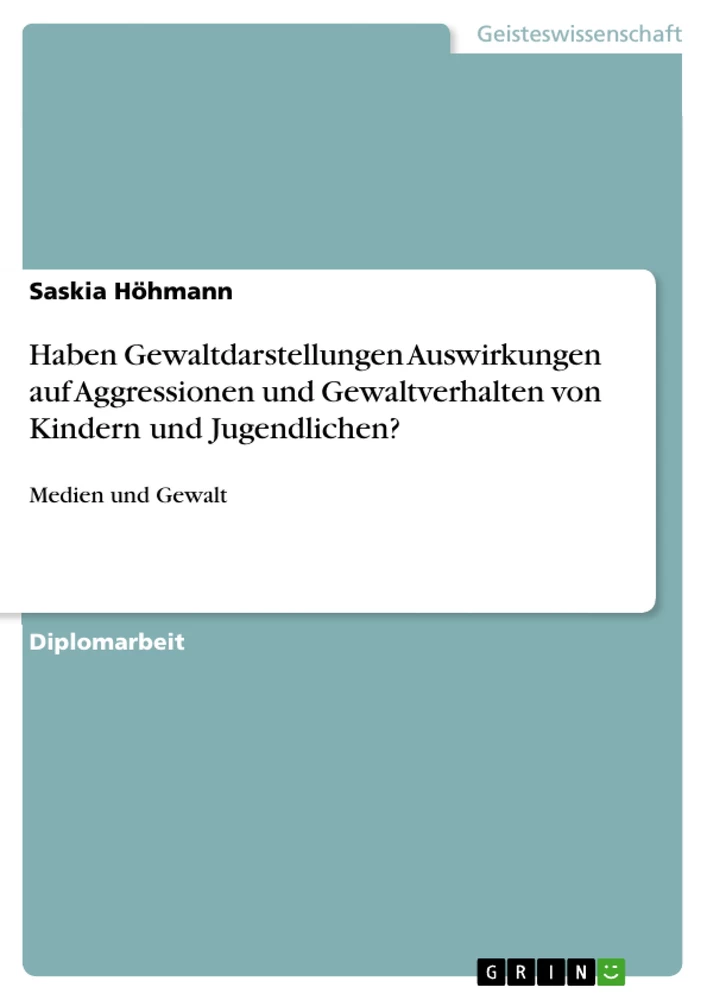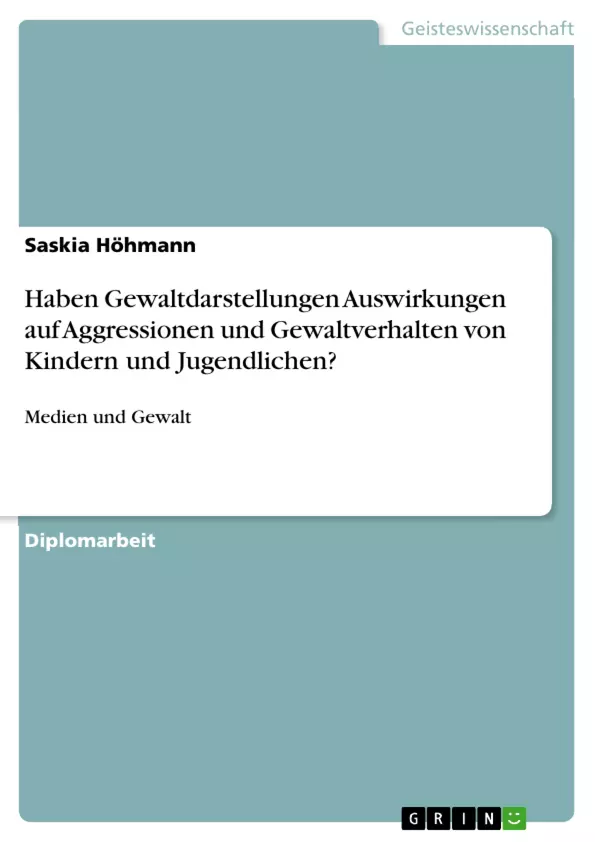In Deutschland wird immer wieder das Thema Medien und Gewalt aufgegriffen und über die möglichen, meist negativen, Wirkungen auf den Menschen spekuliert. Insbesondere in den Medien wird dieses Thema gerne diskutiert. In den Berichterstattungen werden nur zu oft Medien als der schnell gefundene und alleinige Sündenbock dargestellt und negative Begriffe geprägt, wie zum Beispiel der Begriff „Killerspiele“ für gewalthaltige und kampforientierte Computerspiele. Mittlerweile hat dieses Thema auch den Eingang in die deutsche Politik gefunden, welche sich aufgrund des regen Interesses der Öffentlichkeit, diesem Thema annahm. Insbesondere nach den Amokläufen in Erfurt (2002) und Emsdetten (2006) wurden Verbote von „Killerspielen“ gefordert, die bisher folgenlos blieben. Nach diesen Ereignissen wurde jedoch das Jugendschutzgesetz in einigen Punkten geändert und das Waffengesetz verschärft.
Betrachtet man die Entwicklung der Medien und die Diskussion um ihre Wirkungen insbesondere auf Kinder und Jugendliche, ist das Interesse an diesem Thema durchaus nicht neu. Im Grunde wurde jede neue Technologie in der Öffentlichkeit negativ dargestellt. Zunächst hatte das Kino Anfang des 20. Jahrhunderts einen sehr schlechten Einfluss auf Kinder und Jugendliche und galt als anstößig. Als Nächstes kam der Fernseher, dann die Videokassetten und nun die Computerspiele. Dabei werden Medien immer mehr in den Alltag integriert und sind kaum noch aus dem alltäglichen Leben und der Wirtschaft wegzudenken. Vor allem Kinder und Jugendliche wachsen mit Medien auf und benutzen diese ganz selbstverständlich.
Festzustellen ist jedoch auch, dass die immer besseren Technologien unter Umständen neue Trends und Möglichkeiten der Gewaltausübung hervorbringen können. Hier ist vor allem das „Happy Slapping“ und das „Cybermobbing“ zu erwähnen. Bei ersterem geht es darum, dass Kinder und Jugendliche eine Person tätlich angreifen. Diese Körperverletzungen wird von einem weiteren Jugendlichen mit dem Handy aufgenommen und im Internet veröffentlicht oder von Handy zu Handy verschickt. Die Opfer sind meistens unbekannte Personen, aber auch Mitschüler oder Lehrer. Die Kinder und Jugendlichen finden diese Videos „cool“ und zeigen keinerlei Mitleid mit den Opfern des Videos.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gewalt und Aggression
- 2.1 Definition Gewalt
- 2.2 Definition Aggression
- 2.3 Unterschied zwischen Gewalt und Aggression
- 3. Theorien und Erklärungsansätze
- 3. 1 Triebtheoretischer Ansatz (Freud 1920)
- 3.2 Frustrations-Aggressions-Hypothese
- 3.3 Katharsis-Hypothese
- 3.4 Soziale Lerntheorie
- 3.5 Kriminalität und Gewalt von Kindern und Jugendlichen
- 4. Medien in der Gesellschaft
- 4.1 Definition Medien
- 4.2 Veränderungen der Gesellschaft und der Familie
- 4.3 Welche Rolle spielen Medien für Kinder und Jugendliche?
- 4.4 Medienausstattung und Mediennutzung
- 4.5 Medienwirkungstheorien
- 4.5.1 These der Wirkungslosigkeit
- 4.5.2 Katharsisthese
- 4.5.3 Inhibitionsthese
- 4.5.4 Habitualisierungsthese
- 4.5.5 Kultivierungsthese
- 4.5.6 Imitationstheorie bzw. Lerntheorie
- 5. Fernsehen
- 5.1 Kindheit und Fernsehen
- 5.2 Spielfilmgewalt
- 5.3 Gewaltdarstellungen in Nachrichten
- 5.4 Positive und negative Wirkungen des Fernsehens auf Kinder und\nJugendliche
- 5.5 Zusammenhang Fernsehen und Gewaltverhalten
- 6. Computerspiele
- 6.1 Kindheit und Computerspiele
- 6.2 Merkmale von Computerspielen
- 6.3 Negative und positive Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
- 6.4 Zusammenhang Computerspiele und Gewalt
- 7. Rechtlicher Schutz für Kinder und Jugendliche gegen\nGewaltdarstellungen
- 7.1 Jugendschutzgesetz
- 7.2 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
- 7.3. Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
- 7.4 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)
- 8. Medienkompetenz
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob und inwieweit Gewaltdarstellungen in Medien Auswirkungen auf das Gewaltverhalten von Kindern und Jugendlichen haben. Die Arbeit untersucht verschiedene Theorien und Erklärungsansätze zur Medienwirkung, analysiert die Rolle von Fernsehen und Computerspielen in der Gesellschaft und beleuchtet rechtliche Schutzmechanismen sowie die Bedeutung von Medienkompetenz.
- Einfluss von Gewaltdarstellungen in Medien auf Kinder und Jugendliche
- Theorien und Erklärungsansätze zur Medienwirkung
- Rolle von Fernsehen und Computerspielen in der Gesellschaft
- Rechtlicher Schutz vor jugendgefährdenden Medieninhalten
- Bedeutung von Medienkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Medien und Gewalt“ ein und beleuchtet die gesellschaftliche Relevanz dieser Frage. Kapitel 2 definiert die Begriffe Gewalt und Aggression und differenziert zwischen den beiden Konzepten. Kapitel 3 befasst sich mit verschiedenen Theorien und Erklärungsansätzen zum Einfluss von Medien auf das Gewaltverhalten. Hier werden unter anderem der Triebtheoretische Ansatz, die Frustrations-Aggressions-Hypothese, die Katharsis-Hypothese und die Soziale Lerntheorie vorgestellt. In Kapitel 4 werden Medien im Kontext der Gesellschaft betrachtet, wobei insbesondere Veränderungen der Gesellschaft und der Familie sowie die Rolle von Medien für Kinder und Jugendliche im Fokus stehen. Die Entwicklung der Medienausstattung und Mediennutzung sowie verschiedene Medienwirkungstheorien werden ebenfalls beleuchtet. Kapitel 5 konzentriert sich auf das Fernsehen als Medium und untersucht den Einfluss von Spielfilmgewalt, Gewaltdarstellungen in Nachrichten sowie positive und negative Wirkungen des Fernsehens auf Kinder und Jugendliche. Der Zusammenhang zwischen Fernsehen und Gewaltverhalten wird ebenfalls analysiert. Kapitel 6 befasst sich mit Computerspielen und untersucht die Merkmale von Computerspielen sowie deren positive und negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Der Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt wird ebenfalls beleuchtet. Kapitel 7 untersucht rechtliche Schutzmechanismen für Kinder und Jugendliche gegen Gewaltdarstellungen in Medien, wie das Jugendschutzgesetz, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) und die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK). Das Kapitel 8 behandelt das Thema Medienkompetenz.
Schlüsselwörter
Medien und Gewalt, Gewaltdarstellungen, Aggression, Medienwirkungstheorien, Fernsehen, Computerspiele, Jugendschutz, Medienkompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Haben "Killerspiele" einen direkten Einfluss auf Gewalt bei Jugendlichen?
Die Arbeit untersucht diesen Zusammenhang kritisch und stellt fest, dass Medien oft als Sündenböcke dienen, während komplexe psychologische Theorien verschiedene Wirkungsweisen (z.B. Habitualisierung oder Katharsis) diskutieren.
Was ist der Unterschied zwischen Gewalt und Aggression?
Die Arbeit definiert und differenziert beide Begriffe in Kapitel 2, um eine wissenschaftliche Grundlage für die Wirkungsanalyse zu schaffen.
Was besagt die Katharsis-Hypothese im Medienkontext?
Die Hypothese geht davon aus, dass das Betrachten von Gewaltdarstellungen Aggressionen beim Zuschauer abbauen kann (Reinigungseffekt).
Was versteht man unter "Happy Slapping"?
Dabei filmen Jugendliche physische Angriffe auf Personen mit dem Handy und verbreiten diese Videos im Internet.
Welche rechtlichen Schutzmechanismen gibt es für Kinder in Deutschland?
Dazu zählen das Jugendschutzgesetz, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien sowie Selbstkontrollorgane wie FSK und USK.
- Citar trabajo
- Saskia Höhmann (Autor), 2010, Haben Gewaltdarstellungen Auswirkungen auf Aggressionen und Gewaltverhalten von Kindern und Jugendlichen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165407