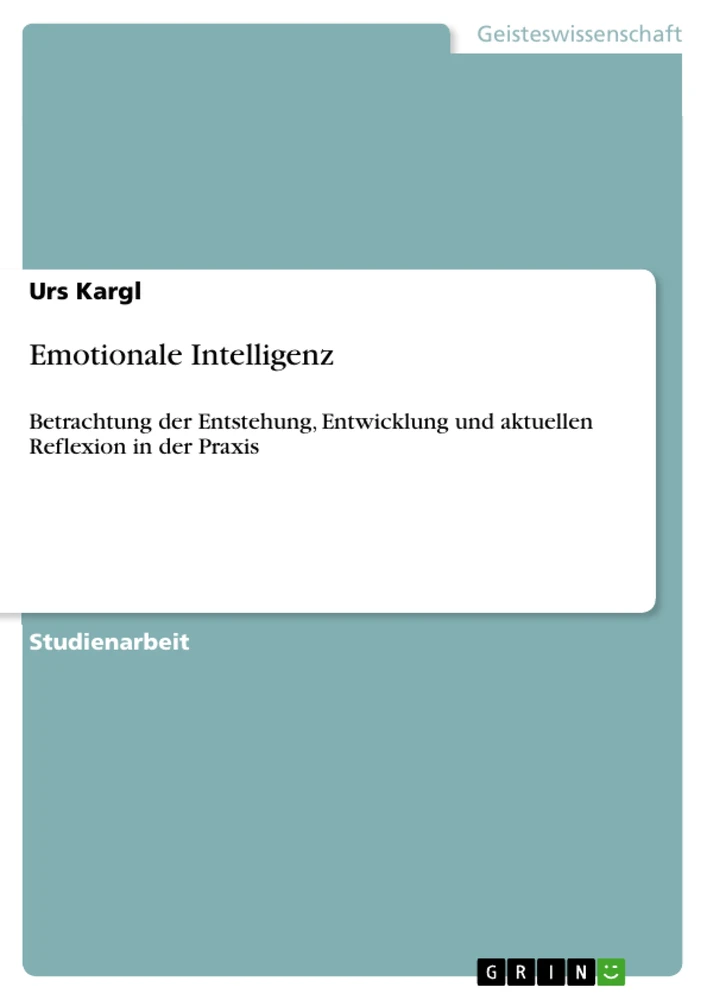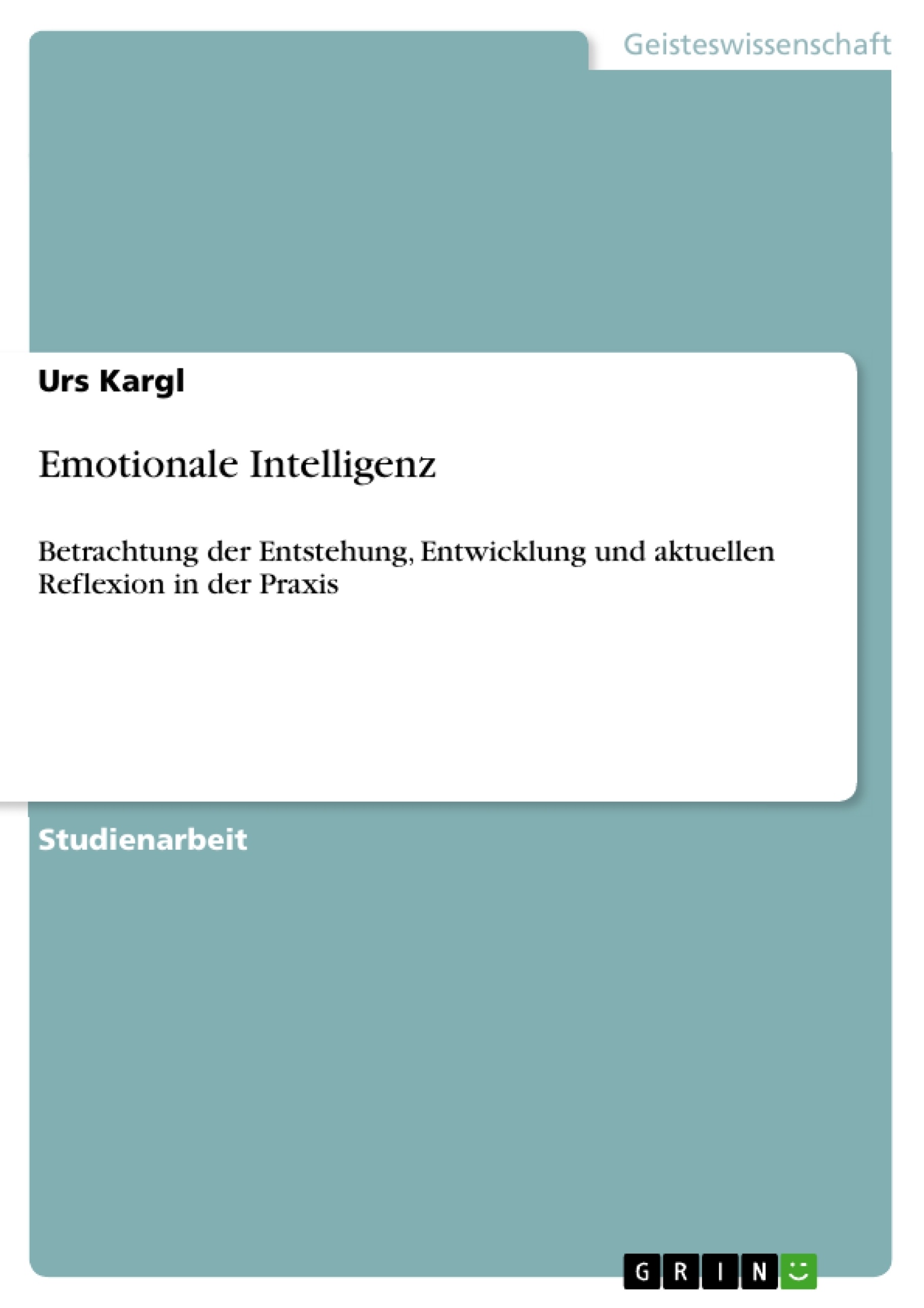Schon Aristoteles beschäftigte sich mit dem Thema der Emotionen und wie man mit ihnen umgehen sollte. Er forderte, man solle „ … die seltene Fähigkeit besitzen, gegen die rechte Person, im rechten Maße, zur rechten Zeit und auf rechte Weise zornig zu sein.“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik ~ 322 vor Chr.)
Früher dachte man in westlichen Kulturen, dass Emotionen das Denken stören und deshalb kontrolliert werden müssen. Schon im ersten Jahrhundert vor Christus sagte Publilius Syrus: „Rule your feelings, let your feelings rule you.“, was so viel bedeutet wie: Regiere deine Gefühle, sonst regieren deine Gefühle dich. Heute ist man allerdings der Ansicht, dass Emotionen wichtig für das Fokussieren und Bestimmen des Denken und Handelns sind. Zum Beispiel unterscheiden uns Emotionen von Computern und Robotern. Aber was ist nun emotionale Intelligenz? Grob definiert bestimmt sie den richtigen Umgang mit eigenen Emotionen und Emotionen anderer. Sie beeinflusst den beruflichen Erfolg, die Beziehungen zu anderen Menschen und die eigene Zufriedenheit und Ausgeglichenheit.
Eine allgemein populäre Ansicht besagt, dass der EQ (= emotionaler Quotient) den beruflichen Erfolg zu 80% erklärt, während die akademische Intelligenz (= IQ) ihn nur zu 20% erklärt. Emotionale Intelligenz symbolisiert gewissermaßen das „gewisse Etwas“ zwischen einem Mitarbeiter und einer erfolgreichen Führungskraft.
Die nachfolgende Arbeit führt in ein Grundverständnis von Emotionen ein und beschäftigt sich mit den grundlegenden Komponenten der Emotionalen Intelligenz. Weiter werden die Theorien von Peter Salovey & John D. Mayer und Daniel Goleman einander gegenübergestellt. Ein Überblick samt Einführung in Messmethoden für das Erfassen von
Emotionaler Intelligenz folgt anschließend. Die kritische Würdigung und Reflexion der Theorie sowie die Anwendungsbezüge schließen die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einordnung in das Themengebiet
1.2 Einführung in die Gebiete der Emotion und Intelligenz
1.2.1 Einführung Emotion
1.2.2 Einführung Intelligenz
1.3 Forschungsansätze
1.4 Klassische Emotionstheorien
1.4.1 James-Lange-Theorie der Emotion
1.4.2 Cannon-Bard-Theorie der Emotion
1.4.3 Zwei-Faktoren-Theorie von Schachter
1.5 Einführung in die Emotionale Intelligenz
1.5.1 Physiologie der Emotionalen Intelligenz
2 Hauptteil
2.1 Entwicklung der Emotionalen Intelligenz
2.1.1 Modell nach Peter Salovey & John D. Mayer (1990)
2.1.2 Modell nach Peter Salovey & John D. Mayer (1997)
2.1.3 Modell nach Daniel Goleman (1995)
2.1.4 Modell nach Daniel Goleman (2002)
2.2 Messmethoden
2.2.1 TMMS - Trait-Meta-Mood-Scale (Salovey et al., 1995)
2.2.2 MSCEIT Multifactor Emotional Intelligence - Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (Mayer, Salovey & Caruso, 1997)
2.2.3 EQ-I - Emotional Quotient Inventory (BarOn, 1997)
2.2.4 ECI - Emotional Competence Inventory (Goleman, 1998)
2.2.5 ECI - Emotional Competence Inventory (Boytazis et al., 1999)
3 Kritische Würdigung
3.1 Nach Heinz Schuler – Emotionale Intelligenz als Etikettenschwindel
3.2 Nach John D. Mayer
3.3 Fazit
4 Schluss
4.1 Anwendungsbezug
4.2 Reflexion
5 Literaturangaben
Häufig gestellte Fragen
Was ist emotionale Intelligenz (EQ)?
EQ bezeichnet die Fähigkeit, eigene Gefühle und die Gefühle anderer korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und das Denken sowie Handeln entsprechend sinnvoll zu beeinflussen.
Wie unterscheiden sich die Modelle von Goleman und Salovey/Mayer?
Salovey und Mayer betrachten EQ eher als kognitive Fähigkeit, während Daniel Goleman ein breiteres Modell inklusive Persönlichkeitsmerkmalen und sozialer Kompetenz vertritt.
Warum gilt EQ als wichtiger Faktor für beruflichen Erfolg?
Studien legen nahe, dass akademische Intelligenz (IQ) nur einen Teil des Erfolgs erklärt, während EQ entscheidend für Führungskompetenz, Teamarbeit und Stressbewältigung ist.
Mit welchen Methoden lässt sich emotionale Intelligenz messen?
Bekannte Tests sind der MSCEIT (leistungsorientiert) sowie Selbstbericht-Verfahren wie der EQ-i oder das Emotional Competence Inventory (ECI).
Was besagt die Zwei-Faktoren-Theorie von Schachter?
Sie postuliert, dass Emotionen aus einer physiologischen Erregung und einer darauffolgenden kognitiven Bewertung dieser Erregung entstehen.
- Quote paper
- Dipl. Urs Kargl (Author), 2010, Emotionale Intelligenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165643