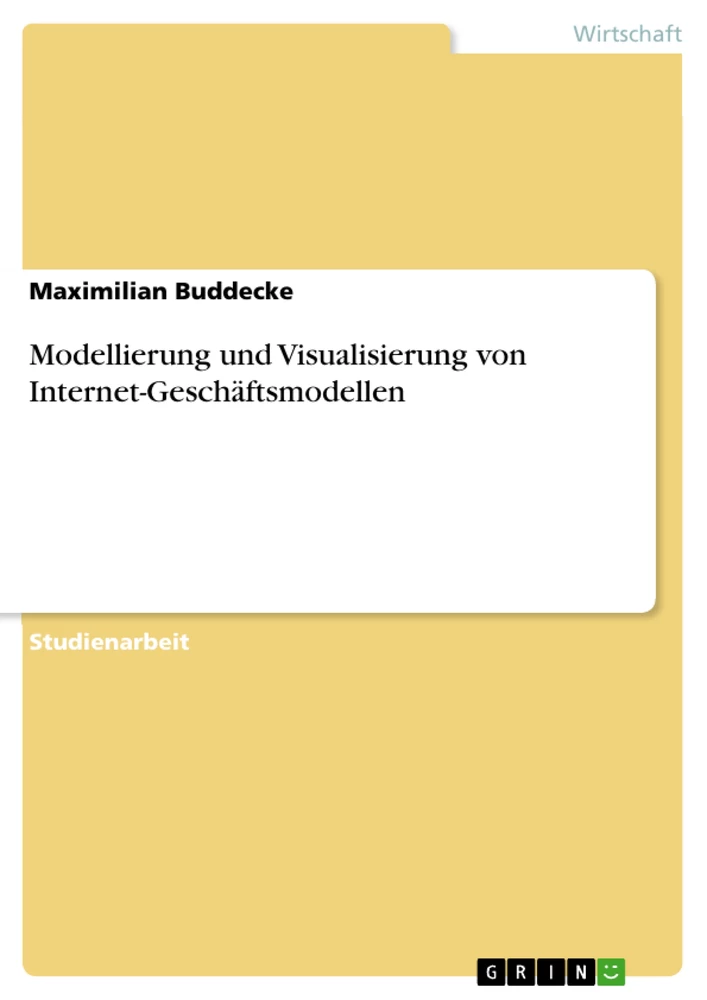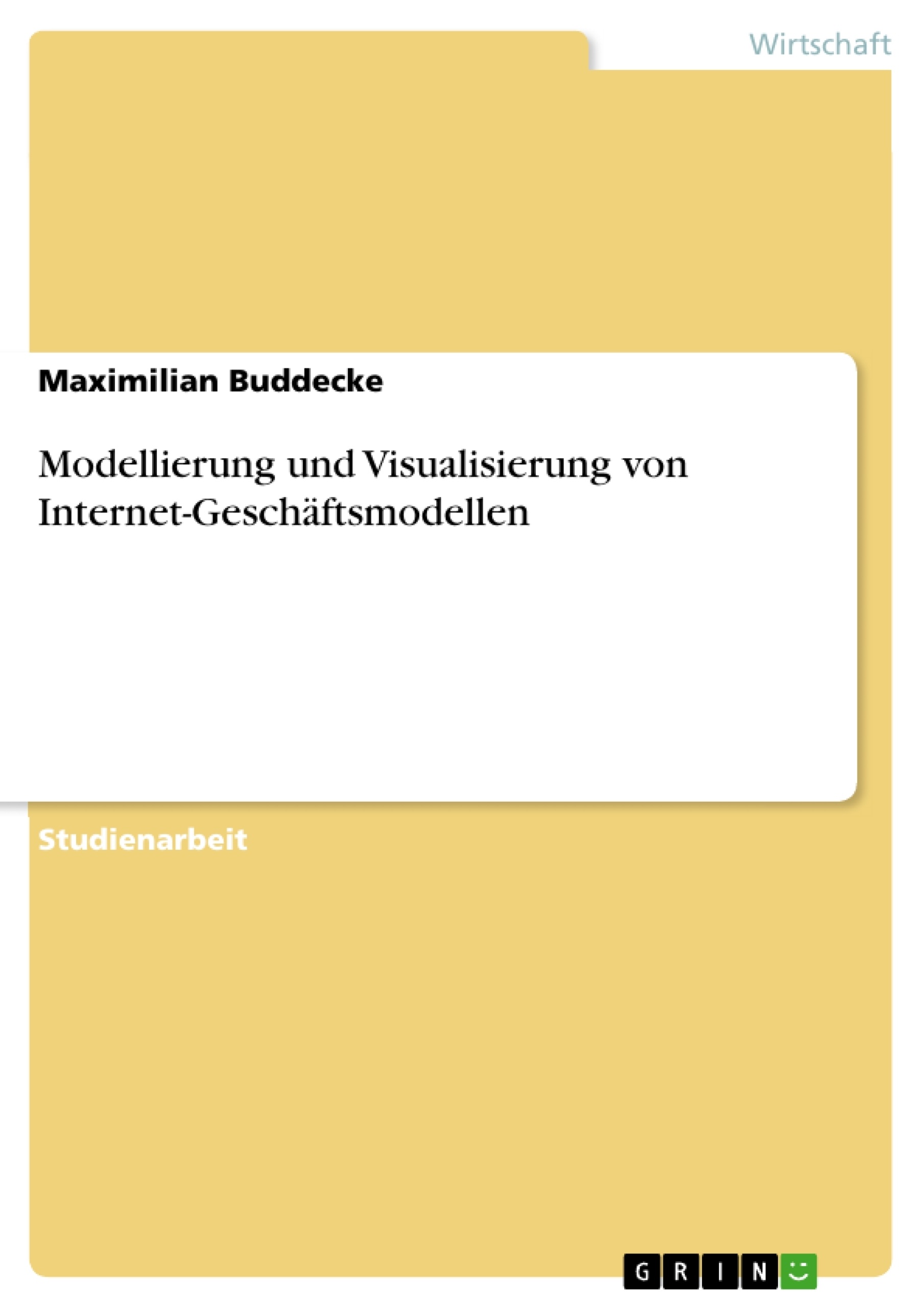Die betriebswirtschaftliche Bedeutung des Internets hat in der vergangenen Zeit stark zugenommen, Web 2.0 wurde etabliert und viele neue Internet-Start-Up-Unternehmen wurden gegründet. Die direkte Übernahme traditioneller Geschäftskonzepte für das Internet gestaltet sich jedoch als schwierig. Um diese Herausforderung zu meistern, werden Möglichkeiten gesucht, Konzepte in Form von neuen Modellen darzustellen, welche häufig als Geschäftsmodelle bezeichnet werden. Für den Einstieg in die internetbasierte Geschäftswelt, das Gewinnen von Investoren, das Planen des Geschäftsaufbaus und die Vorstellung bei Führungskräften und Entscheidungsträgern sind Geschäftsmodelle relevant. „Because a business model tells a good
story, it can be used to get everyone in the organization aligned around the kind of value the company wants to create“ (Magretta 2002). In der Literatur gibt es eine Vielzahl von Ansätzen, wie solche Geschäftsmodelle technisch und grafisch dargestellt werden können. Um einschätzen zu können, welche Ansätze für den jeweiligen
Adressaten von Interesse sind, ist ein Vergleich vorteilhaft.
Diese Seminararbeit hat als Ziel, zwei unterschiedliche Ansätze vor dem Hintergrund Web 2.0 zur Modellierung und Visualisierung von Internet Geschäftsmodellen zu vergleichen und in den Rahmen der verschiedenen Ansätze einzuordnen. Des Weiteren sollen die Ansätze auf ihre Vor- und Nachteile untersucht und zur jeweiligen Zielgruppe zugeordnet werden. Dem interessierten Leser sollen die Notwendigkeit und der Nutzen der Modellierung von Geschäftsmodellen aufgezeigt werden. Nach dieser Einführung werden zunächst die Begriffe Geschäftsmodell und Web 2.0 für den weiteren Verlauf der Arbeit definiert, der Nutzen ihrer Modellierung und Visualisierung
erläutert, die Anforderungen an die grafische Repräsentation
erfasst und die verschiedenen Zielgruppen aufgezählt. Nach einer kurzen Erläuterung, warum die Wahl auf diese bestimmten Ansätze fiel, werden diese nacheinander vorgestellt, ihre jeweilige Zielgruppe genannt und auf Vor- und Nachteile untersucht. Abschließend wird ihre Stellung im Rahmen weiterer verschiedener Ansätze geklärt. Am Schluss erfolgt eine Zusammenfassung
der Ergebnisse mit einem Ausblick auf die Zukunft der Geschäftsmodellierung und deren Bedeutung in Hinsicht auf das Thema Web 2.0.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen
- Begriffsbestimmung
- Entstehung und Definition von Web 2.0
- Definition des Geschäftsmodellbegriffes
- Geschäftsmodelle im Web 2.0
- Modellierung und Visualisierung von Internet Geschäftsmodellen
- Nutzen
- Anforderung
- Zielgruppen
- Modellierungs- und Visualisierungsmethoden
- Begriffsbestimmung
- Einstufung der Arbeit
- Ansatz von Deelmann
- Modellierungsbeispiel Onlineauktionshaus
- Zielgruppeneinordnung
- Vorteile
- Nachteile
- Ansatz von Wirtz
- Modellierungsbeispiel StudiVZ
- Zielgruppeneinordnung
- Vorteile
- Nachteile
- Gesamtüberblick
- Modellierungsbeispiel von Stähler
- Modellierungsbeispiel von Weill und Vitale
- Einordnung der Ansätze
- Ansatz von Deelmann
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit setzt sich zum Ziel, zwei verschiedene Ansätze zur Modellierung und Visualisierung von Internet Geschäftsmodellen vor dem Hintergrund von Web 2.0 zu vergleichen und im Kontext verschiedener Ansätze einzuordnen. Darüber hinaus werden die Ansätze hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile untersucht und jeweils einer Zielgruppe zugeordnet. Die Arbeit soll dem interessierten Leser die Notwendigkeit und den Nutzen der Modellierung von Geschäftsmodellen aufzeigen.
- Vergleich von zwei unterschiedlichen Ansätzen zur Modellierung und Visualisierung von Internet Geschäftsmodellen
- Einordnung der Ansätze in den Rahmen verschiedener Ansätze
- Analyse der Vor- und Nachteile der Ansätze
- Zuordnung der Ansätze zu jeweiligen Zielgruppen
- Aufzeigen der Notwendigkeit und des Nutzens der Modellierung von Geschäftsmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die wachsende Bedeutung des Internets für die Betriebswirtschaftslehre sowie die Herausforderungen bei der Übertragung traditioneller Geschäftskonzepte ins Internet beleuchtet. Anschließend werden die Begriffe "Geschäftsmodell" und "Web 2.0" definiert und der Nutzen sowie die Anforderungen an die Modellierung und Visualisierung von Internet Geschäftsmodellen erläutert. Die verschiedenen Zielgruppen werden aufgezählt.
Im darauffolgenden Kapitel werden die Ansätze von Deelmann und Wirtz vorgestellt, die sich mit der Modellierung und Visualisierung von Internet Geschäftsmodellen im Web 2.0 Kontext befassen. Die Ansätze werden anhand von Beispielen illustriert und jeweils einer Zielgruppe zugeordnet. Ihre Vor- und Nachteile werden diskutiert.
Das letzte Kapitel bietet einen Gesamtüberblick über verschiedene Ansätze zur Modellierung und Visualisierung von Internet Geschäftsmodellen. Dabei werden die Ansätze von Stähler und Weill & Vitale betrachtet und im Kontext der vorherigen Analyse eingeordnet.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Themen Geschäftsmodellierung, Visualisierung, Internet Geschäftsmodelle, Web 2.0, Modellierungsmethoden, Zielgruppen, Vor- und Nachteile, Vergleich, Einordnung, Notwendigkeit, Nutzen.
- Quote paper
- Maximilian Buddecke (Author), 2010, Modellierung und Visualisierung von Internet-Geschäftsmodellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165722