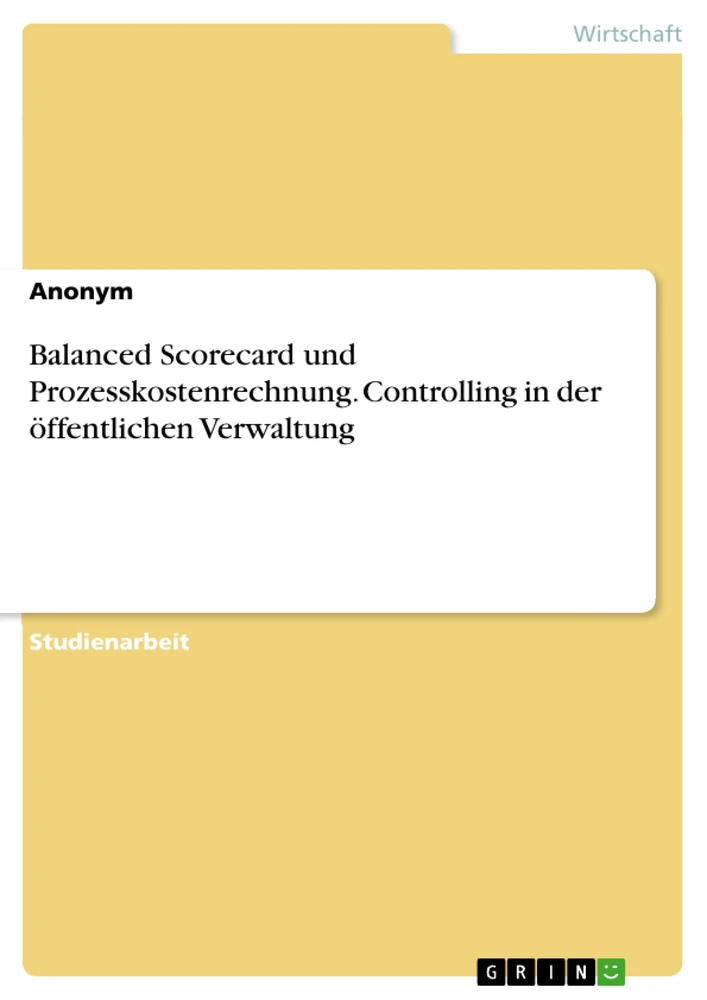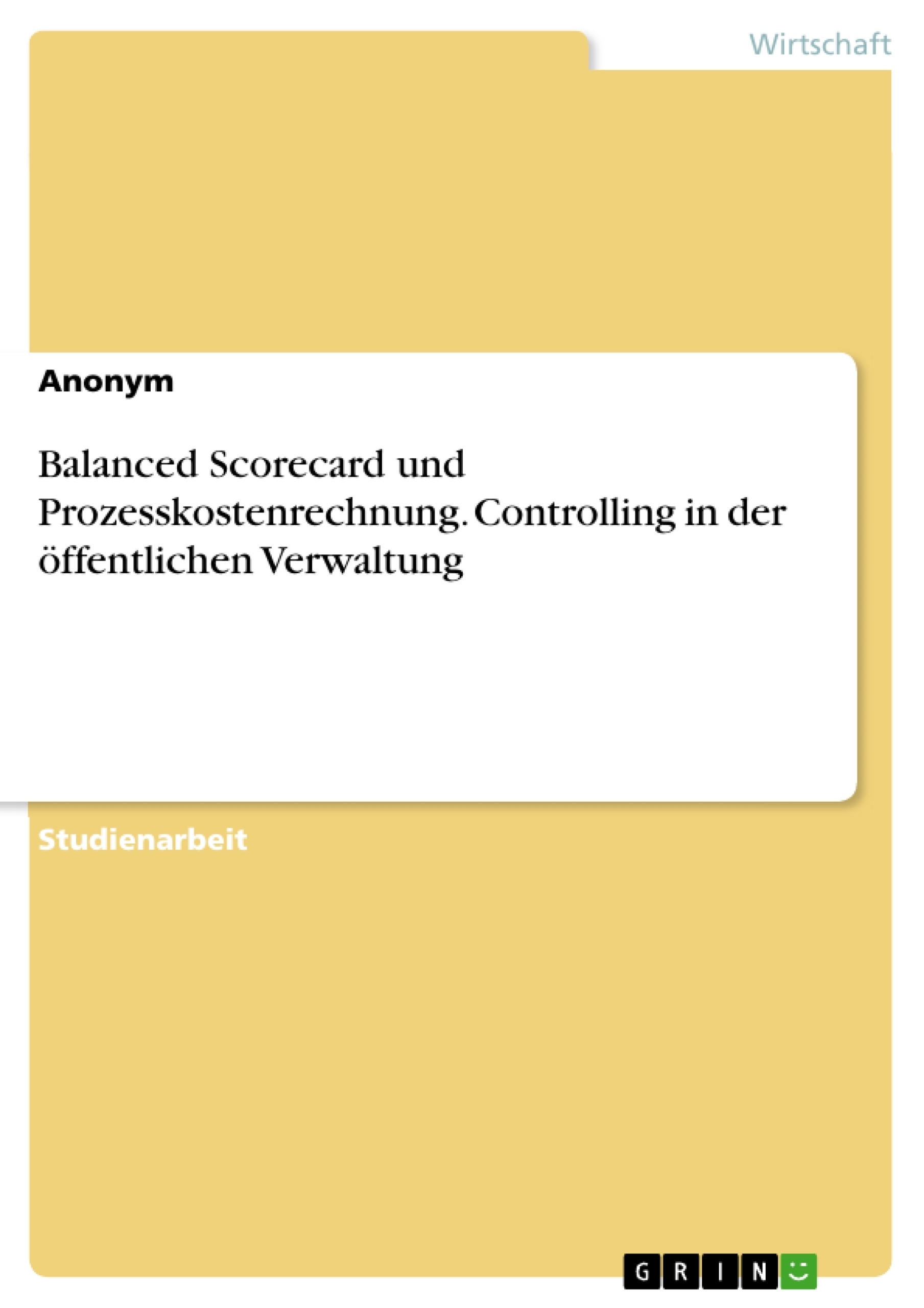Aufgrund anhaltender Haushaltsdefizite von Bund, Ländern und Gemeinden und der damit verbundenen Finanzsituation steigt der Kostendruck in öffentlichen Verwaltungen an. Die Anforderungen an Kostenrechnungssysteme steigen. Ein Instrument, welches Planung, Steuerung und Bewertung des öffentlichen Handelns unter Effizienzgesichtspunkten ermöglicht wird benötigt.
Auf der Suche nach neuen Steuerungsmöglichkeiten, die der öffentlichen Verwaltung aus der bestehenden Krise führen, werden Instrumente der privatwirtschaftlichen Steuerung auf deren Eignung in der öffentlichen Verwaltung überprüft.
In der vorliegenden Hausarbeit werden die prozessorientierte Kostenrechnung und die Balanced Scorecard als Controllinginstrumente der öffentlichen Verwaltung untersucht und deren Eignung festgestellt.
Dabei beschränkt sich das methodische Vorgehen auf die Literaturanalyse der einschlägigen Fachliteratur. Die Quellen wurden mit Blick auf ihre Geeignetheit zur Bearbeitung des Problems gesichtet, zusammengefasst und kritisch bewertet.
Der Aufbau der Hausarbeit gestaltet sich wie folgt. Zu Beginn soll die öffentliche Verwaltung als Untersuchungsgegenstand im Kapitel zwei analysiert werden. Dazu werden unterschiedliche Abgrenzungsansätze in Form von Zielen und Aufgaben betrachtet und verfassungsmäßige Grundsätze dargestellt.
Das dritte Kapitel thematisiert die Grundlagen und Ziele des Verwaltungscontrollings anhand der charakteristischen Merkmale der Verwaltungsbetriebe.
Im vierten Kapitel werden ausgewählte Controllinginstrumente vorgestellt und auf die öffentliche Verwaltung übertragen. Im ersten Teil des vierten Kapitels wird die prozessorientierte Kostenrechnung vorgestellt, wozu das Modell skizziert wird, sowie Ziele und Aufgaben dieses Kostenrechnungssystems aufgezeigt werden. Abschließend wird die Eignung der Prozesskostenrechnung für die öffentliche Verwaltung untersucht. Im zweiten Teil wird die Balanced Scorecard als Controllinginstrument vorgestellt. Es werden die Ziele und Aufgaben dieses Instrumentes dargestellt. Neben dem Grundkonzept werden die vier verschiedenen Perspektiven nach Kaplan und Norton vorgestellt und auf die öffentliche Verwaltung übertragen. Im Anschluss erfolgt eine Beurteilung des Systems als Controllinginstrument für die öffentliche Verwaltung.
Abschließend werden die zentralen Inhalte der Hausarbeit zusammengefasst und die Perspektiven für die wissenschaftliche Forschung aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Öffentliche Verwaltung als Untersuchungsobjekt
- Grundlagen und Ziele des Verwaltungscontrollings
- Führungsteilsysteme
- Zielsystem
- Planungssystem
- Kontrollsystem
- Informationssystem
- Controllinginstrumente der öffentlichen Verwaltung
- Prozessorientierte Kostenrechnung
- Definition
- Ziele und Aufgaben
- Kritische Würdigung
- Balanced Scorecard
- Definition
- Ziele und Aufgaben
- Perspektiven nach Kaplan und Norton
- Übertragung auf öffentliche Verwaltungen
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Prozessorientierte Kostenrechnung und die Balanced Scorecard als Controllinginstrumente in der öffentlichen Verwaltung und evaluiert ihre Eignung für diesen Bereich. Sie basiert auf einer Literaturanalyse relevanter Fachliteratur, die auf ihre Relevanz für die Fragestellung geprüft, zusammengefasst und kritisch bewertet wurde.
- Analyse der spezifischen Charakteristika der öffentlichen Verwaltung als Untersuchungsobjekt
- Darstellung der Grundlagen und Ziele des Verwaltungscontrollings
- Präsentation und Analyse der Prozessorientierten Kostenrechnung als Instrument des Verwaltungscontrollings
- Präsentation und Analyse der Balanced Scorecard als Instrument des Verwaltungscontrollings
- Abschließende Betrachtung und Reflexion der zentralen Inhalte der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 analysiert die öffentliche Verwaltung als Untersuchungsgegenstand und beleuchtet die verschiedenen Abgrenzungsansätze durch Ziele, Aufgaben und verfassungsmäßige Grundsätze.
- Kapitel 3 behandelt die Grundlagen und Ziele des Verwaltungscontrollings im Kontext der besonderen Merkmale der öffentlichen Verwaltung.
- Kapitel 4 stellt ausgewählte Controllinginstrumente vor und analysiert ihre Übertragbarkeit auf die öffentliche Verwaltung. In Teil 1 des Kapitels wird die Prozessorientierte Kostenrechnung vorgestellt, wobei das Modell skizziert, Ziele und Aufgaben dieses Kostenrechnungssystems erläutert und schließlich die Eignung für die öffentliche Verwaltung kritisch hinterfragt wird. Teil 2 widmet sich der Balanced Scorecard als Controllinginstrument, wobei Ziele und Aufgaben dargestellt werden, sowie die vier Perspektiven nach Kaplan und Norton vorgestellt und auf die öffentliche Verwaltung übertragen werden. Abschließend wird die Balanced Scorecard als Controllinginstrument für die öffentliche Verwaltung beurteilt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert sich auf die Controllinginstrumente Prozessorientierte Kostenrechnung und Balanced Scorecard im Kontext der öffentlichen Verwaltung. Wichtige Themenschwerpunkte sind die Spezifika der öffentlichen Verwaltung, das Verwaltungscontrolling, die Übertragbarkeit privatwirtschaftlicher Controllinginstrumente auf den öffentlichen Sektor und die Herausforderungen der Kostenrechnung und Strategieentwicklung in einem gemeinwohlorientierten Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Warum benötigt die öffentliche Verwaltung neue Controllinginstrumente?
Anhaltende Haushaltsdefizite und steigender Kostendruck erfordern effizientere Planungs- und Steuerungssysteme, die über die klassische Kameralistik hinausgehen.
Was ist das Ziel der prozessorientierten Kostenrechnung in der Verwaltung?
Sie soll Gemeinkosten transparenter machen, indem sie Kosten den tatsächlichen Verwaltungsprozessen zuordnet statt nur pauschalen Kostenstellen.
Wie lässt sich die Balanced Scorecard auf die Verwaltung übertragen?
Die klassischen Perspektiven (Finanzen, Kunden, Prozesse, Lernen) werden angepasst, wobei die Gemeinwohlorientierung oft an die Stelle der Profitmaximierung tritt.
Welche Herausforderungen gibt es beim Transfer privatwirtschaftlicher Instrumente?
Die öffentliche Verwaltung unterliegt spezifischen verfassungsrechtlichen Grundsätzen und verfolgt keine monetären Ziele, was die Erfolgsmessung erschwert.
Was sind die vier Perspektiven nach Kaplan und Norton?
Es handelt sich um die Finanzperspektive, die Kundenperspektive, die interne Prozessperspektive und die Lern- und Entwicklungsperspektive.
Welche methodische Basis hat diese Hausarbeit?
Die Arbeit basiert auf einer kritischen Literaturanalyse einschlägiger Fachliteratur zum Thema Verwaltungscontrolling.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Balanced Scorecard und Prozesskostenrechnung. Controlling in der öffentlichen Verwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165753