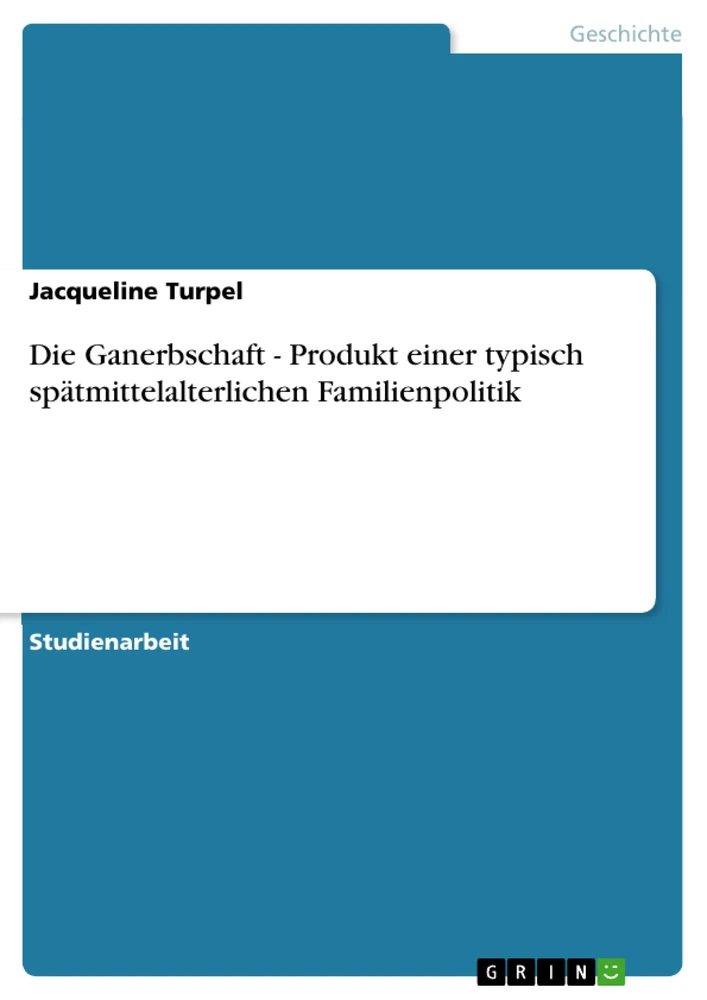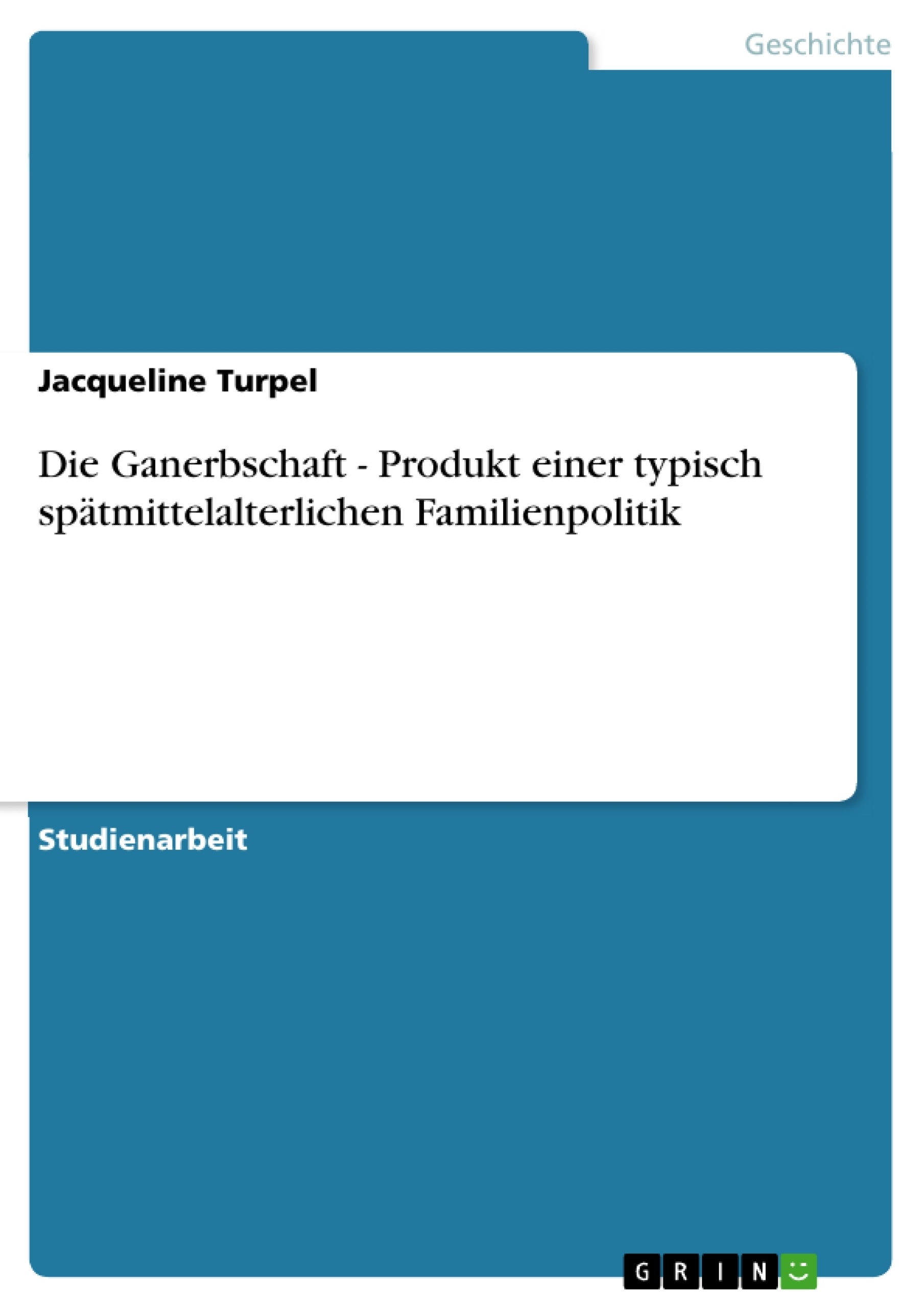Die Burg im mittelalterlichen deutschen Reich erfüllt mehrere Rollen gleichzeitig: sie ist militärischer Stützpunkt, Wohn- und Lebensbereich, Verteidigungsanlage, Wirtschaftsraum und Mittelpunkt der territorialen Herrschaft. Zudem darf man das sehr enge Verhältnis zwischen Burg und Herrschaft nicht unberücksichtigt lassen, welches besonders ausführlich von der Forschung behandelt wird. Es soll jedoch keinesfalls der Anschein eines flächendeckend heterogenen Herrschaftsbereiches und einer uniformen Burgenlandschaft erweckt werden. Unter den zahlreichen Variationen, die eine Burg hinsichtlich ihres Rechtsstatuses, ihres Zweckes oder ihrer geographischen Lage, erfahren kann, befinden sich Burgenformen, die bis jetzt nur spärlich von der Forschung in Augenschein genommen wurden. Zu ihnen zählt die Ganerbenburg, die vor allem durch ihre eigentümliche Bauweise und ihre besondere Sukzessionsregelung auffällt und eine teilweise sehr hohe Zahl an Miterben besitzen kann. Nur wenige Wissenschaftler beschäftigen sich ausführlicher mit dem Phänomen der Ganerbenburg. Zu nennen ist Friedrich Alsdorf, der das Thema von der rechtshistorischen Seite her betrachtet, sowie Henning Becker, der auf familiensoziologischer Basis sehr umfangreich und detailgetreu gearbeitet hat. Des Weiteren können noch die Aufsätze von Joachim Zeune oder Jens Friedhoff in Betracht gezogen werden, die sich jedoch mit ihren Ausführungen fast ausschließlich auf einzelne Burgen beschränken. Allgemein gesehen ist die Forschungslage eher spärlich und besticht hauptsächlich durch ihre thematischen Überschneidungen.
Zielsetzung dieser Arbeit ist es die Frage nach dem Repräsentativen einer Ganerbschaft für die Lage und Entwicklung des niederen Adels und der Ritterbünde im Spätmittelalter anhand einzelner Themengebiete zu erörtern. Mit dieser Vorgehensweise wird beabsichtigt die „Formenvielfalt und Komplexität“ einer Ganerbschaft an konkreten Beispielen zu verdeutlichen um sie als typische Familienform mittelalterlicher Zusammenschlüsse zu definieren. Zunächst soll einleitend auf die Entstehungsgründe einer solchen Ganerbenburg eingegangen werden. Welches sind die Voraussetzungen innerhalb des Reiches und inwieweit verweisen sie auf die wirtschaftliche und soziale Lage des Adels im Spätmittelalter?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen einer Ganerbschaft
- 3. Der Niederadel als typischen Vertreter einer Ganerbschaft?
- 4. Die Ganerbschaft als Element der Ritterbundpolitik am Beispiel der Wetterauer Ganerbenverbände
- 5. Vom Eigenbesitz zum Lehen: eine verlustreiche Entwicklung?
- a) Das Selbständigkeitsstreben einer Ganerbenfamilie am Beispiel der Herren von Eltz
- b) Familienpolitik einer Ganerbschaft am Beispiel der von Hatzfeld und Schenken zu Schweinsberg: ein Erfolgsmodell?
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ganerbschaft als repräsentative Familienform des niederen Adels und der Ritterbünde im Spätmittelalter. Ziel ist es, die Vielfalt und Komplexität der Ganerbschaft anhand konkreter Beispiele zu verdeutlichen und ihre Bedeutung als typische Familienstruktur mittelalterlicher Zusammenschlüsse zu definieren. Die Arbeit beleuchtet die Entstehungsgründe, die Rolle des Niederadels, den Einfluss der Ritterbundpolitik und die Auswirkungen des Lehnswesens auf Ganerbschaften.
- Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen von Ganerbschaften im Kontext der spätmittelalterlichen Gesellschaft
- Der Niederadel als typischer Vertreter von Ganerbschaften und dessen Entwicklung im Spätmittelalter
- Die Ganerbschaft als Element der Ritterbundpolitik und deren Auswirkungen auf den sozialen Aufstieg und Verfall der Mitglieder
- Der Einfluss des Lehnswesens auf Ganerbschaften: Machtgewinn oder -verlust?
- Die Ganerbschaft als spätmittelalterliche Familienform und deren Strategien zur Festigung der sozialen Stellung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Ganerbschaft ein und beschreibt die bisherige Forschungslage, welche als spärlich und thematisch überschneidend bezeichnet wird. Die Arbeit fokussiert auf die Ganerbschaft als repräsentative Familienform des spätmittelalterlichen Adels und untersucht deren Bedeutung im Kontext von Niederadel, Ritterbünden und Lehnswesen. Sie benennt die zentralen Forschungsfragen und den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf der Analyse konkreter Beispiele beruht.
2. Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen einer Ganerbschaft: Dieses Kapitel analysiert die Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen von Ganerbschaften im Spätmittelalter. Es wird die zunehmende Verbreitung von Burgen ab der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts im Kontext des königlichen Befestigungsmonopols und des Investiturstreits beleuchtet. Die Arbeit untersucht die Rolle der politischen Instabilität, der territorialen Zersplitterung und der Agrarkrise bei der Entstehung von Ganerbschaften als Schutzstrategie und Mittel zur Erhaltung von Macht und Besitz. Der Fokus liegt dabei auf dem Motiv des Selbsterhalts und des Zusammenhalts in unsicheren Zeiten.
3. Der Niederadel als typischen Vertreter einer Ganerbschaft?: Kapitel 3 befasst sich mit der Frage, inwieweit der Niederadel als typischer Vertreter einer Ganerbschaft angesehen werden kann. Es wird die enorme Bandbreite an Familienformen innerhalb des mittelalterlichen Adels diskutiert und die Unterscheidung zwischen Familienganerbschaften und ritterschaftlichen Ganerbschaften herausgestellt. Dieses Kapitel legt den Grundstein für die spätere Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Strategien der Ganerbenfamilien in Bezug auf Macht und Besitz.
4. Die Ganerbschaft als Element der Ritterbundpolitik am Beispiel der Wetterauer Ganerbenverbände: Dieses Kapitel analysiert die Ganerbschaft im Kontext der Ritterbundpolitik, wobei die Wetterauer Ganerbenverbände als Beispiel dienen. Es untersucht, ob die Institution der Ganerbschaft durch Ritter- und Adelsbünde gefördert wurde oder umgekehrt, ob die Ritterbundpolitik den sozialen Abstieg ihrer Mitglieder und das Ende von Ganerbschaften verzögert hat. Die gute Quellenlage der Wetterauer Verbände ermöglicht eine detaillierte Analyse dieser komplexen Interaktion.
5. Vom Eigenbesitz zum Lehen: eine verlustreiche Entwicklung?: Kapitel 5 untersucht die Auswirkungen des Lehnswesens auf Ganerbschaften. Anhand der Beispiele der Herren von Eltz und der Familien von Hatzfeld und Schenken zu Schweinsberg werden die unterschiedlichen Strategien von Ganerbenfamilien bei der Bewältigung des Übergangs vom Eigenbesitz zum Lehen analysiert. Es wird untersucht, ob und wie diese Familien den Verlust des Allodialbesitzes für sich nutzten und welche Folgen die Lehnsabhängigkeit für sie hatte.
Schlüsselwörter
Ganerbschaft, Spätmittelalter, Niederadel, Ritterbünde, Lehnswesen, Familienpolitik, Burgen, Territorialherrschaft, Allodialbesitz, Wetterauer Ganerbenverbände, Herren von Eltz, von Hatzfeld, Schenken zu Schweinsberg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Ganerbschaften im Spätmittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ganerbschaft als eine charakteristische Familienform des niederen Adels und der Ritterbünde im Spätmittelalter. Sie analysiert die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung von Ganerbschaften im Kontext von gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der Ganerbschaft, darunter die Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen, die Rolle des Niederadels, den Einfluss der Ritterbundpolitik, die Auswirkungen des Lehnswesens und die Strategien von Ganerbenfamilien zur Erhaltung ihrer sozialen Stellung. Konkrete Beispiele wie die Wetterauer Ganerbenverbände, die Herren von Eltz, die von Hatzfeld und die Schenken zu Schweinsberg werden analysiert.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Ganerbschaften entstanden und sich entwickelten, welche Rolle der Niederadel in diesem Kontext spielte, wie Ganerbschaften von der Ritterbundpolitik beeinflusst wurden und welche Folgen der Übergang vom Eigenbesitz zum Lehen für Ganerbschaften hatte. Sie fragt auch nach den Strategien von Ganerbenfamilien zur Sicherung ihrer Macht und ihres Besitzes.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse konkreter Beispiele und nutzt historische Quellen, um die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung von Ganerbschaften zu rekonstruieren. Der methodische Ansatz ist auf eine detaillierte Untersuchung ausgewählter Fallstudien ausgerichtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen einer Ganerbschaft, Der Niederadel als typischer Vertreter einer Ganerbschaft?, Die Ganerbschaft als Element der Ritterbundpolitik am Beispiel der Wetterauer Ganerbenverbände, Vom Eigenbesitz zum Lehen: eine verlustreiche Entwicklung? und Schlussbetrachtung.
Welche Beispiele werden untersucht?
Die Arbeit analysiert exemplarisch die Wetterauer Ganerbenverbände sowie die Familien der Herren von Eltz, der von Hatzfeld und der Schenken zu Schweinsberg, um die Vielfalt und Komplexität von Ganerbschaften zu veranschaulichen und deren Strategien im Umgang mit den Herausforderungen des Spätmittelalters zu beleuchten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die Schlussfolgerungen sind nicht explizit im Inhaltsverzeichnis aufgeführt und müssten aus der vollständigen Arbeit entnommen werden. Der FAQ gibt jedoch einen guten Überblick über die behandelten Themen und die Forschungsfragen der Arbeit.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Ganerbschaft, Spätmittelalter, Niederadel, Ritterbünde, Lehnswesen, Familienpolitik, Burgen, Territorialherrschaft, Allodialbesitz, Wetterauer Ganerbenverbände, Herren von Eltz, von Hatzfeld, Schenken zu Schweinsberg.
- Citation du texte
- Jacqueline Turpel (Auteur), 2009, Die Ganerbschaft - Produkt einer typisch spätmittelalterlichen Familienpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165801