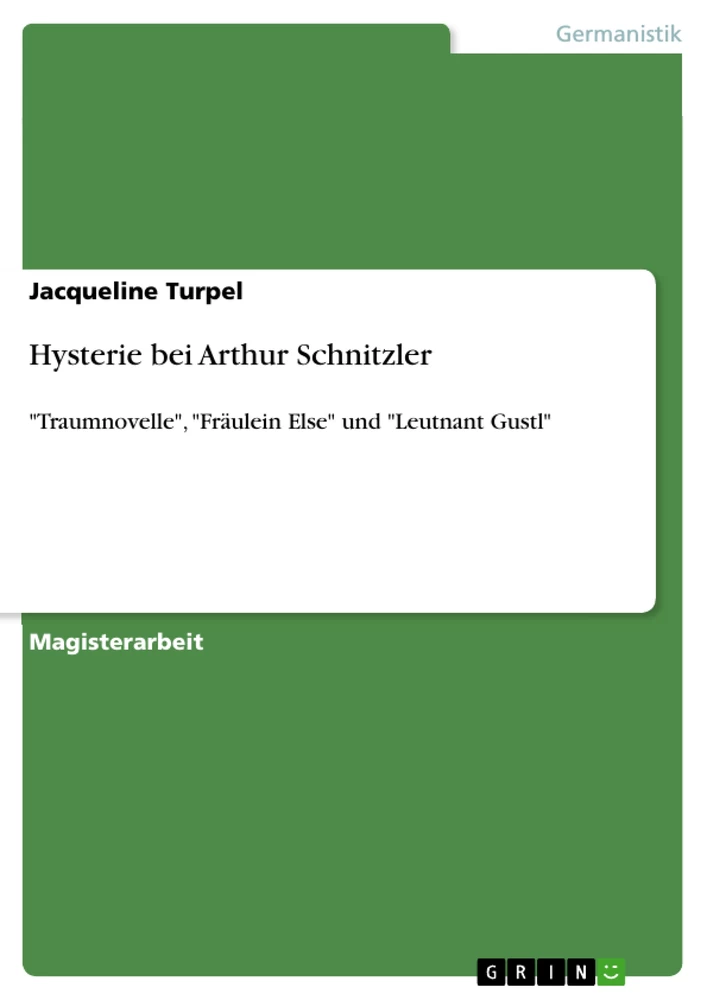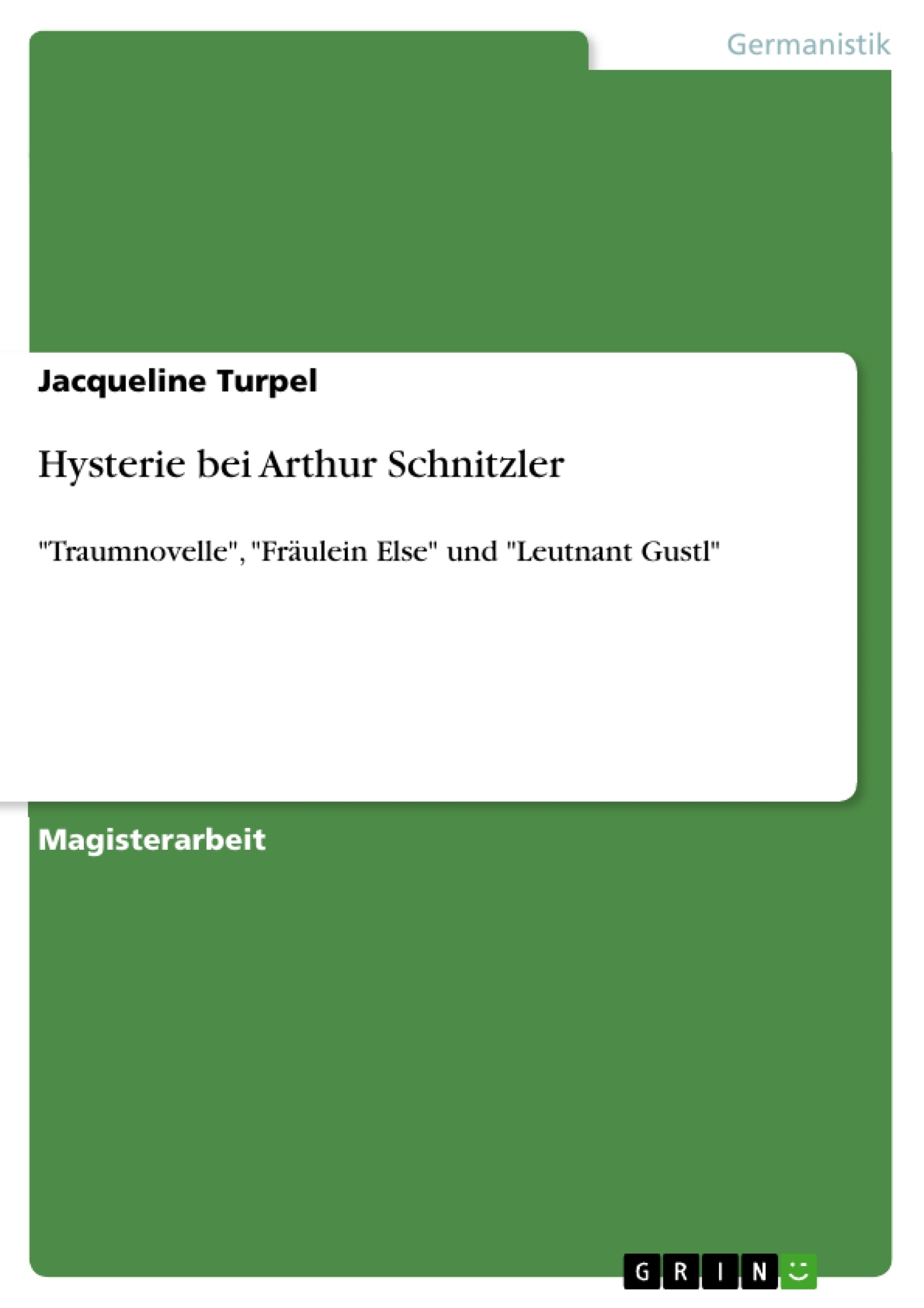Das Milieu der Wiener Jahrhundertwende, mit seinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen, seinem Wechsel von den statisch traditionellen Rollenverhältnissen einer Monarchie zu denen einer modernen Republik sowie seinen zahlreichen Umbrüchen und Konflikten als Folge der sich allmählich verändernden Gesellschaftsordnung, verursacht eine allgemeine Verunsicherung „des modernen Subjekts“ . Nicht nur durch politische und soziale Konflikte fühlt sich das moderne Ich aus seinen bisherigen Schranken herausgerissen, auch eine „geistesgeschichtliche Umbruchphase“ bringt Neuerungen in Medizin, Literatur und Kunst mit sich, welche die Menschen in dieser krisenhaften Atmosphäre beeinflussen. Kaum ein Dichter verkörpert diese nervöse und hektische Zeit voller „Aufbrüche und Durchbrüche“ besser als Arthur Schnitzler, dem es als Zeitgenossen all jener Änderungen im sozialen, politischen, kulturellen und technischen Bereich gelingt, diese Grundstimmung in seinen Werken einzufangen und literarisch zu verdichten. Der Schwerpunkt seiner Werke liegt in dem Zusammenleben zwischen Mann und Frau unter den Bedingungen sich verändernder traditioneller Geschlechterverhältnisse. Unumgänglich ist deshalb seine Beschäftigung mit dem Epochenphänomen schlechthin: der Nervosität, deren Aufkommen, wie in dieser Arbeit zu beweisen sein wird, eng verknüpft ist mit den Emanzipationsbestrebungen beider Geschlechter aus ihren festgefügten Rollen innerhalb der Gesellschaft. Nicht erst mit Breuers und Freuds „Studien über Hysterie“ rückt ein weiteres Spezifikum der Zeit in den Fokus der Öffentlichkeit: die Hysterie. Sie steht für all das, was das Fin de Siècle verkörpert: Lug und Trug, Schein und Fassadenhaftigkeit, Schwäche und Krankheit, Lethargie und gescheiterte Existenzen. Als Autor seiner Zeit nimmt Schnitzler den Epochendiskurs auf und nutzt ihn, um in seinen Werken eine Gesamtdarstellung der Gesellschaft auszuarbeiten, indem er ihr einen zeitgemäßen Rahmen und Hintergrund gibt. Da Schnitzlers Vielseitigkeit allein schon durch die Tatsache, dass er Arzt und Dichter zugleich war und in diesen beiden Disziplinen bis zu seinem Tod aktiv blieb, unumstritten sein dürfte, muss auch in der vorliegenden Arbeit eine klare Eingrenzung und Herangehensweise sowohl in Bezug auf die ausgewählte Thematik als auch auf die zu bearbeitenden Werke festgelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Forschungslage.
- 3. Le mal du siècle: Die nervöse Epoche
- 3.1. Kurze Einführung in die Geschichte der Hysterie........
- 3.2. Hysterie um 1900: Eine Modekrankheit?..\n
- 3.3. Beziehung zwischen Literatur und Psychologie: Schnitzler und Freud..\n
- 4. Sehen und Gesehen-Werden.......
- 4.1. Der männliche Blick
- 4.1.1. Die „,,schöne Leiche“: Die Frau als männliches Kunstprodukt...\n
- 4.1.1.1 ,,Ich habe noch nie einen so schönen Körper gesehen.“\nVoyeurismus bei Fräulein Else ........\n
- 4.1.1.2. Die „,schöne Unbekannte“: Die Frau als männliches Blickobjekt ...
- 4.2. La grande simulatrice
- 4.2.1. Hysterie als wahre Lüge: Inszenierung und Schauspiel …….….….….….….….….….….….….….….….….\n
- 4.2.2 Theater, Karneval und Masken: Rollenwechsel als\nSymptom der Hysterie.........\n
- 4.2.2.1. Else: Dirne oder Luder..\n
- 4.2.2.2.\nAlbertine: Heilige oder Hure.
- 4.3. Fräulein Else und das Spiegelbild: Identitätssuche und Selbsterkenntnis....
- 4.1. Der männliche Blick
- 5. Der soziale Tod: Hysterie als Sozialkritik...\n
- 5.1. „Du willst wirklich nicht mehr weiterspielen, Else?\"\nElses Selbstauslöschung: Ein Scheitern an der Gesellschaft.
- 5.2.\nMarianne und Anna O...
- 6. Männliche Hysterie und Geschlechterwandel
- 6.1.,,Hast du Courage?“.\n\"\n
- 6.1.1. Was gehen mich denn die anderen Leute an?“ Öffentlichkeit und\nAnonymität bei Leutnant Gustl.
- 6.1.2. Fridolins hysterische Nachtwanderung.
- 7. Sprache und Sprachverlust: Die stumme Sprache der Hysterie.
- 7.1. Der innere Monolog: Eine „literarische Psychoanalyse“? – Elses,,soziale\nSprachlosigkeit“ und Gustls erzwungenes Redeverbot.…......\n
- 8. Die Zeitkritik Schnitzlers im Hinblick auf den Hysteriediskurs:\nRebellion und Emanzipation\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Thematik der Hysterie im Werk Arthur Schnitzlers und analysiert, wie er die sozialen und psychischen Umbrüche der Wiener Jahrhundertwende in seinen Werken verarbeitet.
- Hysterie als Ausdruck der "nervösen Epoche" um 1900
- Die Rolle der Psychoanalyse im Werk Schnitzlers
- Die Darstellung von Geschlechterrollen und -konflikten im Kontext von Hysterie
- Sprache und Sprachlosigkeit als Symptome der Hysterie
- Schnitzlers Zeitkritik im Hinblick auf den Hysteriediskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert den historischen Kontext der Hysterie um die Jahrhundertwende. Sie beleuchtet die Bedeutung von Schnitzlers Werk im Hinblick auf die Zeitumstände und die Relevanz der Hysterie als Epochenphänomen.
Kapitel 3 widmet sich der historischen Entwicklung der Hysterie von der Antike bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf das Krankheitsbild und dessen Bedeutung für die Gesellschaft betrachtet, insbesondere im Kontext des späten 19. Jahrhunderts. Der Einfluss der sich entwickelnden Psychoanalyse auf das Verständnis von Hysterie und dessen Relevanz für Schnitzlers Werk werden ebenfalls diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die literarischen Figuren in Schnitzlers Werken im Hinblick auf die gängigen Merkmale der Hysterie. Dabei wird der Fokus auf den Blick und den Betrachteten sowie auf die Inszenierung von Weiblichkeit und Männlichkeit im Kontext von Hysterie gelegt. Es werden die Rollenspiele und Masken, die die Figuren tragen, sowie die Suche nach Identität und Selbsterkenntnis beleuchtet.
Kapitel 5 betrachtet die Hysterie als Symptom sozialer Konflikte und analysiert, wie Schnitzler in seinen Werken die gesellschaftlichen Bedingungen der Jahrhundertwende und ihre Auswirkungen auf das Individuum darstellt. Es werden die Themen Selbstauslöschung, Scheitern und soziale Isolation im Kontext von Hysterie untersucht.
Kapitel 6 befasst sich mit dem Thema der männlichen Hysterie und der sich verändernden Geschlechterrollen im späten 19. Jahrhundert. Es analysiert Schnitzlers Darstellung von männlichen Figuren und deren Umgang mit den Anforderungen der modernen Gesellschaft.
Kapitel 7 untersucht die Rolle der Sprache und Sprachlosigkeit in Schnitzlers Werken im Zusammenhang mit Hysterie. Es wird die Bedeutung des inneren Monologs als Ausdruck der inneren Konflikte der Figuren und ihre Schwierigkeiten, sich in der Gesellschaft zu artikulieren, betrachtet.
Kapitel 8 analysiert Schnitzlers Zeitkritik im Hinblick auf den Hysteriediskurs. Es wird beleuchtet, wie Schnitzler in seinen Werken die gesellschaftlichen und moralischen Normen der Zeit in Frage stellt und gleichzeitig das Potenzial für Rebellion und Emanzipation auslotet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Hysterie, des Fin de Siècle, der Psychoanalyse, Geschlechterrollen, Sprache und Sprachlosigkeit sowie der Zeitkritik Arthur Schnitzlers. Bedeutende Figuren in der Analyse sind Fräulein Else, Leutnant Gustl, Fridolin, Albertine und Marianne.
- Citation du texte
- Jacqueline Turpel (Auteur), 2010, Hysterie bei Arthur Schnitzler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165805