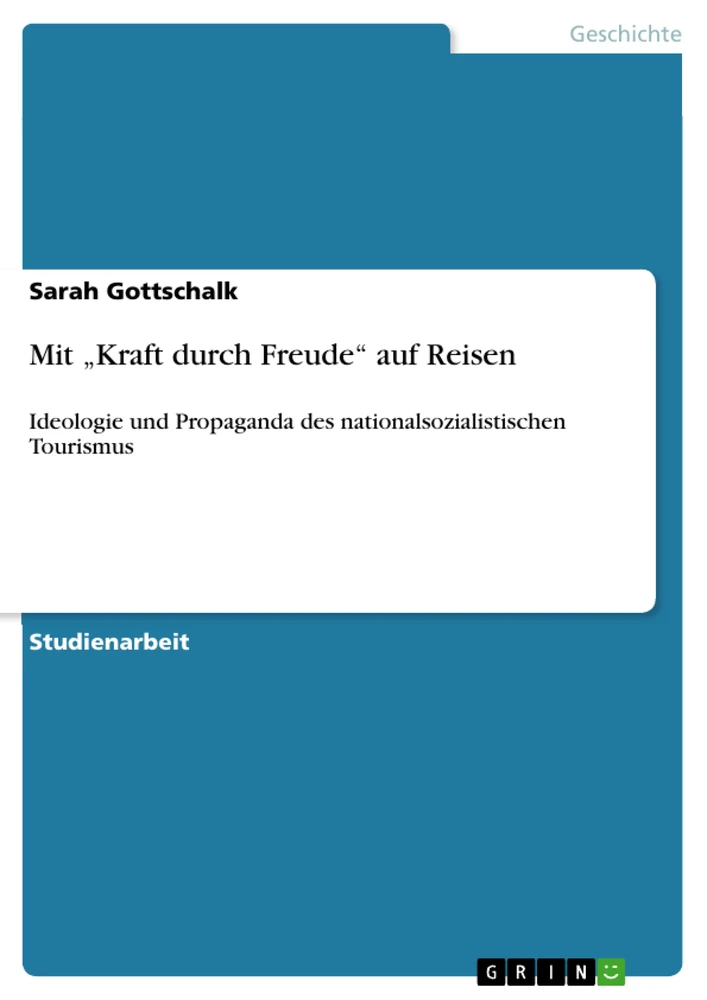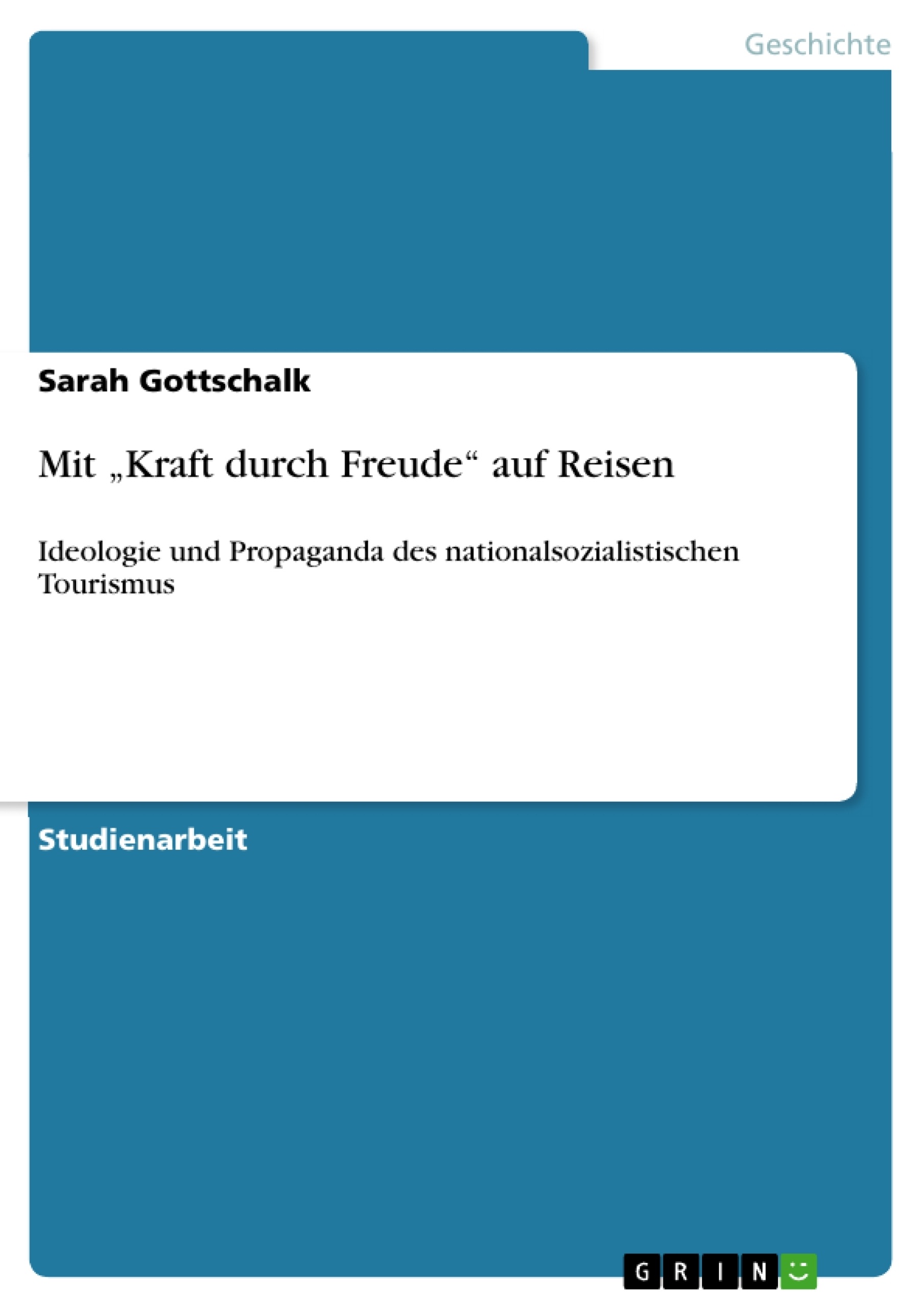Das Amt „Kraft durch Freude“ zählte zu den populärsten Organisationen im Nationalsozialismus, vor allem die vom Amt „Reisen, Wandern, Urlaub“ organisierten Reisen. Obwohl es sich bei circa vier Fünftel der Fahrten um Tagesausflüge und Wanderungen handelte und nur eine Minderheit von den prestigeträchtigen Hochseefahrten nach Madeira oder Italien profitierte, gelang es dem NS-Regime dank eines gigantischen Propagandaaufwands den Eindruck zu erzeugen, dass „dank des Führers“ auch Arbeiter in den Genuss solch luxuriöser Freizeitgestaltung gekommen seien.
Tatsächlich wurden im „Dritten Reich“ die Urlaubsregelungen erweitert, insbesondere für Jugendliche. Allerdings spielte dabei die physische und psychische Regeneration im Hinblick auf die Aufrüstung die tragende Rolle. Im Zuge der Umstellung der Wirtschaft zur Kriegsvorbereitung waren Lohnerhöhungen ausgeschlossen. Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften sah sich die Deutsche Arbeitsfront (DAF) mit dem Dilemma konfrontiert, die Interessen der Arbeiter nicht vertreten zu können, diese aber gleichzeitig für das Regime begeistern zu müssen. Die Schaffung der Freizeitorganisation „Kraft durch Freude“ sollte diesen Konflikt lösen: Die „heimatlos“ gewordenen Arbeiter galt es in die rassistische „Volksgemeinschaft“ zu integrieren und dabei den Klassengedanken aufzulösen. Im Nationalsozialismus gebe es nur „Arbeiter der Stirn und der Faust“, mit bürgerlichen Privilegien wie dem Reisen werde gebrochen.
In dieser Seminararbeit werden die ideologischen Aspekte der NS-Urlaubspolitik untersucht. Der enorme Propagandaaufwand wird insbesondere bei den Hochseefahrten dargestellt und das Fotoalbum eines Reisenden analysiert. Daneben wird auch aus tourismuswissenschaftlicher Sicht die Frage diskutiert, ob es im „Dritten Reich“ zu einer „Demokratisierung des Reisens“ gekommen sei.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. EINFÜHRENDE ASPEKTE
- 1.1. REISEN VOR 1933
- 1.2. NS-URLAUBSPOLITIK
- 2. ARBEIT UND FREIZEIT IM „DRITTEN REICH“ – DIE INSTITUTIONEN
- 2.1. DIE,,DEUTSCHE ARBEITSFRONT“
- 2.2. DAS AMT „KRAFT DURCH FREUDE“
- 2.3. DAS AMT,,REISEN, WANDERN, URLAUB“
- 3. IDEOLOGISCHE ASPEKTE
- 3.1.,,VOLKSGEMEINSCHAFT“ STATT KLASSENKAMPF
- 3.2. DIE ILLUSION DER GLEICHHEIT: TOURISMUS ALS „SOZIALISMUS DER TAT“
- 4. SEEREISEN ALS MEISTERSTÜCKE DER NS-PROPAGANDA
- 4.1. KLASSENLOSIGKEIT UND LUXUS FÜR ALLE
- 4.2. HÖHEPUNKTE DER PROPAGANDA - ZEREMONIEN UND MEDIEN
- 4.3. AGITATION AN BORD? SELEKTION, ÜBERWACHUNG UND ERZIEHUNG
- 4.4.,,FLOTTE DES FRIEDENS“ AUSLANDSFAHRTEN ZWISCHEN DIPLOMATIE UND KriegsplänEN
- 5. GRENZEN DER „VOLKSGEMEINSCHAFT“ UND DAS ENDE VON KDF
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die staatlich organisierten Urlaubsreisen in den Jahren 1934 bis 1939, die unter dem Namen „NS-Gemeinschaft, Kraft durch Freude“ stattfanden. Im Vordergrund stehen die ideologischen Hintergründe des nationalsozialistischen Tourismus, insbesondere die Schaffung einer „Volks- und Leistungsgesellschaft“. Der Fokus liegt auf der propagandistischen Dimension der Hochseefahrten, die als Aushängeschild des Nationalsozialismus fungierten und die Grenzen der „Volksgemeinschaft“ offenbarten.
- Die Rolle des Tourismus in der nationalsozialistischen Ideologie der „Volksgemeinschaft“
- Die propagandistische Nutzung des Tourismus zur Erzeugung einer „Leistungsgesellschaft“
- Die Inszenierung von Klassenlosigkeit und sozialem Aufstieg durch staatlich organisierte Reisen
- Die Funktion von KdF-Reisen als Mittel der politischen Indoktrination und Überwachung
- Die außenpolitischen und militärischen Dimensionen der Hochseefahrten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel skizziert die Veränderungen im Tourismus durch das nationalsozialistische Regime, beginnend mit einem kurzen Abriss über das Reisen vor 1933. Anschließend werden die Urlaubspolitik der NSDAP sowie die Funktionen der Institutionen „Deutsche Arbeitsfront“ und „Kraft durch Freude“ dargestellt.
Im dritten Kapitel werden die ideologischen Aspekte des NS-Tourismus analysiert, wobei der Fokus auf der Bedeutung der „Volksgemeinschaft“ als Leistungsgesellschaft liegt. Die Integration der Arbeiterschaft in diese „Volksgemeinschaft“ mithilfe des staatlichen Tourismus wird untersucht.
Das vierte Kapitel widmet sich den Hochseefahrten als Aushängeschild des Amtes „Kraft durch Freude“. Die Propaganda, die Agitation an Bord, die soziale Zusammensetzung der Reisenden, die politische Selektion und Überwachung sowie die außenpolitischen und militärischen Aspekte der Auslandsfahrten werden analysiert.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Tourismus, „Kraft durch Freude“, „Volksgemeinschaft“, Propaganda, Leistungsgesellschaft, Hochseefahrten, Klassenlosigkeit, politische Indoktrination, Überwachung, Außenpolitik, Militär, Reisepolitik, Urlaubspolitik, Ideologie, Sozialgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Was war die Funktion der NS-Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF)?
KdF sollte die Freizeit der Arbeiter organisieren, um sie in die rassistische „Volksgemeinschaft“ zu integrieren, den Klassengedanken aufzulösen und die Arbeitskraft für die Aufrüstung zu regenerieren.
Gab es im Dritten Reich wirklich eine „Demokratisierung des Reisens“?
Obwohl die Propaganda den Eindruck von Luxus für alle erweckte, profitierte nur eine Minderheit von Hochseefahrten; vier Fünftel der KdF-Aktivitäten waren einfache Tagesausflüge und Wanderungen.
Wie wurden KdF-Seereisen propagandistisch genutzt?
Die Reisen dienten als Aushängeschild für den „Sozialismus der Tat“ und sollten im In- und Ausland das Bild eines friedlichen, sozialen und modernen Deutschlands vermitteln.
Welche Rolle spielten Überwachung und Erziehung an Bord?
Die Reisenden wurden politisch selektiert und an Bord durch Agitation und Zeremonien im Sinne der NS-Ideologie geschult und überwacht.
Warum wurden Urlaubsregelungen für Jugendliche erweitert?
Die Erweiterung diente vor allem der physischen Ertüchtigung und psychischen Vorbereitung der Jugend auf künftige militärische Aufgaben im Rahmen der Kriegsvorbereitung.
- Arbeit zitieren
- Sarah Gottschalk (Autor:in), 2007, Mit „Kraft durch Freude“ auf Reisen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165873