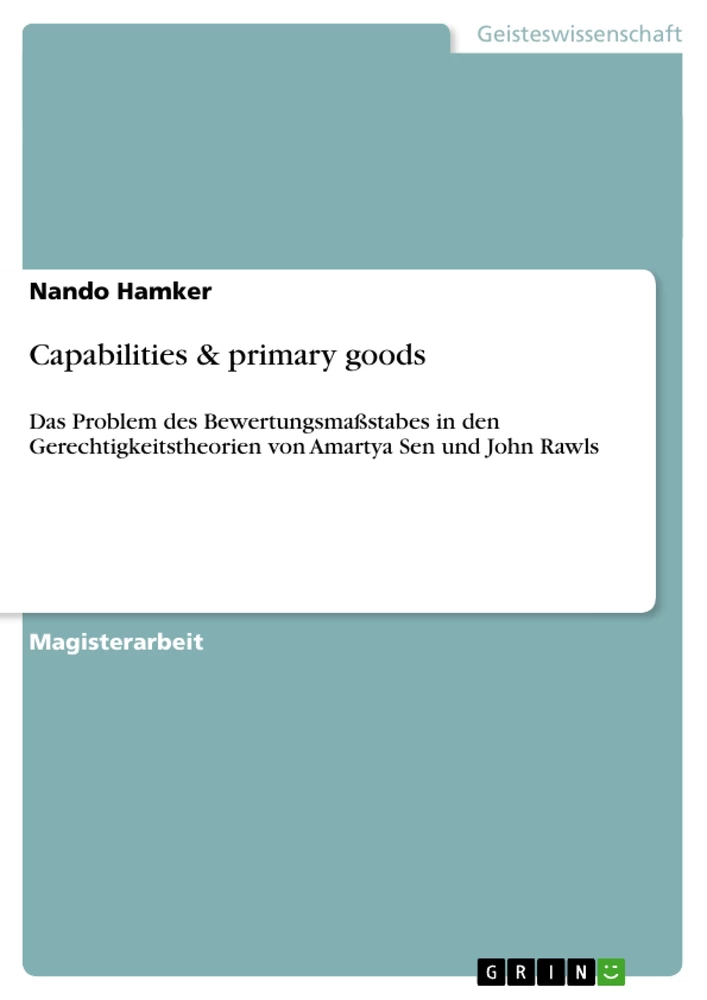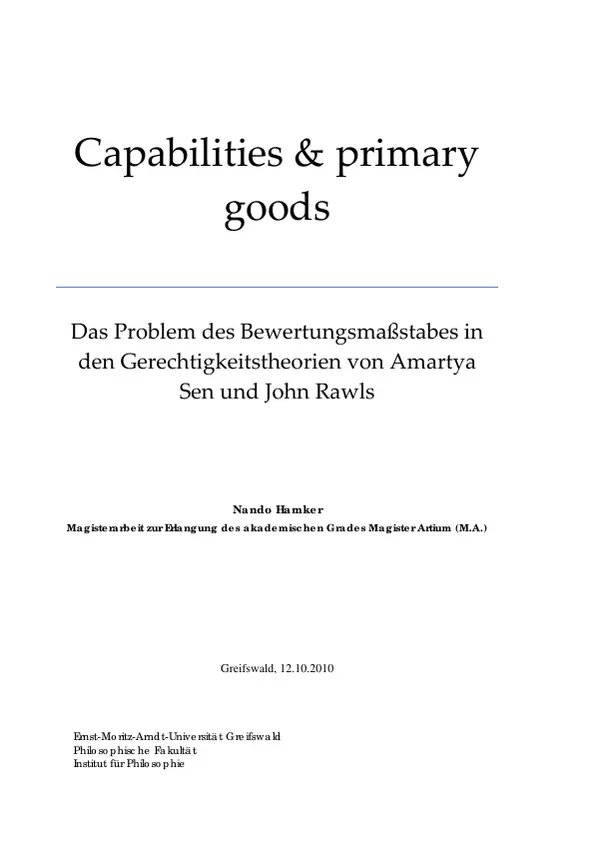Die Arbeit konzentriert sich in ihren Untersuchungen insbesondere auf zwei Gerechtigkeitsansätze: den Capability Ansatz Amartya Sens und die Theorie der Gerechtigkeit John Rawls’. Dabei werden speziell die unterschiedlichen Bewertungsperspektiven der beiden Ansätze in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt und der Frage nachgegangen, mit Hilfe wessen Bewertungsmaßstabes sich Ungerechtigkeiten am besten erfassen lassen und welche Auswirkungen beziehungsweise Probleme bei der Verwendung des jeweiligen Bewertungsmaßstabes entstehen.
Die Arbeit bezieht sich größtenteils auf den Perspektivaspekt der Bewertungsmaßstäbe, d.h. auf die Frage: Aus welcher Bewertungsperspektive heraus die jeweiligen Ansätze Ungerechtigkeiten ermitteln und bewerten; und darauf aufbauend, was sich aus der jeweiligen Perspektivimplementierung für Konsequenzen hinsichtlich eines möglichen Kompensationsmodells ergeben.
Eine zentrale Rolle innerhalb der Perspektivdiskussion wird dabei die Frage nach dem Umgang mit menschlichen Diversitäten und im Speziellen, dem Umgang mit Behinderten einnehmen.
Diese Aspekt wird in der Wissenschaft bereits diskutiert, wobei die meisten Texte eindeutig Stellung beziehen entweder zu der Theorie der Gerechtigkeit Rawls’ oder zum Capability Ansatz. Häufig werden dabei speziell die Bewertungsmaßstäbe, auf der einen Seite den der Primärgüter und auf der anderen Seite der Bewertungsmaßstab der Verwirklichungschancen, als sich gegenseitig ausschließende Alternativen diskutiert. Dieses Vorgehen wird in Kapitel 4 und Kapitel 5 am Essay Pogges „Can The Capability Approach be Justified?“ demonstriert.
Die vorliegende Arbeit wird in ihren Betrachtungen in eine andere Richtung gehen, indem sie die Möglichkeiten untersucht, wie sich die jeweiligen Bewertungsmaßstäbe sowie weitere Theorieelemente sinnvoll ergänzen lassen. Es wird die These vertreten, dass der Bewertungsmaßstab der Primärgüter und die Perspektive der Verwirklichungschancen sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern einander sogar bedingen.
Die Arbeit wird zu der Schlussfolgerung kommen, dass eine Metrik der Primärgüter im Sinne von Standardpaketen nicht ausreichend ist für einen gerechten Bewertungsmaßstab; eine alleinige Fokussierung auf Verwirklichungschancen aber genauso wenig hinreichend ist, um den vollen Umfang des Begriffs Gerechtigkeit bezüglich seiner Anwendung zu erfassen. Folglich wird in Kapitel 9 die Möglichkeit einer Ergänzung beider Ansätze behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt und Thesen der Arbeit – Ein Überblick
- Die Gerechtigkeitstheorie John Rawls' und der Capability Ansatz.
- Rawls Theorie der Gerechtigkeit als Fairness.....
- Der Rahmen der Theorie und die Grenzen des eigenen Gerechtigkeitsbegriffs ...
- Der Rahmen bei John Rawls
- Grundwerte und die zwei Gerechtigkeitsprinzipien.
- Der Urzustand und der Schleier des Nichtwissens..
- Der Bewertungsmaßstab und das Diversitätenproblem
- Amartya Sen, The Idea of Justice & der Capability Ansatz.
- Capability Ansatz versus Theorie der Gerechtigkeit...
- Can The Capability Approach be Justified?..
- Extern bedingte Diversitäten.
- Distribution within the family: die Verteilung innerhalb der Familie..
- Differences in relational perspectives: Unterschiede in den Perspektiven von Personen in diversen Gesellschaftskreisen......
- Variations in social climate: der soziale Kontext in der sich eine Person befindet....
- Environmental diversities: Unterschiede im Lebensraum einer Person.
- Menschliche Diversitäten..
- Ex post Inklusion menschlicher Diversitäten.
- Horizontale versus vertikale Sichtweise und der reale Nachteil von Behinderungen.....
- Angeborene Diversitäten.
- Pogges Inselbeispiel
- Das Operationalisierungsproblem und die vermeintliche Notwendigkeit der Einfachheit....
- Die Frage der Notwendigkeit der Berücksichtigung individueller Parameter Nussbaums Liste von grundlegenden Verwirklichungschancen und Sens Unterscheidung der Freiheit.....
- Die Notwendigkeit einer komplexen Sensitivität des Bewertungsmaßstabes.......
- Synthetischer Ansatz..
- Behinderungen in Deutschland
- Abschließende Bemerkungen....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Gerechtigkeitsansätzen von John Rawls und Amartya Sen und analysiert, mit Hilfe wessen Bewertungsmaßstabes sich Ungerechtigkeiten am besten erfassen lassen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die unterschiedlichen Bewertungsperspektiven der beiden Ansätze und untersucht die Auswirkungen und Probleme, die bei der Verwendung des jeweiligen Bewertungsmaßstabes entstehen.
- Der Bewertungsmaßstab als entscheidendes Kriterium für die Umsetzung von Gerechtigkeitsbestrebungen.
- Die unterschiedlichen Bewertungsperspektiven des Capability Ansatzes und der Theorie der Gerechtigkeit.
- Die Frage nach der optimalen Erfassung von Ungerechtigkeiten anhand verschiedener Bewertungsmaßstäbe.
- Die Auswirkungen und Probleme der Anwendung verschiedener Bewertungsmaßstäbe.
- Die Notwendigkeit einer komplexen Sensitivität des Bewertungsmaßstabes, um der Diversität menschlicher Bedürfnisse gerecht zu werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer einleitenden beispielhaften Darstellung, die die Bedeutung eines Bewertungsmaßstabes für die Erkennung und Behebung von Ungerechtigkeiten verdeutlicht. Im Anschluss wird die Arbeit selbst vorgestellt und ihr Fokus auf die Gerechtigkeitsansätze von Rawls und Sen sowie deren Bewertungsperspektiven beschrieben.
Die nächsten Kapitel befassen sich mit der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls, wobei seine Grundwerte, Gerechtigkeitsprinzipien und der Urzustand mit dem Schleier des Nichtwissens vorgestellt werden. Im Mittelpunkt steht dabei der Frage nach dem Bewertungsmaßstab, der die Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft beurteilt.
Anschließend wird der Capability Ansatz von Amartya Sen und dessen Unterschied zur Rawlsschen Theorie beleuchtet. Die Kapitel behandeln den Capability Ansatz als Alternative zur klassischen Gerechtigkeitstheorie und beleuchten seine Vor- und Nachteile im Vergleich zu Rawls' Konzept.
Die folgenden Kapitel untersuchen die extern bedingten Diversitäten und beleuchten die Unterschiede in den Perspektiven von Menschen in verschiedenen Gesellschaftskreisen, die sich aus ihrer sozialen Umgebung, den Lebensbedingungen und der Familie ergeben. Diese Unterschiede werden im Hinblick auf den Capability Ansatz und dessen Berücksichtigung von externen Faktoren analysiert.
Abschließend werden die menschlichen Diversitäten, insbesondere Behinderungen, und deren Einfluss auf die Gerechtigkeit diskutiert. Die Arbeit beleuchtet die Notwendigkeit einer komplexen Sensitivität des Bewertungsmaßstabes, um den individuellen Bedürfnissen und der Diversität der Menschen gerecht zu werden.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeitstheorien, Capability Ansatz, Amartya Sen, John Rawls, Bewertungsmaßstab, Diversitäten, soziale Ungleichheit, Behinderungen, menschliche Bedürfnisse, Gerechtigkeitsprinzipien, Urzustand, Schleier des Nichtwissens.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Capability Ansatz von Amartya Sen?
Dieser Ansatz (Befähigungsansatz) konzentriert sich auf die tatsächlichen Verwirklichungschancen eines Menschen, also darauf, was eine Person wirklich tun oder sein kann.
Wie unterscheidet sich Sen von John Rawls?
Rawls fokussiert auf die gerechte Verteilung von Primärgütern (Ressourcen), während Sen argumentiert, dass Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben, diese Ressourcen in Lebensqualität umzuwandeln.
Warum ist das Thema Behinderung zentral für diese Diskussion?
Menschen mit Behinderungen benötigen oft mehr Ressourcen, um das gleiche Maß an Verwirklichungschancen zu erreichen. Hier stößt die reine Güterverteilung nach Rawls an ihre Grenzen.
Was ist der "Schleier des Nichtwissens"?
Ein Gedankenexperiment von Rawls: Gerechtigkeitsprinzipien sollten so gewählt werden, als wüsste man nicht, welche Position (reich, arm, gesund, krank) man in der Gesellschaft einnehmen wird.
Können beide Ansätze kombiniert werden?
Die Arbeit vertritt die These, dass sich Primärgüter und Verwirklichungschancen gegenseitig bedingen und ein synthetischer Ansatz für eine umfassende Gerechtigkeit notwendig ist.
- Quote paper
- Nando Hamker (Author), 2010, Capabilities & primary goods, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165904