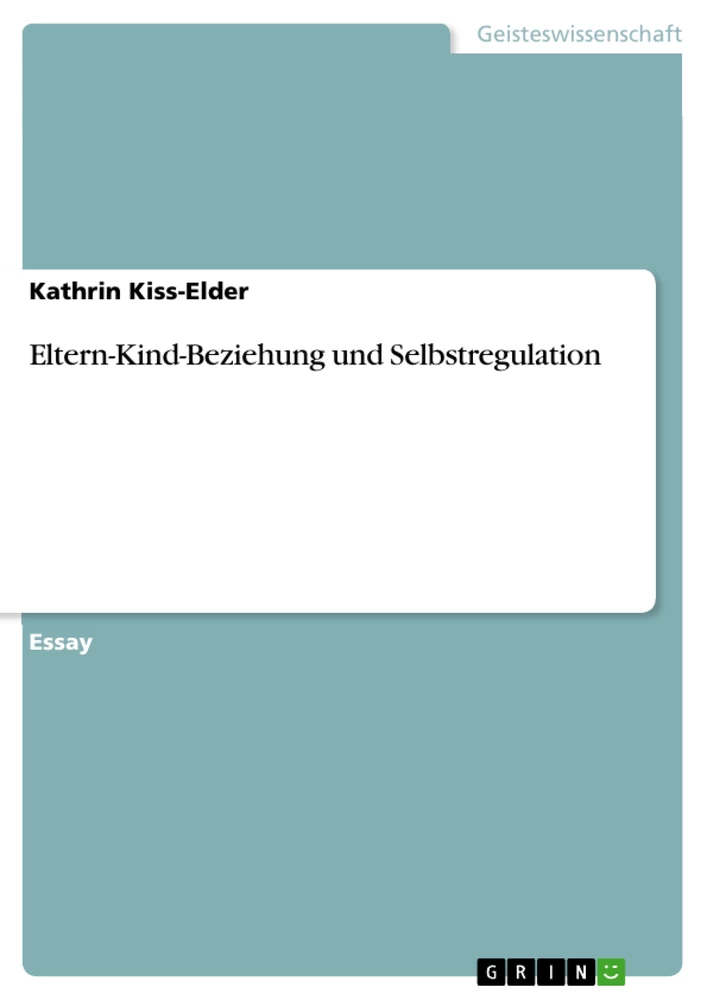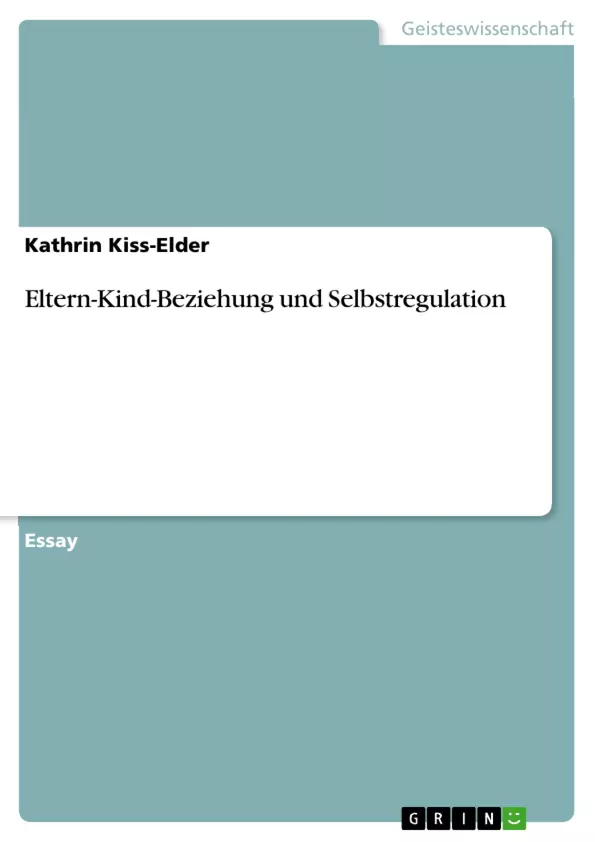Es ist – historisch gesehen – ein vergleichsweise neuer Blickwinkel, dass Säuglinge und übrigens auch Mütter als fühlende Wesen, um deren Entwicklung es sich zu kümmern gilt, wahrgenommen werden. Der Säugling als fühlendes Wesen – dieses Menschenbild hat dazu geführt, dass abseits vom bloßen physischen Überleben eines Säuglings, dessen Gesamtsituation in Blick geriet. Abseits des Allgemeinplatzes, dass Eltern bzw. Mütter – das Schwergewicht wird in allen mir bekannten Untersuchungen auf Mütter gelegt - „irgendwie“ für Kinder wichtig sind – und zwar abgesehen von ihrer Funktion als Ernährerin und Pflegerin – stellen sich folgende Fragen: Warum sind Mütter für die Kinder wichtig? Wie kann man Mütter ggf. dazu motivieren, stärker bzw. in einer anderen Qualität anwesend zu sein, da die dynamische Interaktion zwischen Mutter und Kind so gravierende, langfristige Auswirkungen auf die soziale und kognitive Entwicklung des Kindes zu haben scheint? Dazu stellt sich die Frage, wie Mütter auch unter erschwerten Umständen – einer erzwungenen Trennung durch Krankheit oder Berufstätigkeit oder auch vorhersehbaren Schmerzen wie Impfungen – ggf. zu „qualitativ hochwertiger Nähe“ mit ihren Kindern ermutigt werden können. Exemplarisch werde ich hier die Untersuchung von Eidelman et al referieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Grundhypothese
Hypothesen
Die Untersuchung von Eidelman et. al
Wirkungen mütterlicher Nähe
Diskussion: kritische Anmerkungen
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Dr. phil. Kathrin Kiss-Elder (Author), 2007, Eltern-Kind-Beziehung und Selbstregulation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165934