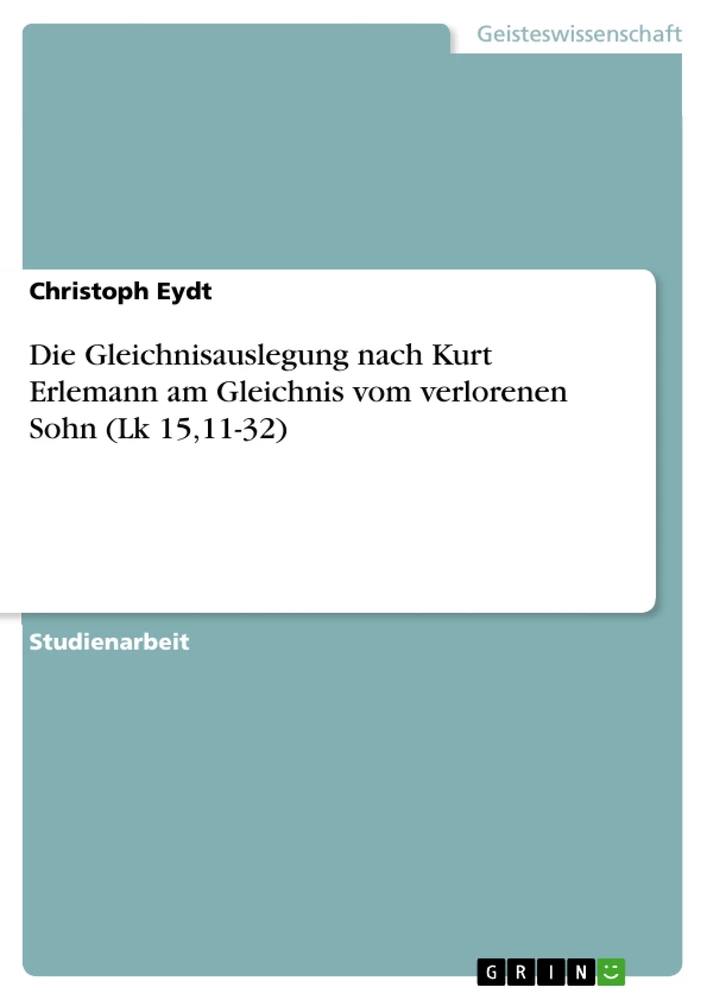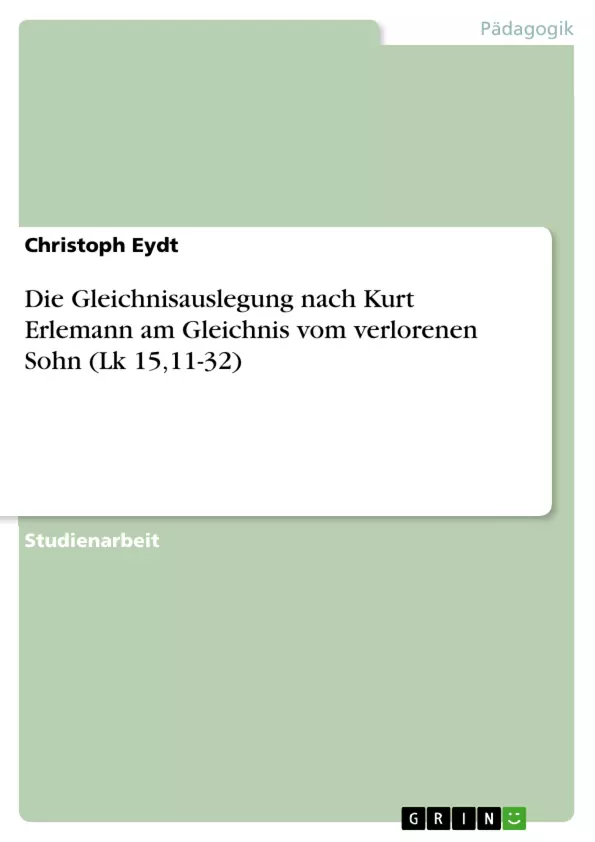Die Hausarbeit stellt eine Auslegung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn dar.
Als Orientierung dient hierbei die Exegese nach Kurt Erlemann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gattungsbestimmung
- 1.1 Bestimmung als gleichnishafte Gattung
- 2. Analyse des bildinternen Erzählgefälles
- 2.1 Strukturale und textlinguistische Analyse
- 2.2 Ermittlung der bildinternen Pointe
- 2.3 Bestimmung referenzieller Bildelemente
- 3. Rekonstruktion der Sprachkonventionen
- 3.1 Die Arbeit mit der Konkordanz
- 3.2 Vergleich von Texteinheiten
- 4. Erschließung des thematischen Bezugsrahmens
- 4.1 Analyse der Verzahnungen mit dem Kontext
- 4.2 Bestimmung von Situation und „Sache“
- 5. Erarbeitung der Textpragmatik
- 5.1 Analyse der kognitiven Steuerung
- 5.2 Analyse der emotionalen Steuerung
- 5.3 Das Spiel mit konkurrierenden Erfahrungen
- 5.4 Die kommunikative Intention eines Gleichnisses
- 6. Eigener Zugang zum Gleichnis / Ideen für gegenwärtige Bedeutung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Sohn nach der Methode von Kurt Erlemann. Ziel ist es, die gattungsspezifische Struktur, die Erzähltechnik und die thematischen Schwerpunkte des Gleichnisses herauszuarbeiten und dessen Bedeutung im Kontext der neutestamentlichen Erzähltradition zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachliche Gestaltung, die narrative Struktur und die pragmatischen Aspekte des Textes.
- Gattungsbestimmung des Gleichnisses
- Analyse der narrativen Struktur und des Erzählgefälles
- Ermittlung der Pointe des Gleichnisses
- Bestimmung referenzieller Bildelemente
- Erarbeitung der Textpragmatik und der kommunikativen Intention
Zusammenfassung der Kapitel
1. Gattungsbestimmung: Dieses Kapitel bestimmt die literarische Gattung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Es wird untersucht, ob es sich um ein Gleichnis handelt und wie es sich von anderen Gleichnissen im Kontext des Lukas-Evangeliums unterscheidet. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung der semantischen Ebenen und der Identifizierung der Bildebene innerhalb des Textes. Es werden verschiedene Kriterien herangezogen, um die Erzählstruktur und die spezifischen Merkmale des Gleichnisses zu belegen.
2. Analyse des bildinternen Erzählgefälles: Dieses Kapitel analysiert die Struktur und die sprachliche Gestaltung des Gleichnisses. Die Analyse konzentriert sich auf die Basisoppositionen, den Spannungsbogen der Erzählung, die verschiedenen Erzählphasen und den Einsatz von wörtlicher Rede. Es werden die Schwerpunkte der Erzählung identifiziert und die Pointe des Gleichnisses im Hinblick auf die Freude des Vaters und den Protest des älteren Sohnes herausgearbeitet. Die Verwendung von Tempuswechseln wird im Detail untersucht, um die narrative Wirkung zu verstehen.
3. Rekonstruktion der Sprachkonventionen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel, die im Gleichnis verwendet werden. Es untersucht die Arbeit mit der Konkordanz und den Vergleich von Texteinheiten. Diese Analyse soll die sprachlichen Konventionen beleuchten, die für das Verständnis des Gleichnisses relevant sind.
4. Erschließung des thematischen Bezugsrahmens: Dieses Kapitel untersucht den thematischen Kontext des Gleichnisses. Es analysiert die Verbindungen zu anderen Texten und beleuchtet die Bedeutung der dargestellten Situation. Der Fokus liegt auf der Identifizierung der zentralen Themen und ihrer Bedeutung innerhalb des gesamten Textes.
5. Erarbeitung der Textpragmatik: Dieses Kapitel untersucht die pragmatischen Aspekte des Gleichnisses. Es analysiert die kognitive und emotionale Steuerung des Textes und das Spiel mit konkurrierenden Erfahrungen. Der Fokus liegt auf der kommunikativen Intention des Gleichnisses und seiner Wirkung auf den Leser.
Schlüsselwörter
Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas-Evangelium, Kurt Erlemann, Gleichnisauslegung, Erzählanalyse, Textpragmatik, Sprachkonventionen, Basisoppositionen, Pointe, Kommunikative Intention, Thematische Schwerpunkte, Bildfeld, Erzählgefälle, Narrative Struktur.
Häufig gestellte Fragen zum Gleichnis vom verlorenen Sohn
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Gleichnis vom verlorenen Sohn nach der Methode von Kurt Erlemann. Sie untersucht die gattungsspezifische Struktur, die Erzähltechnik und die thematischen Schwerpunkte des Gleichnisses und beleuchtet dessen Bedeutung im Kontext der neutestamentlichen Erzähltradition. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachliche Gestaltung, die narrative Struktur und die pragmatischen Aspekte des Textes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Gattungsbestimmung; 2. Analyse des bildinternen Erzählgefälles; 3. Rekonstruktion der Sprachkonventionen; 4. Erschließung des thematischen Bezugsrahmens; 5. Erarbeitung der Textpragmatik; und 6. Eigener Zugang zum Gleichnis / Ideen für gegenwärtige Bedeutung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Analyse des Gleichnisses.
Wie wird das Gleichnis in dieser Arbeit analysiert?
Die Analyse folgt der Methode von Kurt Erlemann und beinhaltet eine detaillierte Untersuchung der gattungsspezifischen Merkmale des Gleichnisses, der narrativen Struktur (einschließlich des Erzählgefälles und der Pointe), der sprachlichen Mittel und Konventionen, des thematischen Kontextes und der pragmatischen Aspekte (kognitive und emotionale Steuerung, kommunikative Intention). Die Arbeit verwendet textlinguistische und strukturelle Analysen, Konkordanz und den Vergleich von Texteinheiten.
Was sind die zentralen Themen der Analyse?
Zentrale Themen sind die Gattungsbestimmung des Gleichnisses, die Analyse der narrativen Struktur und des Erzählgefälles, die Ermittlung der Pointe, die Bestimmung referenzieller Bildelemente, die Erarbeitung der Textpragmatik und der kommunikativen Intention. Die Arbeit beleuchtet die sprachliche Gestaltung, die narrative Wirkung und die Bedeutung des Gleichnisses im Kontext des Lukas-Evangeliums.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas-Evangelium, Kurt Erlemann, Gleichnisauslegung, Erzählanalyse, Textpragmatik, Sprachkonventionen, Basisoppositionen, Pointe, Kommunikative Intention, Thematische Schwerpunkte, Bildfeld, Erzählgefälle, Narrative Struktur.
Welche konkreten Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Methoden der Erzählanalyse, der Textpragmatik und der textlinguistischen Analyse. Konkret werden die Arbeit mit der Konkordanz, der Vergleich von Texteinheiten und die Analyse von Basisoppositionen, Spannungsbögen und Tempuswechseln eingesetzt, um die Struktur und Wirkung des Gleichnisses zu erforschen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die gattungsspezifische Struktur, die Erzähltechnik und die thematischen Schwerpunkte des Gleichnisses vom verlorenen Sohn herauszuarbeiten und dessen Bedeutung im Kontext der neutestamentlichen Erzähltradition zu beleuchten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Die Kapitel selbst gehen detailliert auf die verschiedenen Aspekte der Analyse ein.
- Quote paper
- Christoph Eydt (Author), 2007, Die Gleichnisauslegung nach Kurt Erlemann am Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165992