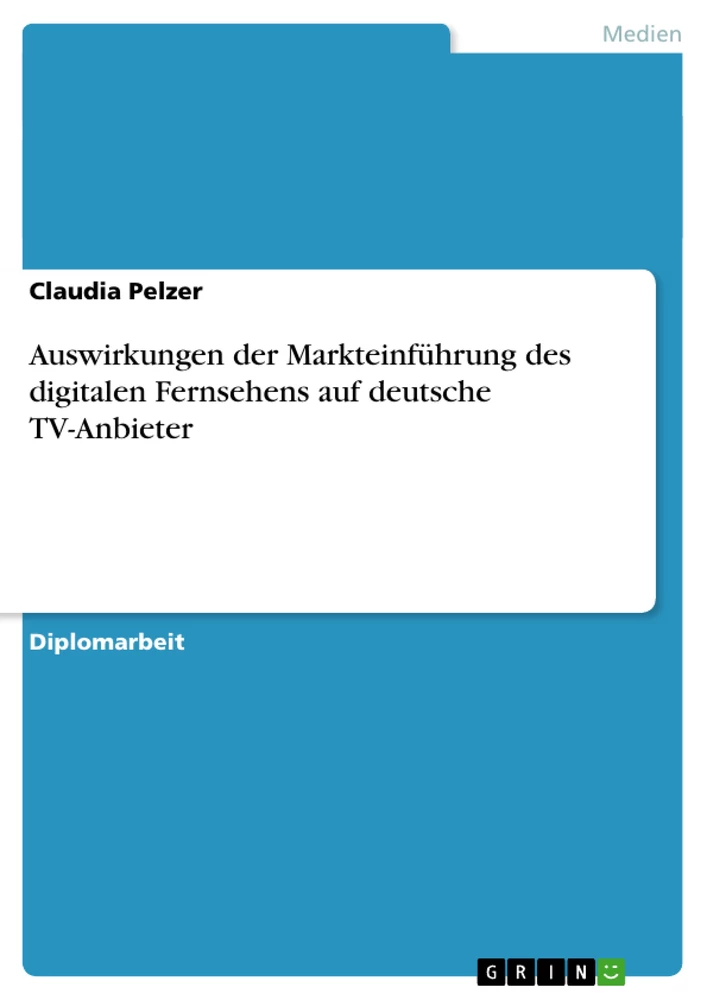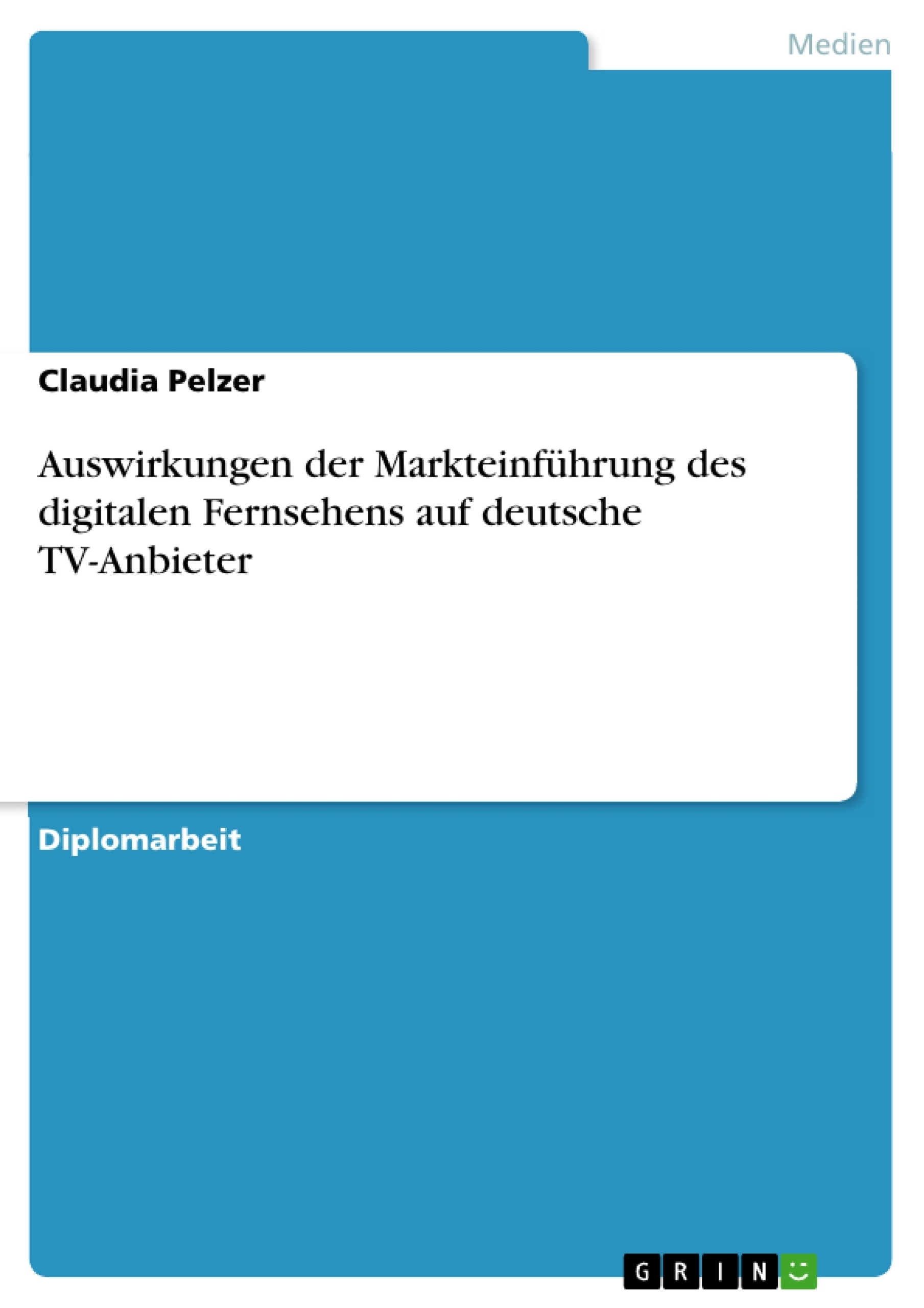Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit sind die komplexen Auswirkungen, die sich aus der Digitalisierung der TV-Übertragung ergeben. Neben den sinkenden Distributionskosten ist vor allem die Frequenzvervielfachung ein Grund für die sich ändernde Marktsituation. Das digitale Fernsehen senkt demnach die Markteintrittsbarrieren für neue Anbieter und erhöht den Konkurrenzdruck für die bereits bestehenden, wobei vor allem die Felder der Programmbeschaffung und –finanzierung betroffen sind. Sowohl die Wertschöpfungsketten als auch die Geschäftsmodelle der Branchenbeteiligten werden sich zukünftig verändern und auch die Konvergenz der Medien schreitet voran und wird in die Modelle mit einfließen. Neben den bestehenden Risiken bieten sich jedoch auch neue Chancen: Es wird ermöglicht, die Programme zu Bouquets zusammenzufassen, Navigationshilfen sowie programmbegleitende und ergänzende Zusatzdienste anzubieten. Bereits frühzeitig muss sich die Branche mit den Chancen und Risiken der Entwicklung auseinandersetzen. Nur auf diese Weise können Potentiale ausgeschöpft, kann Risiken entgegengewirkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Überblick
- 2 Ziele
- 3 Markteinführung und Marktdurchdringung des digitalen Fernsehens
- 3.1 Abgrenzung der Begrifflichkeiten
- 3.2 Digitales Fernsehen in der Retrospektive
- 3.3 Derzeitige Marktsituation in Deutschland
- 3.3.1 Die deutsche Rundfunklandschaft
- 3.3.2 Die Marktdurchdringung des digitalen Fernsehens
- 3.3.3 Aktuelles Angebotsspektrum an digitalen Bouquets
- 3.4 Internationaler Vergleich
- 3.5 Promotoren des digitalen Fernsehens
- 4 Technische Grundlagen des digitalen Fernsehens
- 4.1 Analog-Digitalwandlung
- 4.2 Datenreduktion
- 4.3 Multiplexing
- 4.4 Kanalcodierung
- 4.5 Distributionswege
- 4.5.1 DVB-S
- 4.5.2 DVB-C
- 4.5.3 DVB-T
- 4.5.4 Exkurs: Kosten-Nutzen-Profile der Distributionswege
- 4.5.5 Weitere Verbreitungswege
- 4.6 DVB-Standards
- 4.7 Verschlüsselung
- 4.8 Der Rückkanal
- 4.9 Navigation
- 4.10 Middleware und Decoder
- 4.10.1 Betanova (d-Box)
- 4.10.2 OpenTV / F.U.N
- 4.10.3 MHP
- 5 Auswirkungen auf deutsche TV-Anbieter
- 5.1 Veränderungen des Fernsehmarktes
- 5.1.1 Konvergenz
- 5.1.2 Veränderungen in der Wertschöpfungskette
- 5.2 Auswirkungen auf die Programmverbreitung
- 5.2.1 Exkurs: Die Rolle der Netzbetreiber
- 5.3 Auswirkungen auf die Programmbeschaffung
- 5.3.1 Exkurs: Digitalisierung auf Ebene der Programmproduktion
- 5.4 Auswirkungen auf die Programmveranstaltung
- 5.4.1 Fragmentierung der Zuschauerschaft und entsprechende Angebote
- 5.4.2 Entscheidungsfindung bei Erweiterungsoptionen der klassischen Angebotspalette
- 5.4.3 Das Entstehen neuer Nutzungs- und Vermarktungsformen
- 5.4.4 Akzeptanz neuer Angebotsformen seitens der Rezipienten
- 5.5 Auswirkungen auf die Programmfinanzierung
- 5.5.1 Auswirkungen des digitalen Fernsehens auf die Werbeinnahmen
- 5.5.2 Erlöse aus alternativen Werbeformen
- 5.5.3 Erlöse aus innovativen Werbeformen
- 5.5.4 Die Rechtslage für Werbeformen in Deutschland
- 5.5.5 Der Nutzen des digitalen Fernsehens als Werbeträger
- 5.5.6 Finanzierung der multimedialen Inhalte
- 5.5.7 Finanzierung durch T-Commerce
- 5.6 Auswirkungen auf die Zuschauerforschung
- 6 Handlungsoptionen für deutsche TV-Anbieter
- 6.1 Integrationsmodelle
- 6.2 Das Revenue-Sharing-Modell
- 6.3 Das Reselling-Modell
- 6.4 Dachmarken Strategie
- 6.5 Pay follows Free
- 6.6 Allgemein zu berücksichtigende Faktoren bei der Einführung neuer Angebotsformen
- 7 Resümee und Ausblick
- Anhang A: Rechtliche Grundlagen für das digitale Fernsehen
- A.1 Beschluss des Bundeskabinetts vom 24.08.1998
- A.2 Auszug aus dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV)
- Anhang B: Kurzinterviews
- Glossar
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den weitreichenden Folgen der Digitalisierung des Fernsehens für deutsche TV-Anbieter. Sie untersucht, wie sich die Marktdynamik durch die sinkenden Distributionskosten und die Frequenzvervielfachung verändert. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem wachsenden Wettbewerb und der Konvergenz der Medien ergeben.
- Einfluss der Digitalisierung auf den Fernsehmarkt
- Veränderungen in der Wertschöpfungskette des Fernsehens
- Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und -strategien
- Auswirkungen auf die Programmfinanzierung und Werbeformen
- Handlungsoptionen für deutsche TV-Anbieter im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 bietet einen allgemeinen Überblick über das Thema und stellt die Relevanz der Digitalisierung im Fernsehsektor heraus.
- Kapitel 2 definiert die Ziele und den Umfang der Arbeit.
- Kapitel 3 analysiert die Markteinführung und Marktdurchdringung des digitalen Fernsehens in Deutschland und im internationalen Vergleich.
- Kapitel 4 erläutert die technischen Grundlagen des digitalen Fernsehens, von der Analog-Digitalwandlung bis hin zu den Distributionswegen und Verschlüsselungstechniken.
- Kapitel 5 widmet sich den Auswirkungen des digitalen Fernsehens auf deutsche TV-Anbieter, mit Schwerpunkten auf den Veränderungen des Fernsehmarktes, der Programmverbreitung, der Programmbeschaffung, der Programmveranstaltung und der Programmfinanzierung.
- Kapitel 6 präsentiert Handlungsoptionen für deutsche TV-Anbieter, um sich im digitalen Umfeld zu behaupten und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind digitales Fernsehen, Digitalisierung, Konsequenzen, Interaktion, Konvergenz, Finanzierung, Wertschöpfungskette, Geschäftsmodelle, Programmbeschaffung, Programmveranstaltung, Werbeformen, Zuschauerforschung, Handlungsoptionen, TV-Anbieter.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf den TV-Markt?
Die Digitalisierung führt zu sinkenden Distributionskosten, einer Frequenzvervielfachung und damit zu niedrigeren Markteintrittsbarrieren für neue Anbieter.
Was sind DVB-S, DVB-C und DVB-T?
Dies sind die Standards für die digitale Übertragung via Satellit (S), Kabel (C) und terrestrischem Antennenfernsehen (T).
Wie verändert sich die Programmfinanzierung im digitalen Fernsehen?
Es entstehen neue Erlösquellen durch Pay-TV, T-Commerce und innovative Werbeformen, während klassische Werbeeinnahmen durch Fragmentierung unter Druck geraten.
Was bedeutet "Konvergenz der Medien" in diesem Kontext?
Es beschreibt das Zusammenwachsen von Rundfunk, Telekommunikation und Informatik, was neue Geschäftsmodelle und interaktive Dienste ermöglicht.
Welche Chancen bietet das digitale Fernsehen für Anbieter?
Anbieter können Programme zu Bouquets zusammenfassen, Navigationshilfen (EPG) und programmbegleitende Zusatzdienste anbieten.
- Quote paper
- Claudia Pelzer (Author), 2004, Auswirkungen der Markteinführung des digitalen Fernsehens auf deutsche TV-Anbieter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166013