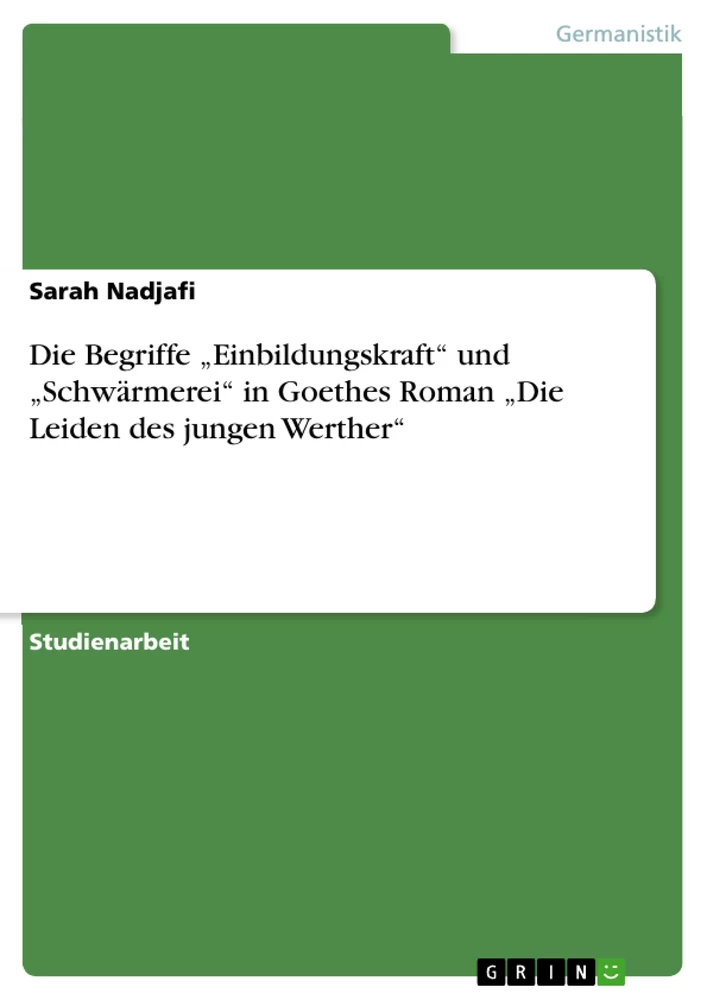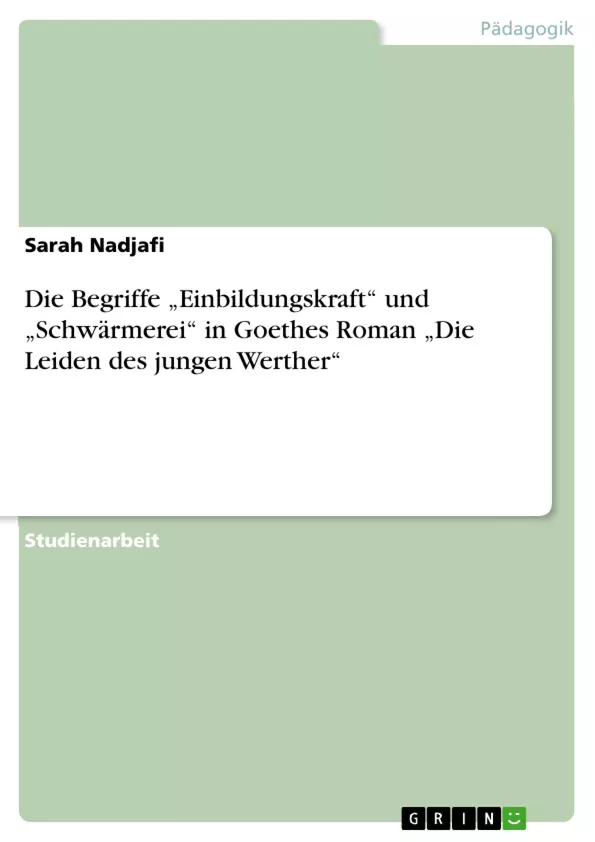Die folgende Arbeit geht von der Hypothese aus, dass Schwärmerei und Einbildungskraft in Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ als wesentliche anthropologische Merkmale angesehen werden.
Um dies zu belegen, wird zuerst ein Einblick in die Epoche des Sturm und Drang gegeben, aus der das Werk stammt. Insbesondere die Vorstellung vom Menschen zu dieser Zeit muss erörtert werden. In diesem Zusammenhang wird das Hauptaugenmerk darauf liegen, die Bedeutung der Begriffe „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ zu klären. Im folgenden Teil soll überprüft werden, inwiefern diese Begriffe Werther charakterisieren und ihn in seinem Denken und Fühlen bestimmen. Hierbei bilden die Briefe vom 10.Mai 1771 bis zum 26. Mai 1771 die Textgrundlage. In Anbetracht der Begrenzung dieser Arbeit kann nicht auf weitere Textstellen eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Begriffe Schwärmerei und Einbildungskraft im Sturm und Drang
- 3. Schwärmerei und Einbildungskraft in den Briefen vom 10. bis zum 26. Mai 1771
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Begriffe „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Sie analysiert, inwiefern diese Konzepte als anthropologische Merkmale Werthers und seiner emotionalen Welt verstanden werden können. Der Fokus liegt auf der Betrachtung des Werkes im Kontext des Sturm und Drang und der Klärung der jeweiligen Bedeutung der Begriffe in dieser Epoche.
- Die Bedeutung von „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ im Sturm und Drang
- Werthers emotionale Verfassung und die Rolle der Natur in seiner Wahrnehmung
- Die Darstellung von Gefühl und Subjektivität in Werthers Briefen
- Der Einfluss des Sturm und Drang auf die Gestaltung der Charaktere
- Analyse ausgewählter Briefe zur Illustration der zentralen Themen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor: Schwärmerei und Einbildungskraft sind wesentliche anthropologische Merkmale in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der darin besteht, zunächst die Begriffe im Kontext des Sturm und Drang zu beleuchten, um anschließend ihre Rolle in Werthers Briefen zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf den Briefen vom 10. bis 26. Mai 1771 aufgrund der begrenzten Länge der Arbeit.
2. Die Begriffe „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ zur Zeit des Sturm und Drang: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ innerhalb der literarischen und philosophischen Strömungen des Sturm und Drang. Es beleuchtet die Abkehr von der reinen Vernunft der Aufklärung hin zu einem neuen Menschenbild, das Gefühl und Subjektivität in den Vordergrund stellt. Die etymologische Entwicklung der Begriffe wird nachvollzogen und ihre Bedeutung im Kontext des Geniegedankens und der künstlerischen Kreativität diskutiert, wobei der Unterschiedliche Auffassungen Sulzers und Goethes zum Thema Einbildungskraft hervorgehoben wird.
3. Schwärmerei und Einbildungskraft in den Briefen vom 10. bis zum 26. Mai 1771: Dieser Abschnitt analysiert die ersten Briefe Werthers an Wilhelm, die vor seiner Begegnung mit Lotte geschrieben wurden. Der Fokus liegt auf der Beschreibung von Werthers intensiver Beziehung zur Natur, die als Ausdruck seiner Schwärmerei und Einbildungskraft interpretiert wird. Die Arbeit betont die zentrale Rolle von Gefühlen und der Naturerfahrung in Werthers Selbstverständnis. Die häufige Verwendung von Wörtern wie „Seele“ und „Herz“ unterstreicht die Bedeutung des emotionalen Erlebens und die Verbindung zur göttlichen Gegenwart in der Natur, wie im Zitat aus dem Brief vom 10. Mai deutlich wird.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werther, Johann Wolfgang von Goethe, Sturm und Drang, Schwärmerei, Einbildungskraft, Gefühl, Subjektivität, Natur, Genie, Anthropologie, Briefroman.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung der Begriffe „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ im Kontext des Sturm und Drang. Der Fokus liegt auf der Interpretation dieser Konzepte als anthropologische Merkmale Werthers und seiner emotionalen Welt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Bedeutung von „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ im Sturm und Drang, ein Kapitel zur Analyse dieser Begriffe in ausgewählten Briefen Werthers (10. bis 26. Mai 1771) und einen Schluss.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit untersucht zunächst die Begriffe „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ im Kontext des Sturm und Drang, um anschließend ihre Rolle in Werthers Briefen zu analysieren. Der methodische Ansatz beinhaltet die Betrachtung der literarischen und philosophischen Strömungen des Sturm und Drang sowie die etymologische Entwicklung der Begriffe.
Welche Briefe werden im Detail analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Briefe Werthers an Wilhelm vom 10. bis zum 26. Mai 1771. Diese Briefe wurden vor Werthers Begegnung mit Lotte verfasst und bieten Einblicke in seine intensive Beziehung zur Natur und seine emotionalen Zustände.
Welche Themen werden in der Analyse der Briefe behandelt?
Die Analyse der Briefe fokussiert auf Werthers intensive Beziehung zur Natur als Ausdruck seiner Schwärmerei und Einbildungskraft, die Rolle von Gefühlen und Naturerfahrung in seinem Selbstverständnis, die häufige Verwendung von Wörtern wie „Seele“ und „Herz“, und die Verbindung zur göttlichen Gegenwart in der Natur.
Wie werden „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ im Sturm und Drang verstanden?
Das Kapitel zum Sturm und Drang beleuchtet die Abkehr von der reinen Vernunft der Aufklärung hin zu einem neuen Menschenbild, das Gefühl und Subjektivität in den Vordergrund stellt. Die etymologische Entwicklung der Begriffe wird nachvollzogen und ihre Bedeutung im Kontext des Geniegedankens und der künstlerischen Kreativität diskutiert, wobei unterschiedliche Auffassungen (z.B. Sulzer und Goethe) zur Einbildungskraft hervorgehoben werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Die Leiden des jungen Werthers, Johann Wolfgang von Goethe, Sturm und Drang, Schwärmerei, Einbildungskraft, Gefühl, Subjektivität, Natur, Genie, Anthropologie, Briefroman.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass „Schwärmerei“ und „Einbildungskraft“ wesentliche anthropologische Merkmale in Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ sind.
Warum beschränkt sich die Analyse auf die Briefe vom 10. bis 26. Mai 1771?
Die Beschränkung auf diese Briefe ergibt sich aus der begrenzten Länge der Arbeit.
- Citar trabajo
- Sarah Nadjafi (Autor), 2009, Die Begriffe „Einbildungskraft“ und „Schwärmerei“ in Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166031