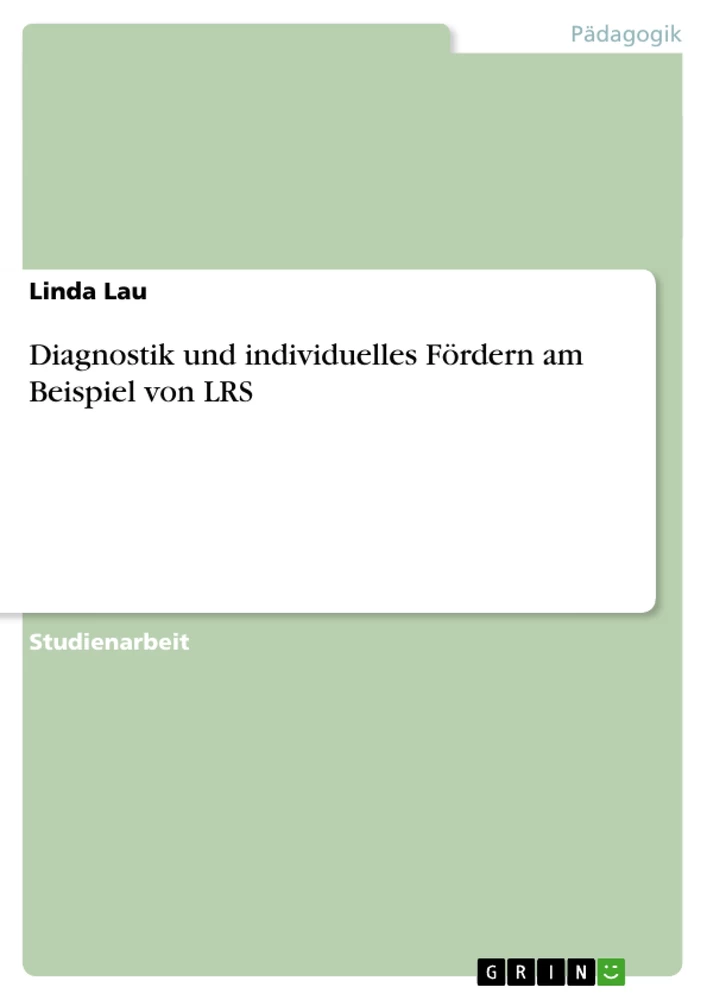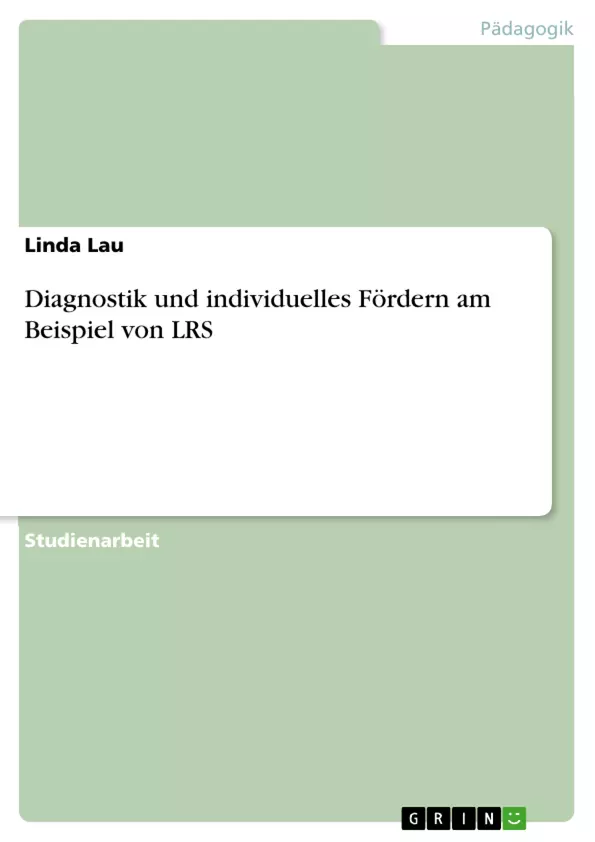[...] Nach dem allgemeinen Teil, sollen nun die Ergebnisse der Gruppenarbeit am Beispiel von LRS reflektiert werden. Es soll dabei um die Frage gehen, welche speziellen Formen es von Diagnostik und Förderung bei lese-rechtschreibschwachen Kindern gibt und ob diese sich von den allgemeinen Diagnose- und Fördermöglichkeiten unterscheiden.
„Mit dem Begriff Lese-Rechtschreib-Störung wird eine Störung bezeichnet, die durch ausgeprägte Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und/oder des Rechtschreibens gekennzeichnet ist.“ Nach dem Modell von Lauth/Brunstein/Grünke ist LRS in den Bereich der partiellen und persistierenden Lernstörungen einzuordnen. Nach dem Internationalen Klassifikationsschema (ICD-10) der WHO schließen bestimmte Kriterien die Diagnose LRS aus. Es dürfen weder eine neurologische Störung, eine geistige Behinderung, eine periphere Hör- oder Sehbeeinträchtigung oder aber eine unzureichende Unterrichtung vorliegen.
In der Forschung besteht grundsätzlich Uneinigkeit darüber, wie die einzelnen Begriffe „Legasthenie“, „Lese-Rechtschreibstörung“ und „Lese-Rechtschreibschwäche“ genau zu definieren sind. Im Rahmen der Hausarbeit werde ich mich auf die laut Eichler im Allgemeinen akzeptierte Theorie von LRS als Lernstörung beziehen. Demnach wirken sich verschiedene Faktoren negativ auf das Lese- und Rechtschreibverhalten eines Schülers aus und beeinträchtigen dessen Entwicklung - meist auch über die eigentliche bereichsspezifische Störung hinaus. Eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung kann drastische Auswirkungen auf die Psyche eines Kindes haben. Beispielsweise kann es zur Ausbildung einer generellen Lese- und Schreibangst kommen.
Die Ursachen von LRS sind vielseitig. Klicpera/Schabmann/Gasteiger-Klicpera zählen erstens biologische bzw. genetische Faktoren, zweitens mangelnde kognitive Lernvoraussetzungen (z.B. visuelle oder auditive Wahrnehmungsschwächen, geringe Benennungsgeschwindigkeit, Beeinträchtigungen des Gedächtnisses) und drittens soziale Gegebenheiten (z.B. sozialökonomische/familiäre Verhältnisse, Freizeitverhalten) als mögliche Gründe für ein gestörtes Lese- und Rechtschreibverhalten auf. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1: Dokumentation und Reflexion der Sitzungsgestaltung
- 1. Einleitung I
- 2. Dokumentation der Sitzungsgestaltung
- 2.1. Vorbereitung
- 2.2. Durchführung der Präsentation
- 3. Reflexion des Ablaufs und der Rückmeldungen
- 4. Fazit: Selbstreflexion
- Teil 2: Ausarbeitung der Ergebnisse am Beispiel LRS
- 5. Einleitung II
- 6. Formen der Diagnostik bei LRS
- 6.1. Beobachtung im Unterricht und ergänzendes Elterngespräch
- 6.2. Standardisierte Testverfahren
- 7. Möglichkeiten der individuellen Förderung bei LRS
- 7.1. Prävention und Frühförderung
- 7.2. Förderung im Regelunterricht
- 7.3. Die Rolle der Eltern
- 7.4. Förderung im Rahmen spezieller Förderkurse
- 8. Abschließendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Thema der Diagnostik und individuellen Förderung im Unterricht, anhand des Beispiels von LRS. Die Arbeit dokumentiert die Sitzungsvorbereitung und -durchführung einer Seminarsitzung, die auf das Thema Diagnostik und individuelles Fördern fokussiert ist. Ziel ist es, eine Methode vorzustellen, die es ermöglicht, Schüler in Abhängigkeit von ihrem Vorwissen in Gruppen einzuteilen und individuell zu fördern.
- Die Bedeutung der Diagnostik im Unterricht
- Die Anwendung von Diagnostik im Bereich von LRS
- Individuelle Förderung in heterogenen Lerngruppen
- Die Rolle von Standardisierten Testverfahren in der Diagnostik
- Möglichkeiten zur Förderung von Schülern mit LRS
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bildet die Einleitung der Arbeit und erläutert den Kontext und die Zielsetzung der Seminarsitzung. Kapitel 2 dokumentiert die Vorbereitung und Durchführung der Seminarsitzung, wobei sowohl die methodische Vorgehensweise als auch die Inhalte der Sitzung beschrieben werden. Im Fokus steht dabei die Anwendung eines Tests zur Einteilung von Schülern in unterschiedliche Fördergruppen. Kapitel 3 reflektiert den Ablauf der Seminarsitzung und die Rückmeldungen der Teilnehmer.
Schlüsselwörter
Diagnostik, individuelles Fördern, LRS, heterogene Lerngruppen, Standardisierte Testverfahren, Förderung im Regelunterricht, Elternarbeit, Förderkurse
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen LRS und Legasthenie?
In der Forschung herrscht Uneinigkeit über die genaue Abgrenzung. Oft wird LRS als allgemeinere Lernstörung betrachtet, während Legasthenie häufig als spezifische, biogenetisch bedingte Störung definiert wird.
Wie wird LRS im Schulalltag diagnostiziert?
Die Diagnostik erfolgt durch Beobachtung im Unterricht, Elterngespräche sowie durch den Einsatz standardisierter Testverfahren.
Welche Ursachen kann eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben?
Mögliche Ursachen sind genetische Faktoren, mangelnde kognitive Voraussetzungen (z. B. auditive Wahrnehmung) oder soziale Gegebenheiten im familiären Umfeld.
Wie sieht eine individuelle Förderung bei LRS aus?
Förderung kann im Regelunterricht durch Differenzierung, in speziellen Förderkursen oder durch die Einbindung der Eltern geschehen.
Welche psychischen Auswirkungen hat LRS auf Kinder?
LRS kann zu drastischen Folgen wie Lese- und Schreibangst, mangelndem Selbstbewusstsein und einer allgemeinen Schulunlust führen.
- Citar trabajo
- Linda Lau (Autor), 2010, Diagnostik und individuelles Fördern am Beispiel von LRS, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166132