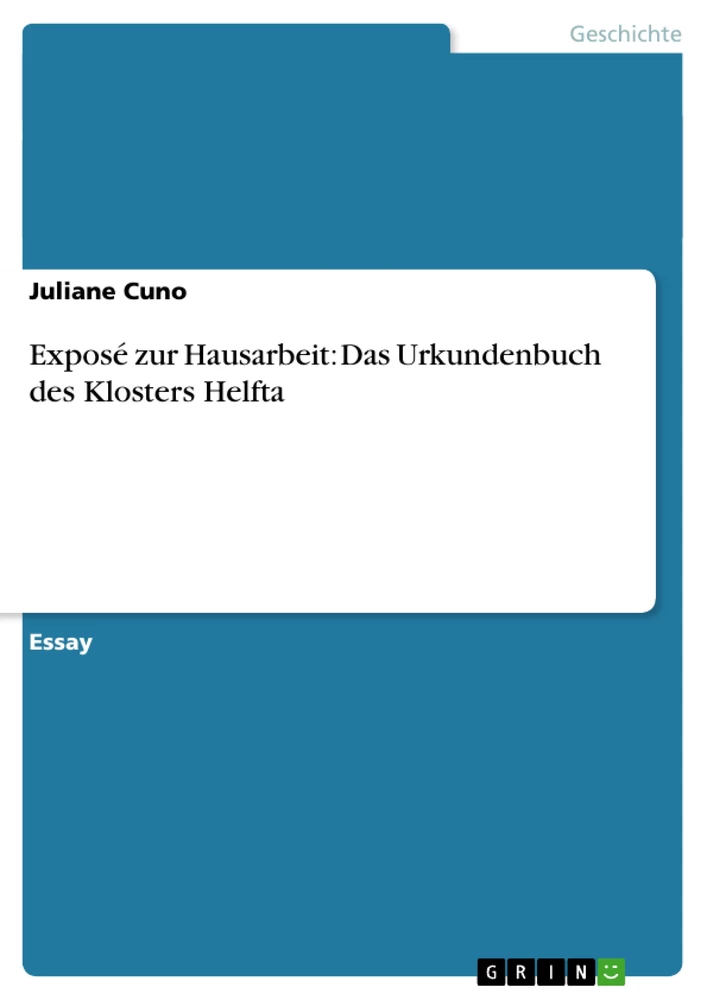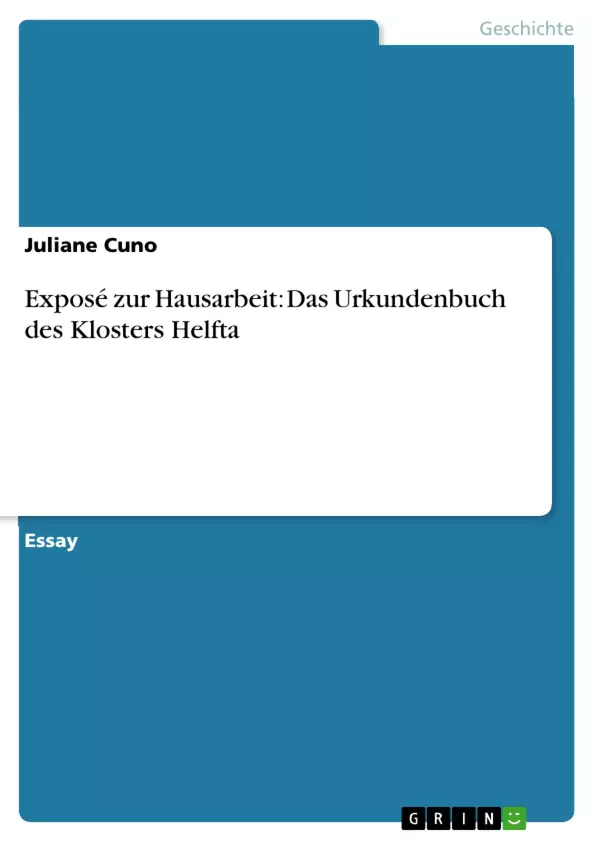Im Jahr 1229 wurde in der Grafschaft Mansfeld durch Burchard († 1229), dem Grafen zu Mansfeld, und seiner Frau Elisabeth von Schwarzburg († 1240) ein Frauenkloster „[…]ad honorem die et beate genitricis eiusdem et ad sustentacionem sanctimonialium Cisterciensis ordinis […]“ gestiftet. Das Kloster befand sich zunächst in der Nähe der Burg Mansfeld und wurde von sieben Nonnen aus dem Kloster St. Burkhard zu Haldensleben bewohnt. Die Gründung des Klosters Beatae Mariae Virginis3, bekannt und er dem Namen Helfta beziehungsweise Neu-Helfta, war die Gründung eines Zisterzienserinnenklosters.
In vielen der überlieferten Urkunden wird keine Aussage getroffen, welche Ordenszugehörigkeit das Frauenkloster hatte. Es wird nur das Patrozinium oder der Standort genannt. Die Nachrichten als Zisterzienserinnenkloster stammen alle aus dem 13. Jahrhundert. Danach wird Helfta als benediktinisches Kloster bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- Das Urkundenbuch des Klosters Helfta
- Gründung und Ortswechsel
- Die Mystikerinnen von Helfta
- Der Wiederaufbau des Klosters
- Neu-Helfta im städtischen Umfeld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Urkundenbuch des Klosters Helfta, ein Zisterzienserinnenkloster, das im 13. Jahrhundert in der Grafschaft Mansfeld gegründet wurde. Das Urkundenbuch zeichnet die Geschichte des Klosters nach, wobei insbesondere seine Ortswechsel, die Entstehung des Klosters und die Geschichte der berühmten Mystikerinnen Gertrud die Große von Helfta, Mechthild von Magdeburg und Mechthild von Hackeborn im Vordergrund stehen. Die Hausarbeit beleuchtet die Entwicklung des Klosters im Kontext der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen des Mittelalters.
- Die Gründung des Klosters Helfta im Kontext der Zeit
- Die Bedeutung der Mystikerinnen von Helfta
- Die Ortswechsel des Klosters und ihre Auswirkungen
- Die Entwicklung des Klosters im städtischen Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die Gründung des Klosters Helfta im Jahr 1229 durch Burchard, Graf von Mansfeld, und seine Frau Elisabeth von Schwarzburg. Es wird die Klosterordnung und die anfängliche Besiedlung durch Nonnen aus dem Kloster St. Burkhard zu Haldensleben beleuchtet.
- Das zweite Kapitel widmet sich den Ortswechseln des Klosters. Es beschreibt die Verlegung nach Roderstorf im Jahr 1234 und die spätere Umsiedlung nach Helfta südöstlich von Eisleben im Jahr 1258. Das Kapitel beleuchtet die Gründe für diese Ortswechsel und die damit einhergehenden Veränderungen.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Rolle der Mystikerinnen von Helfta, insbesondere Gertrud die Große, Mechthild von Magdeburg und Mechthild von Hackeborn. Es stellt die Lebenswege dieser Frauen vor und untersucht ihren Einfluss auf die Entwicklung des Klosters.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Wiederaufbau des Klosters im Jahr 1342 nach der Zerstörung durch Herzog Albert von Brandenburg. Es beschreibt den neuen Standort des Klosters vor den Mauern Eislebens und die Bedeutung dieser Zäsur in der Geschichte des Klosters.
- Das fünfte Kapitel untersucht die Integration des Klosters in das städtische Umfeld Eislebens. Es betrachtet die räumliche Entwicklung des Klosters im Kontext der Stadtentwicklung und die damit verbundenen Veränderungen.
Schlüsselwörter
Das Urkundenbuch des Klosters Helfta, Zisterzienserinnenkloster, Gründung, Ortswechsel, Mystikerinnen, Gertrud die Große von Helfta, Mechthild von Magdeburg, Mechthild von Hackeborn, Wiederaufbau, städtisches Umfeld, Eisleben, Mittelalter, Klostergeschichte, Urkundenforschung.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde das Kloster Helfta gegründet?
Das Kloster wurde im Jahr 1229 durch Graf Burchard von Mansfeld und seine Frau Elisabeth von Schwarzburg gestiftet.
Wer waren die berühmten Mystikerinnen von Helfta?
Besonders bekannt sind Gertrud die Große, Mechthild von Magdeburg und Mechthild von Hackeborn, die das Kloster zu einem Zentrum der mittelalterlichen Mystik machten.
Warum wechselte das Kloster mehrmals seinen Standort?
Gründe waren oft politische Unruhen, Zerstörungen durch Kriege (z. B. 1342 durch Herzog Albert von Brandenburg) oder die Suche nach einem sichereren städtischen Umfeld.
Welchem Orden gehörte das Kloster an?
Ursprünglich als Zisterzienserinnenkloster gegründet, finden sich in späteren Urkunden auch Bezeichnungen als benediktinisches Kloster.
Was ist die Bedeutung des Urkundenbuchs für die Forschung?
Das Urkundenbuch erlaubt es, die Rechtsgeschichte, die Besitzverhältnisse und die soziale Integration des Klosters in die Region Mansfeld/Eisleben lückenlos nachzuvollziehen.
- Citar trabajo
- Juliane Cuno (Autor), 2010, Exposé zur Hausarbeit: Das Urkundenbuch des Klosters Helfta , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166187