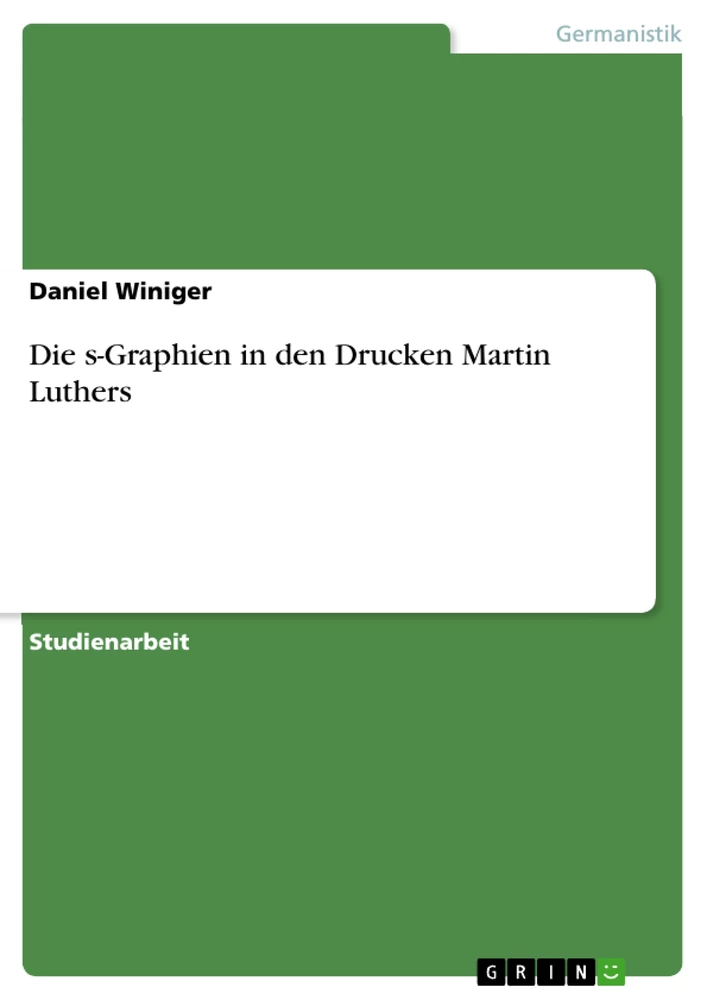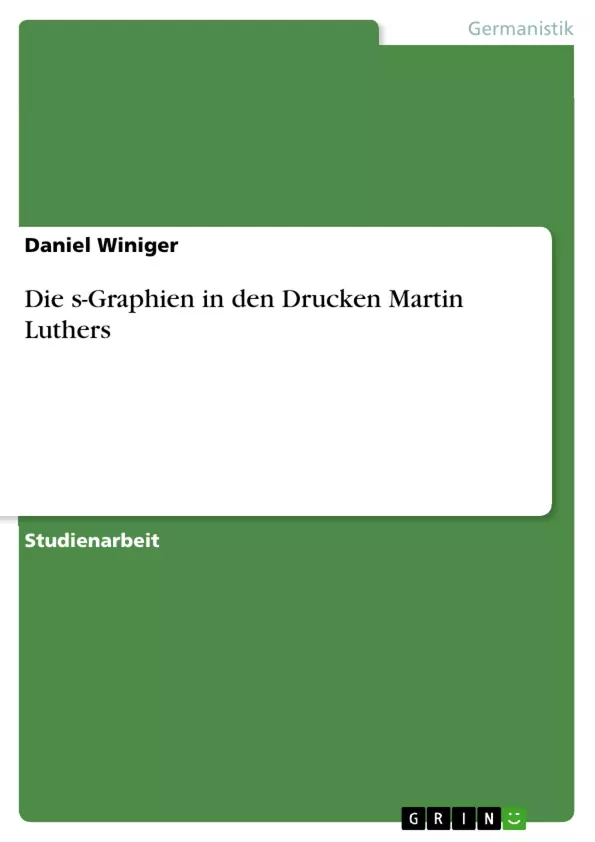Die Frage, ob und in welchem Maße Luthers Schriftsprache das Frühneuhochdeutsche in Bereichen wie Stil, Wortwahl, Grammatik und Orthographie mittel- und unmittelbar beeinflusst hat, ist umstritten.
Die Untersuchung der s-Graphien in den frühen und späten Lutherdrucken soll Aufschluss darüber bringen inwiefern a) die Lutherdrucke in ihrer Orthographie allmählich eine eigene Systematik entwickeln und b) inwiefern die Systematik der s-Graphien in den Lutherdrucken sich auf die regionalen und überregionalen orthographischen Gepflogenheiten ihrer Zeit auswirkte.
Inhalt
1 Einleitung
2 Untersuchung der s-Graphien in Luthers frühen und späten Drucken:
2.1 Zur Methodik der Untersuchung
2.2 Untersuchung der s-Graphien Luthers in drei Perioden:
2.2.1 Die Drucke der Jahre 1516-1521:
2.2.1.1 Anlaut - 2.2.1.2 Inlaut - 2.2.1.3 Auslaut
2.2.2 Die Drucke der Jahre 1522-1524:
2.2.2.1 Anlaut - 2.2.2.2 Inlaut - 2.2.2.3 Auslaut
2.2.3 Die Drucke der Jahre 1525-1546:
2.2.3.1 Anlaut - 2.2.3.2 Inlaut - 2.2.3.3 Auslaut
3 Das Verhältnis der Orthographie Luthers zu der der Wittenberger Offizinen
4 Die lutherischen s-Graphien in historischer und geographischer Sicht:
4.1 Die s-Schreibung vor Luther
4.2 Die s-Schreibung zu Zeiten Luthers:
4.2.1 Anlaut - 4.2.2 Inlaut - 4.2.3 Auslaut
4.2.4 Schlussfolgerung
4.3 Die Entwicklung zum Neuhochdeutschen hin
5 Ergebnisse (mit Übersicht)
6 Literaturverzeichnis:
6.1 Primärliteratur
6.2 Sekundärliteratur
1 Einleitung
Die Frage, ob und in welchem Maße Luthers Schriftsprache das Frühneuhochdeutsche in Bereichen wie Stil, Wortwahl, Grammatik und Orthographie mittel- und unmittelbar beeinflusst hat, ist umstritten. In Bezug auf die Orthograpie lässt sich Luthers sprachlicher Einfluss wohl am einfachsten nachvollziehen - ein Beispiel sei nur die Großschreibung der Substantive.[1] Die folgende Untersuchung soll sich mit einem Bereich der lutherischen Orthographie befassen, der auch in der heutigen Rechtschreibung vielfach diskutiert wird: die s-Graphien.
Im Vordergrund stehen soll die Frage, welche s-Graphien die Drucke Luthers in verschiedenen Abschnitten seiner Schaffenszeit für die verschiedenen Positionen im Wort benutzen: In einer Frühphase bis etwa 1521, einer Übergangsphase bis zum Jahr 1524 und einer Spätphase, die daran anschließt. Mit dieser zeitlichen Gliederung soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich Martin Luther seit dem Beginn seiner Bibelübersetzung (1521/22) in zunehmendem Maße um eine einheitlichere Orthographie in seinen Drucken bemühte und folglich versuchte, die bis dahin herrschende Willkür unter den Druckern, aber auch die Inkonsequenzen in seinen Manuskripten zu unterbinden.
Der Stellung im intervokalischen Inlaut soll besondere Aufmerksamkeit gelten, da hier zwei s-Laute verschiedener Herkunft auftreten können: Das urgermanische, intervokalisch stimmhaft ausgesprochene s, bereits im Ahd. meist mit <s> wiedergegeben, und das durch die althochdeutsche Lautverschiebung aus t entstandene, stimmlos artikulierte s, das im Mhd. anfänglich mit <z(z)>, später meist mit <ss> oder <sz> / <ß> gekennzeichnet wurde. Im Wortauslaut wird diese Opposition durch die Auslautverhärtung neutralisiert.
Einer Untersuchung der lutherischen Orthographie dienlich sind nur die Drucke, die in Wittenberg erschienen sind, denn nur hier wurden, bis auf wenige Ausnahmen, die Urdrucke nach Luthers Manuskripten angefertigt und nur hier konnte Luther direkt auf den Drucklegungsprozess Einfluss nehmen. Aus diesem Grund kommen auch nur die Drucke in Frage, die zu seinen Lebzeiten erschienen sind. Angesichts einer größer werdenden Konsequenz in der Orthographie der Drucke erscheint es außerdem angebracht, das Verhältnis der Orthographie des Reformators selbst zu der der Wittenberger Druckereien näher zu beleuchten - insbesondere hier die Rolle der Korrektoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Die bedeutendsten der in Wittenberg für Luther tätigen Drucker
(vgl. Benzing 1994, II, 422).
Schließlich drängt sich die Frage auf, inwiefern sich Luthers Verwendung der s-Graphien historisch und geographisch einordnen lässt: Welchem Vorbild, welcher orthographischen Norm folgt Luther in seinen frühen Drucken? Hat der Wandel in Luthers System der s-Graphien den Charakter einer Reform oder handelt es sich nur um eine Anpassung an bestehende Tendenzen? Bleibt noch die Frage nach der Wirkung: Wurde Luthers System zur Norm für kommende Generationen, finden sich Ansätze davon in der heutigen Regelung?
Nicht berücksichtigt wurden die Schreibung von sch und z, sowie die durch die Frakturschrift bedingte rein typographische Unterscheidung zwischen “langem s” (R) am Wortanfang und im Wortinneren und “rundem s” (s) am Wortende, die seit dem 14. Jahrhundert weitgehend feststand[2] und auch in den Wittenberger Lutherdrucken durchgehend eingehalten wird. Zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit wird in der Arbeit auch für R das Zeichen s verwendet.
2 Untersuchung der s-Graphien in Luthers frühen und späten Drucken
2.1 Zur Methodik der Untersuchung
Der folgenden Untersuchung werden die Aussagen über die s-Schreibung des Reformators in den beiden Standardwerken zur Luthersprache, Handbuch der Luthersprache von Heinrich Bach und Grundzüge der Schriftsprache Luthers von Carl Franke zu Grunde gelegt. Diese Aussagen sollen anhand einiger ausgewählter Drucke aus verschiedenen Phasen der Lutherschen Schaffenszeit überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Entsprechend dem Wandel in der Orthographie der Lutherdrucke können diese in drei Perioden eingeordnet werden: Die Periode der frühen Drucke, die durch viele Inkonsequenzen, ja eine gewisse Willkür geprägt ist (1516 bis 1521), die Phase des Wandels, in der es Luther zunehmend gelingt, die Orthographie in seinen Drucken zu vereinheitlichen (1522-1524) und die Periode der späten Drucke, in denen der Prozess der Läuterung abgeschlossen scheint (1525-46). Um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Wittenberger Offizinen sowie deren Gemeinsamkeiten bezüglich der Verwendung der s-Graphien zu berücksichtigen, wurden Lutherdrucke aus fünf verschiedenen Wittenberger Druckereien analysiert, die sowohl hinsichtlich der Bedeutung der bei ihnen gedruckten Werke als auch hinsichtlich der Anzahl der Drucke als die wichtigsten angesehen werden können.[3] Es sind dies die Druckereien von Johann Rhau-Grunenberg, Melchior Lotther dem Jüngeren, Nickel Schirlentz und Hans Lufft sowie die Offizin von Lukas Cranach und Christian Döring. Die einzelnen Drucke wurden jeweils so weit untersucht, bis die Regelmäßigkeiten unter den s-Graphien in den verschiedenen Positionen im Wort deutlich zu erkennen waren, bzw. bis das Fehlen einer Regelmäßigkeit für bestimmte Positionen festgestellt werden konnte. In jedem Fall wurde jedoch ein Abschnitt von mindestens 4000 Wörtern analysiert.
2.2 Untersuchung der s-Graphien Luthers in drei Perioden
2.2.1 Die Drucke der Jahre 1516-1521
In diesem Abschnitt werden primär die Informationen von Heinrich Bach (Handbuch der Luthersprache) berücksichtigt, weil nur er detaillierte Aussagen über die Verhältnisse in den frühen Lutherdrucken macht. Untersucht wurden die Drucke Puszpsalm 1517, Wucher 1519 und Freyheyt 1520 von Grunenberg sowie Werckenn 1520 von Melchior Lotther d.J.[4]
2.2.1.1 Anlaut
Heinrich Bach findet in allen Lutherdrucken regelmäßig s - im Anlaut und ergänzt, in den frühen Drucken komme auch ß - im Anlaut vor, jedoch nur in ganz wenigen wörtern, in ‘ßo/alßo’ [..] beinah [sic] immer bis 1522/23, außerdem mehrfach in ‘ßondern’ [..] neben ‘sondern/sundern’. In anderen Wörtern seien nur ganz verstreute belege zu verzeichnen, so in ‘beßorgen’, [..] ‘ßunder’, usw. (BachHandb, 296).
Meine eigenen Untersuchungen können diese Ergebnisse bestätigen: In allen vier Drucken steht im Anlaut regelmäßig s-. Ausnahmen sind ßo, welches immer mit Eszett erscheint, alßo, welches teilweise dominiert, teilweise mit also abwechselt, daneben gelegentlich ßondern, ßonst und auch vereinzelt ßon (Freyheyt 1520), jeweils als Variante zur Schreibung mit s-.
Dort, wo ein ehemals im Anlaut stehendes s durch Präfigierung in zwischenvokalische Stellung geraten ist, steht durchgängig einfaches s - (gesund, angesicht, gesagt, besonders, usw).
2.2.1.2 Inlaut
Laut Heinrich Bach entbehrt die schreibung der intervokalischen s-laute in den L-drucken bis 1520 jeglicher regelung. Sowohl nach kurzem als langem vokal stehe durchweg ‘ss’ oder ‘ß’ (‘sß’, ‘ßs’) für mhd. -s-/-ss-/-z(z)-. Die numerische verteilung sei in den einzelnen drucken sehr verschieden. So habe eine Seite des Grunenbergdruckes WA 2,72 (1519) durchgängig ß in intervokalischer Stellung (laßen, sie wißen, usw.), umgekehrt zeige eine Seite des Grunenbergdruckes WA 2,140 (1519) immer -ss- (sie beyssen, fressen, usw.). Gewöhnlich seien ß und ss jedoch gleichmäßiger verteilt, in manchen Wörtern stehe vorzugsweise ss, in anderen ß. In einigen Drucken bestehe sogar eine klare tendenz, nach kurzvokal -ss-, nach langvokal -ß- zu setzen, wobei -ß- auch für nhd. -s- verwendet werde. Einfaches -s- komme generell selten vor (BachHandb, 301f.).
[...]
[1] So werden in den Lutherdrucken ab 1532 ca. 70% aller Substantive großgeschrieben (vgl. Bach 1985b, S. 1444).
[2] Vgl. V.Moser I,1,66; Michel 1959, 457.
[3] vgl. Haubold 1914; Volz 1974; Kettmann 1987.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Textvorschau über Luthers Sprache?
Diese Textvorschau bietet einen umfassenden Überblick über eine Analyse der s-Graphien in den frühen und späten Drucken von Martin Luther. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Einleitung (1 Einleitung) behandelt?
Die Einleitung diskutiert die Frage des Einflusses von Luthers Schriftsprache auf das Frühneuhochdeutsche, insbesondere im Bereich der Orthographie. Sie konzentriert sich auf die s-Graphien und deren Verwendung in verschiedenen Phasen von Luthers Schaffen.
Wie ist die Untersuchung der s-Graphien in Luthers Drucken zeitlich gegliedert (2 Untersuchung der s-Graphien in Luthers frühen und späten Drucken)?
Die Untersuchung gliedert sich in drei Perioden: eine Frühphase bis etwa 1521, eine Übergangsphase bis 1524 und eine Spätphase ab 1525. Diese Gliederung berücksichtigt Luthers Bemühungen um eine einheitlichere Orthographie seit dem Beginn seiner Bibelübersetzung.
Welche Bedeutung hat die Stellung im intervokalischen Inlaut?
Der Stellung im intervokalischen Inlaut wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da hier zwei s-Laute verschiedener Herkunft auftreten können: das urgermanische, stimmhafte s und das durch die althochdeutsche Lautverschiebung entstandene, stimmlose s.
Warum werden nur Drucke aus Wittenberg berücksichtigt?
Nur Drucke aus Wittenberg werden berücksichtigt, da hier die Urdrucke nach Luthers Manuskripten angefertigt wurden und Luther direkten Einfluss auf den Drucklegungsprozess nehmen konnte.
Welche Fragen werden hinsichtlich der historischen und geographischen Einordnung von Luthers s-Graphien aufgeworfen (4 Die lutherischen s-Graphien in historischer und geographischer Sicht)?
Es wird gefragt, welchem Vorbild Luther folgt, ob der Wandel in seinem System der s-Graphien eine Reform darstellt oder eine Anpassung an bestehende Tendenzen, und ob Luthers System zur Norm für kommende Generationen wurde.
Welche Aspekte der Schreibung werden nicht berücksichtigt?
Die Schreibung von sch und z, sowie die typographische Unterscheidung zwischen langem s (R) und rundem s (s) werden nicht berücksichtigt.
Welche Methodik liegt der Untersuchung zugrunde (2.1 Zur Methodik der Untersuchung)?
Die Untersuchung basiert auf den Aussagen von Heinrich Bach und Carl Franke zu Luthers Sprache und überprüft diese anhand ausgewählter Drucke aus verschiedenen Phasen. Lutherdrucke aus fünf Wittenberger Druckereien wurden analysiert.
Welche Druckereien wurden bei der Analyse berücksichtigt?
Die Druckereien von Johann Rhau-Grunenberg, Melchior Lotther dem Jüngeren, Nickel Schirlentz und Hans Lufft sowie die Offizin von Lukas Cranach und Christian Döring wurden berücksichtigt.
Welche Beobachtungen wurden in den Drucken der Jahre 1516-1521 gemacht (2.2.1 Die Drucke der Jahre 1516-1521)?
Im Anlaut steht regelmäßig s-, mit Ausnahmen wie ßo und alßo. In intervokalischer Stellung gibt es keine klare Regelung, sowohl ss als auch ß kommen vor. Durch Präfigierung in zwischenvokalische stellung geraten ist, steht durchgängig einfaches s.
- Citation du texte
- Daniel Winiger (Auteur), 1998, Die s-Graphien in den Drucken Martin Luthers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166231