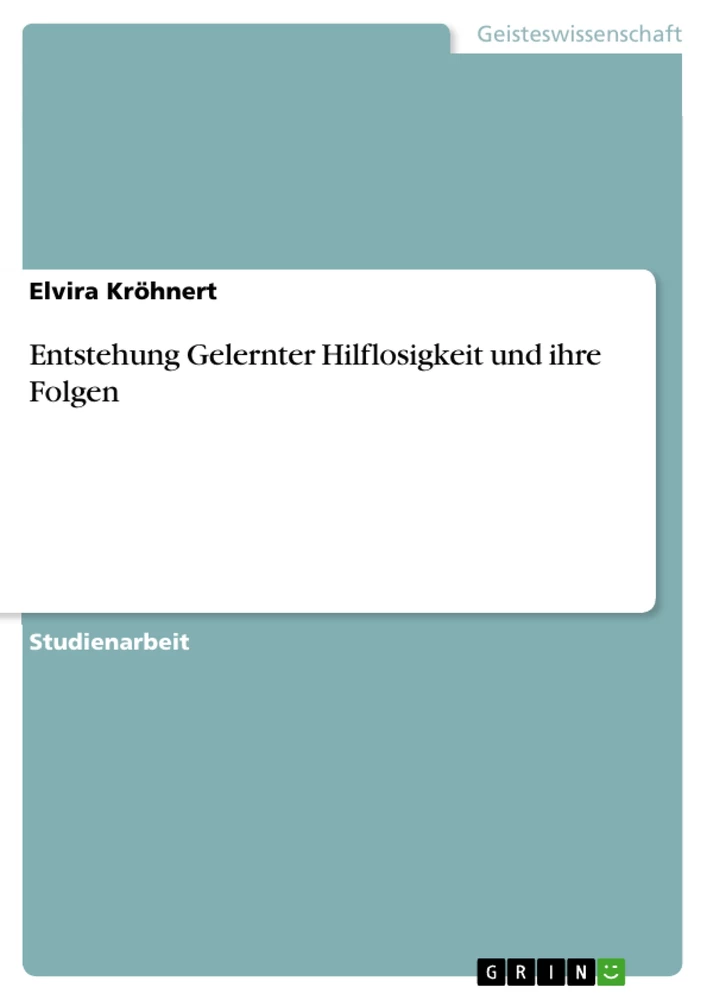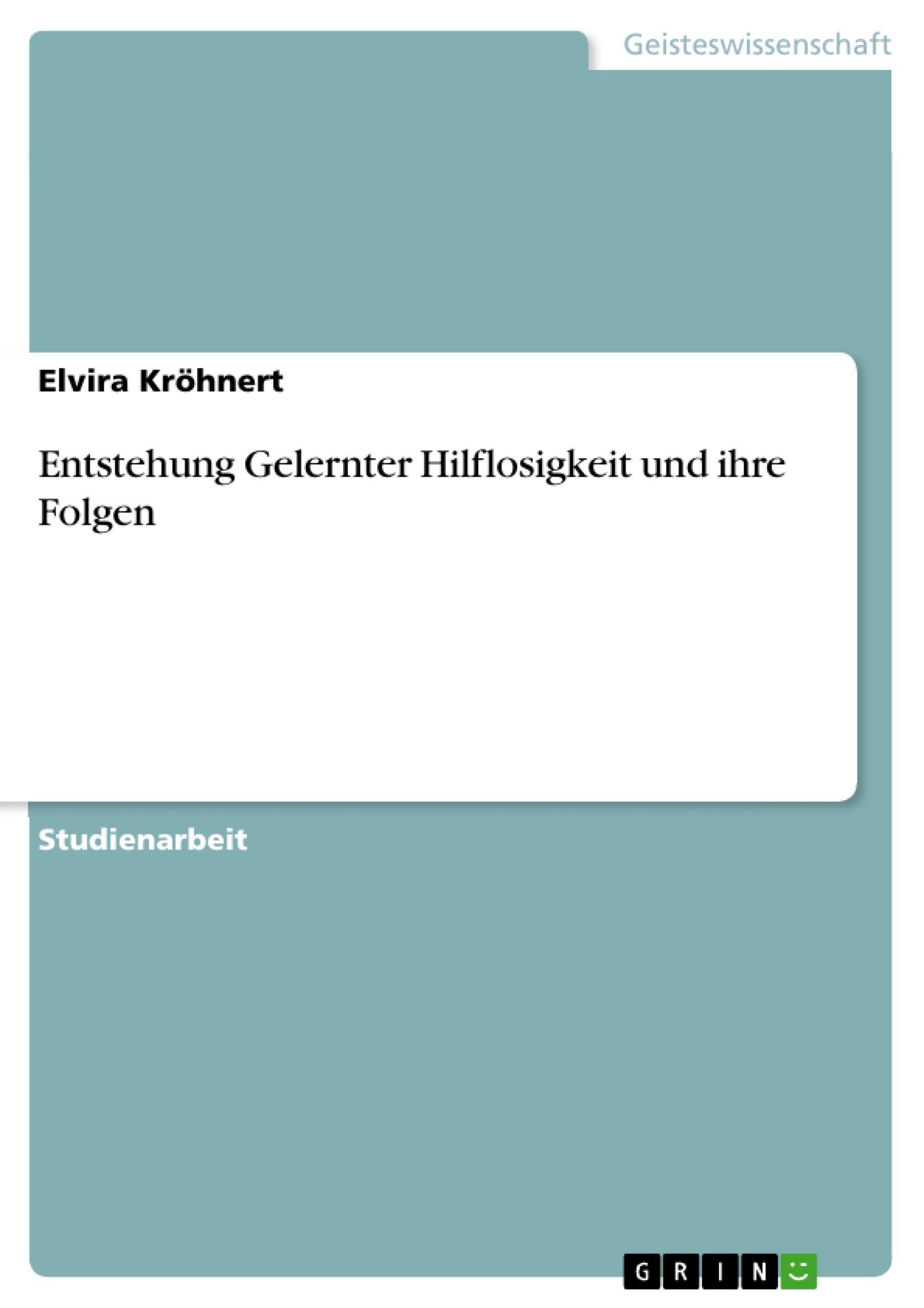Die vorliegende Arbeit will einen Überblick über die Hilflosigkeitsforschung geben. Sie geht dabei speziell der Frage nach, wodurch Hilflosigkeit entsteht und was ihre Auswirkungen sind. Unterschiedliche Ansätze werden vorgestellt, die versuchen, die Ursache der Gelernten Hilflosigkeit aufzudecken. Es wird gezeigt, wie Persönlichkeitsunterschiede wirken, woher sie eventuell kommen und welche tatsächlichen Folgen sie für die Person haben. Die auf die unterschiedlichen Ansätze folgenden Hilfs – und Änderungsmöglichkeiten werden erwähnt, sowie ein neuer Denkanstoß gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Entstehung Gelernter Hilflosigkeit und ihre Folgen
- Entdeckung der Hilflosigkeit und erste Ansätze zur Ursachenforschung
- Hilflosigkeit beim Menschen
- Unkontrollierbarkeit als Ursache
- Widerlegung Seligmans
- Abhängigkeit des Hilflosigkeitlernens von dem Ausmaß der Mißerfolge
- Reaktanztheorie von Brehm (1972)
- Anreiz und Entsagung
- Kurzer Überblick in andere Motivationsforschungsbereiche
- Persönlichkeitsunterschiede und ihre Folgen
- Attributionstheoretischer Ansatz
- Unterschiedliche Erklärungen für Erfolg und Mißerfolg
- Handlungskontrolle nach Kuhl (1981)
- Versuche der Annäherung an die Ursachen
- Generalisierung der Gelernten Hilflosigkeit
- Kontrolle und Vorhersagung
- Auswirkungen eines heimtückischen Attributionsstils
- Attributionsstil und Depressionen
- Gegenteilige Befunde
- Spektakuläre Befunde bei Rattenstudien
- Entstehung des „funktionalen Defizits“
- Beleg für ein funktionales Defizit
- Funktionales Defizit versus stabil – globaler Attributionsstil
- Prozeß des Hilfloswerdens
- Möglichkeiten der Einflußnahme
- Genese der Attributionsstile
- Genetische versus umweltbedingte Entstehung der Handlungskontrolle
- Auswirkung der Änderung des Attributionsstils
- Beeinflussung der Handlungskontrolle
- Neuerer Ansatz
- Anagenesis - Modell
- Schlußfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Hilflosigkeitsforschung zu geben. Sie beschäftigt sich insbesondere mit den Ursachen der Gelernten Hilflosigkeit und ihren Auswirkungen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Ansätze, die versuchen, die Entstehung der Gelernten Hilflosigkeit zu erklären. Sie zeigt den Einfluss von Persönlichkeitsunterschieden, deren mögliche Ursachen und Folgen auf. Außerdem werden Hilfs- und Änderungsmöglichkeiten im Hinblick auf die verschiedenen Ansätze erwähnt und ein neuer Denkanstoß gegeben.
- Entstehung Gelernter Hilflosigkeit
- Einfluss von Persönlichkeitsunterschieden
- Auswirkungen der Gelernten Hilflosigkeit
- Möglichkeiten der Intervention
- Unterschiedliche theoretische Ansätze zur Erklärung der Gelernten Hilflosigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Entdeckung der Hilflosigkeit und beleuchtet erste Ansätze zur Ursachenforschung. Dabei wird die Hilflosigkeit beim Menschen betrachtet und die Unkontrollierbarkeit als mögliche Ursache untersucht. Auch die Widerlegung Seligmans und die Abhängigkeit des Hilflosigkeitlernens vom Ausmaß der Mißerfolge werden diskutiert. Die Reaktanztheorie von Brehm (1972) und das Thema Anreiz und Entsagung werden ebenfalls angesprochen.
Anschließend folgt ein kurzer Überblick über verschiedene Motivationsforschungsbereiche, einschließlich Persönlichkeitsunterschieden und ihren Folgen, dem attributionstheoretischen Ansatz, unterschiedlichen Erklärungen für Erfolg und Mißerfolg sowie der Handlungskontrolle nach Kuhl (1981).
Die Arbeit geht dann auf Versuche der Annäherung an die Ursachen der Gelernten Hilflosigkeit ein, einschließlich der Generalisierung der Gelernten Hilflosigkeit und dem Zusammenhang zwischen Kontrolle und Vorhersagung.
Im nächsten Abschnitt werden die Auswirkungen eines heimtückischen Attributionsstils untersucht, insbesondere in Bezug auf Attributionsstil und Depressionen. Gegenteilige Befunde und spektakuläre Befunde bei Rattenstudien werden ebenfalls diskutiert.
Die Entstehung des „funktionalen Defizits“ wird im Folgenden beleuchtet, wobei Belege für ein funktionales Defizit, der Unterschied zwischen funktionalem Defizit und stabilem, globalem Attributionsstil sowie der Prozess des Hilfloswerdens untersucht werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Gelernter Hilflosigkeit, Persönlichkeitsunterschiede, Attribution, Handlungskontrolle, Motivation, Depression, funktionales Defizit, Attributionsstil und Intervention.
Häufig gestellte Fragen
Was ist „Gelernte Hilflosigkeit“?
Es handelt sich um einen Zustand, in dem ein Individuum aufgrund negativer Erfahrungen die Überzeugung gewinnt, unangenehme Ereignisse nicht beeinflussen zu können, selbst wenn Kontrollmöglichkeiten bestehen.
Welche Rolle spielt die Unkontrollierbarkeit?
Unkontrollierbarkeit gilt als Hauptursache für die Entstehung von Hilflosigkeit, wobei die Wahrnehmung von Misserfolgen entscheidend für den Lernprozess ist.
Was besagt der attributionstheoretische Ansatz?
Dieser Ansatz erklärt Hilflosigkeit dadurch, wie Menschen Erfolg und Misserfolg begründen (z. B. stabil-global vs. variabel-spezifisch). Ein negativer Attributionsstil kann Depressionen fördern.
Was ist ein „funktionales Defizit“?
Ein funktionales Defizit beschreibt die Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit, die aus dem Prozess des Hilfloswerdens resultiert.
Kann man Gelernte Hilflosigkeit wieder verlernen?
Ja, durch die Änderung des Attributionsstils und die Beeinflussung der Handlungskontrolle (z. B. nach Kuhl) gibt es Möglichkeiten der Intervention und Einflussnahme.
- Arbeit zitieren
- Elvira Kröhnert (Autor:in), 1999, Entstehung Gelernter Hilflosigkeit und ihre Folgen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166282