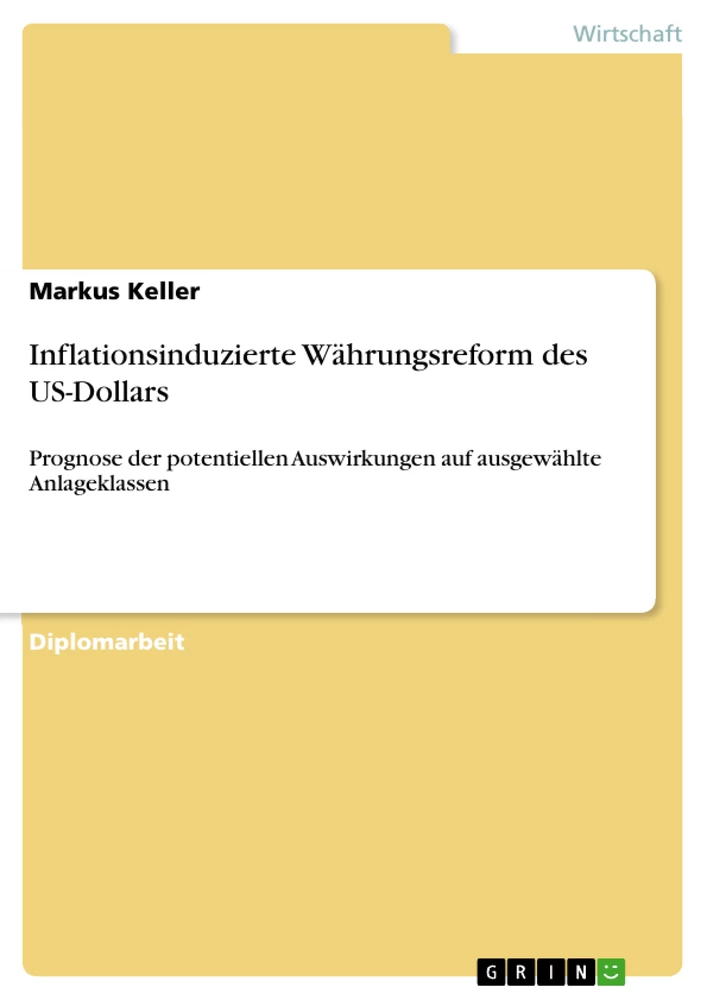In den USA wurde jahrzehntelang auf Basis von Krediten der Konsum finanziert. Da zwischen der Ostasienkrise und der US-Subprimekrise eine der längsten ununterbroche-nen Boomphasen der Geschichte, konnte die Wirtschaft der USA von dieser Politik profitieren. Doch dieses Vorgehen mündete schließlich in der vorgenannten Rezession, der Subprimekrise, welche durch nicht bezahlbare Immobiliendarlehen ausgelöst wurde. Bisher war die einzige Antwort der internationalen Finanzinstitutionen auf die Schuldenkrise, neue Schulden in Form von Krediten aufzunehmen. So subventionieren die EZB und das Fed überschuldete Staaten. Auch durch diese Entwicklung sind die USA nicht nur das Land mit der höchsten nominalen Verschuldung der Welt, sondern sogar das mit der höchsten Verschuldung aller Zeiten.
Es existieren zwei Wege für die USA, sich dieser Schulden zu entledigen. Zum einen ist es möglich, die ausgegebenen Kredite und Anleihen ganz oder teilweise abzuschreiben, bzw. ausfallen zu lassen. Dies würde zu einer Deflation und einhergehender Rezession führen, wie die USA sie bereits in den 1930er Jahren erlebt hatte. Zum anderen kann die Regierung eine inflationäre Politik verfolgen, um die Realverschuldung zu reduzieren . Alternativ könnte die Wirtschaft der USA so stark wachsen, dass über höhere Steuerzahlungen die Schulden abgetragen werden. Diese dritte Möglichkeit der Reduktion der Schuldenlast wird nicht weiter verfolgt, da viele der US-amerikanischen Unternehmen zu den derzeitigen Preisen international nicht wettbewerbsfähig sind. Dies äußert sich in den stetig steigenden Außenhandelsdefiziten.
Die wissenschaftliche Grundlage für diese Arbeit bietet der Ökonom Milton Friedman. Ihm zufolge ist die Ursache für eine Inflation generell in der Geldmenge zu suchen. Ein Indiz für eine inflationsbegünstigende Politik stellt die Schuldnerstruktur der USA dar, da sie über öffentliche Gläubiger einen Großteil ihrer Außenstände selbst hält. Ebenfalls ist eine Entwicklung im Welthandel sichtbar, welche an der Bedeutung des US-Dollars als Weltleitwährung kratzt. So führten die Staaten in Lateinamerika, welche eine wirtschaftlich enge Beziehung zu den USA haben, den SUCRE als regionale Han-delswährung ein. Dieser kann im südamerikanischen Raum zusätzlich zum US-Dollar als Zahlungsmittel genutzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemdarstellung
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Theoretische Grundlagen von Inflation und Währungsreform
- 2.1 Begriffsabgrenzungen
- 2.1.1 Währung
- 2.1.2 Inflation
- 2.1.3 Währungsreform
- 2.1.4 Geldmenge
- 2.1.5 Anlageklassen
- 2.1.5.1 Übersicht
- 2.1.5.2 Auswahl
- 2.1.5.2.1 Papiergeld und Bankguthaben
- 2.1.5.2.2 Anleihen
- 2.1.5.2.3 Aktien
- 2.1.5.2.4 Immobilien
- 2.1.5.2.5 Gold
- 3 Entwicklung einer Inflation
- 3.1 Marktungleichgewichte
- 3.2 Gründe für die Ausweitung der Geldmenge
- 3.2.1 Staatsverschuldung
- 3.2.2 Wirtschaftspolitik
- 3.2.3 Marktmechanismen
- 3.3 Methoden der Geldmengenausweitung
- 3.3.1 Kreditvergabe durch Banken
- 3.3.2 Geldpolitische Instrumente von Zentralbanken
- 3.3.2.1 Offenmarktpolitik
- 3.3.2.2 Ständige Fazilitäten
- 3.3.2.3 Mindestreservepolitik
- 3.4 Volkswirtschaftliche Einflussfaktoren auf die Kaufkraft einer Währung
- 3.4.1 Geldmenge
- 3.4.2 Wirtschaftswachstum
- 3.4.3 Leistungsbilanzsaldo
- 3.4.4 Arithmetik und Annahmen
- 4 Gründe für eine Währungsreform
- 4.1 Verschuldung
- 4.2 Kaufkraftverlust
- 4.3 Vertrauensdefizit
- 4.4 Politische Gründe
- 5 Praktische Analyse historischer Inflationen und Währungsreformen
- 5.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
- 5.2 Historische Beispiele für Auswirkungen der Geldmengenausweitung
- 5.2.1 Hyperinflation in Deutschland 1923
- 5.2.2 Hyperinflation in Deutschland 1948
- 5.2.3 Staatsbankrott Argentinien 2002
- 5.2.4 Währungsreform in Nordkorea 2009
- 5.3 Auswirkungen einer inflationsinduzierten Währungsreform auf Vermögensklassen am Beispiel der Hyperinflation in Deutschland 1923
- 5.3.1 Entwicklung von Papiergeld und Bankguthaben
- 5.3.2 Entwicklung von Anleihen
- 5.3.3 Entwicklung von Aktien
- 5.3.4 Entwicklung von Immobilien
- 5.3.5 Entwicklung von Gold
- 6 Analyse einer Währungsreform des US-Dollars
- 6.1 Gründe für die Ausweitung der Geldmenge in den USA
- 6.1.1 Entwicklung der US-amerikanischen Staatsverschuldung
- 6.1.2 Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika
- 6.1.3 Entwicklung des Kreditwachstums
- 6.2 Methoden der Geldmengenausweitung
- 6.2.1 Kreditvergabe durch US-Banken
- 6.2.2 Geldpolitische Instrumente des Federal Reserve System
- 6.2.2.1 Entwicklung der Offenmarktpolitik in den USA
- 6.2.2.2 Entwicklung der ständigen Fazilitäten in den USA
- 6.3 Volkswirtschaftliche Einflussfaktoren auf die Kaufkraft des US-Dollars
- 6.3.1 Entwicklung der Geldmenge
- 6.3.2 Wirtschaftswachstum in den USA
- 6.3.3 Leistungsbilanzsaldo der Vereinigten Staaten von Amerika
- 6.3.4 Annahmen zur Entwicklung von Vermögensgütern
- 6.4 Gründe für eine Währungsreform des US-Dollars
- 6.4.1 Verschuldung der USA
- 6.4.2 Kaufkraftverlust des US-Dollars
- 6.4.3 Vertrauensdefizit gegenüber dem US-Dollar
- 6.4.4 Politische Gründe für eine Währungsreform in den USA
- 6.5 Mögliche Auswirkungen einer inflationsinduzierten Währungsreform auf Vermögenswerte
- 6.5.1 Auswirkungen auf Papiergeld und Bankguthaben
- 6.5.2 Auswirkungen auf Anleihen
- 6.5.3 Auswirkungen auf Aktien
- 6.5.4 Auswirkungen auf Immobilien
- 6.5.5 Auswirkungen auf Gold
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die potentiellen Auswirkungen einer inflationsinduzierten Währungsreform des US-Dollars auf ausgewählte Anlageklassen. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen von Inflation und Währungsreform zu erläutern und anhand historischer Beispiele sowie einer Analyse der aktuellen wirtschaftlichen Situation der USA mögliche Szenarien zu prognostizieren.
- Theoretische Grundlagen der Inflation und Währungsreform
- Analyse historischer Währungsreformen und deren Auswirkungen
- Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen Lage der USA
- Prognose der Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen
- Entwicklung von Prognosemodellen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt die Problematik einer möglichen inflationsinduzierten Währungsreform des US-Dollars. Es definiert die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit. Die Relevanz des Themas wird durch die zunehmende Staatsverschuldung der USA und die damit verbundenen Risiken für die globale Wirtschaft unterstrichen.
2 Theoretische Grundlagen von Inflation und Währungsreform: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert zentrale Begriffe wie Inflation, Währung und Währungsreform und beschreibt verschiedene Anlageklassen (Papiergeld, Anleihen, Aktien, Immobilien, Gold) und deren potentielle Reaktionen auf inflationäre Entwicklungen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Zusammenhänge zwischen Geldmenge, Inflation und der Stabilität von Währungen.
3 Entwicklung einer Inflation: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung von Inflation. Es werden Marktungleichgewichte, Gründe für eine Ausweitung der Geldmenge (Staatsverschuldung, Wirtschaftspolitik, Marktmechanismen) und Methoden der Geldmengenausweitung (Kreditvergabe durch Banken, geldpolitische Instrumente der Zentralbanken) detailliert dargestellt. Der Zusammenhang zwischen Geldmenge, Wirtschaftswachstum, Leistungsbilanz und der Kaufkraft der Währung wird erörtert. Die verschiedenen Faktoren und ihre Wechselwirkungen werden detailliert beleuchtet.
4 Gründe für eine Währungsreform: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen, die zu einer Währungsreform führen können. Es analysiert die Rolle der Staatsverschuldung, des Kaufkraftverlusts, des Vertrauensdefizits in die Währung und politischer Faktoren. Die einzelnen Aspekte werden im Kontext historischer Beispiele und theoretischer Modelle diskutiert. Das Kapitel veranschaulicht die komplexen Ursachen und Zusammenhänge einer Währungsreform.
5 Praktische Analyse historischer Inflationen und Währungsreformen: Dieses Kapitel analysiert historische Fälle von Inflation und Währungsreformen, darunter die Hyperinflationen in Deutschland (1923 und 1948), den Staatsbankrott Argentiniens (2002) und die Währungsreform in Nordkorea (2009). Anhand dieser Beispiele werden die Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen untersucht und die gewonnenen Erkenntnisse auf die Fragestellung der Arbeit angewendet.
6 Analyse einer Währungsreform des US-Dollars: Dieses Kapitel wendet die in den vorherigen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse auf die mögliche Situation einer inflationsinduzierten Währungsreform des US-Dollars an. Es analysiert die Gründe für eine mögliche Ausweitung der Geldmenge in den USA (Staatsverschuldung, Wirtschaftspolitik, Kreditwachstum), die Methoden der Geldmengenausweitung und die volkswirtschaftlichen Einflussfaktoren auf die Kaufkraft des US-Dollars. Es werden verschiedene Szenarien und deren Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen diskutiert, ohne jedoch konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen.
Schlüsselwörter
Inflation, Währungsreform, US-Dollar, Geldmenge, Anlageklassen, Staatsverschuldung, Wirtschaftspolitik, Kaufkraft, Risikoanalyse, Prognosemodell, historische Beispiele, Hyperinflation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Auswirkungen einer inflationsinduzierten Währungsreform des US-Dollars
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die potentiellen Auswirkungen einer inflationsinduzierten Währungsreform des US-Dollars auf verschiedene Anlageklassen. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen von Inflation und Währungsreform und prognostiziert anhand historischer Beispiele und der aktuellen wirtschaftlichen Lage der USA mögliche Szenarien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen von Inflation und Währungsreform, analysiert historische Währungsreformen und deren Auswirkungen, bewertet die aktuelle wirtschaftliche Lage der USA und prognostiziert die Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen (Papiergeld, Anleihen, Aktien, Immobilien, Gold). Es werden auch Prognosemodelle entwickelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit besteht aus sechs Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung. Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) definiert zentrale Begriffe und beschreibt Anlageklassen. Kapitel 3 (Entwicklung einer Inflation) analysiert die Entstehung von Inflation und deren Einflussfaktoren. Kapitel 4 (Gründe für eine Währungsreform) untersucht die Ursachen von Währungsreformen. Kapitel 5 (Historische Analysen) analysiert historische Fälle von Inflation und Währungsreformen. Kapitel 6 (Analyse einer Währungsreform des US-Dollars) wendet die gewonnenen Erkenntnisse auf den US-Dollar an und diskutiert mögliche Szenarien.
Welche historischen Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Hyperinflationen in Deutschland (1923 und 1948), den Staatsbankrott Argentiniens (2002) und die Währungsreform in Nordkorea (2009), um die Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen zu untersuchen.
Welche Anlageklassen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen auf Papiergeld und Bankguthaben, Anleihen, Aktien, Immobilien und Gold.
Welche Faktoren beeinflussen die Kaufkraft einer Währung?
Die Kaufkraft einer Währung wird beeinflusst von der Geldmenge, dem Wirtschaftswachstum, dem Leistungsbilanzsaldo und weiteren volkswirtschaftlichen Faktoren.
Welche Gründe können zu einer Währungsreform führen?
Zu den Gründen für eine Währungsreform gehören hohe Staatsverschuldung, Kaufkraftverlust, Vertrauensverlust in die Währung und politische Gründe.
Welche Methoden der Geldmengenausweitung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Kreditvergabe durch Banken und geldpolitische Instrumente von Zentralbanken wie Offenmarktpolitik, ständige Fazilitäten und Mindestreservepolitik.
Wie wird die aktuelle wirtschaftliche Lage der USA bewertet?
Die Arbeit bewertet die aktuelle wirtschaftliche Lage der USA im Hinblick auf die Staatsverschuldung, die Wirtschaftspolitik und das Kreditwachstum, um mögliche Risiken für eine inflationsinduzierte Währungsreform zu identifizieren.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht keine konkreten Schlussfolgerungen, sondern diskutiert verschiedene Szenarien und deren potenzielle Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen im Kontext einer möglichen Währungsreform des US-Dollars.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Inflation, Währungsreform, US-Dollar, Geldmenge, Anlageklassen, Staatsverschuldung, Wirtschaftspolitik, Kaufkraft, Risikoanalyse, Prognosemodell, historische Beispiele, Hyperinflation.
- Quote paper
- Markus Keller (Author), 2011, Inflationsinduzierte Währungsreform des US-Dollars, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166285