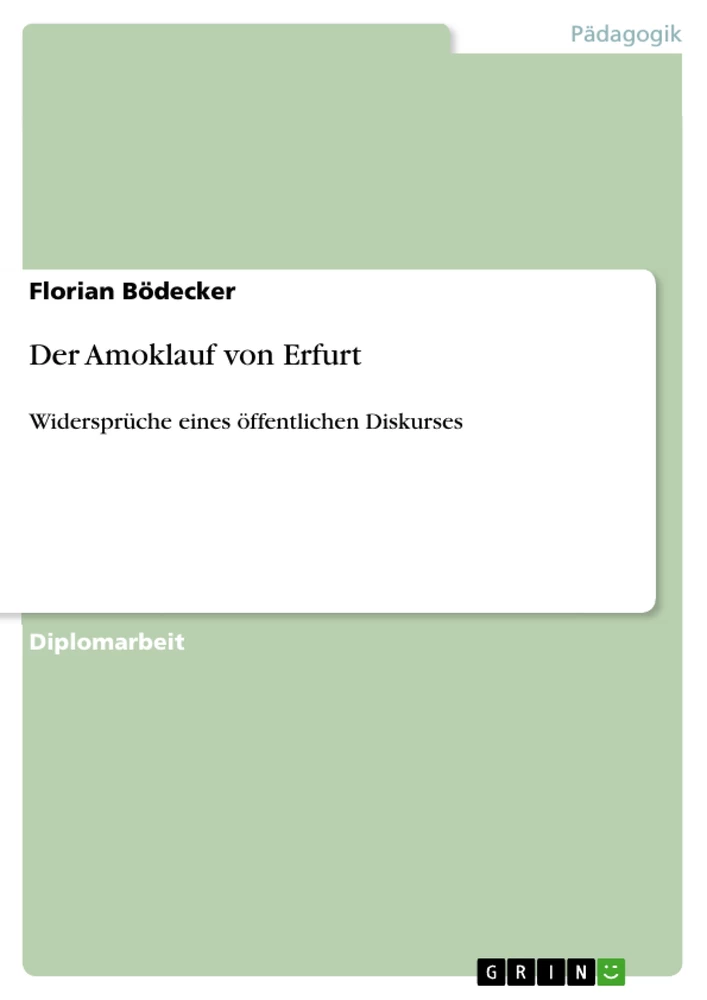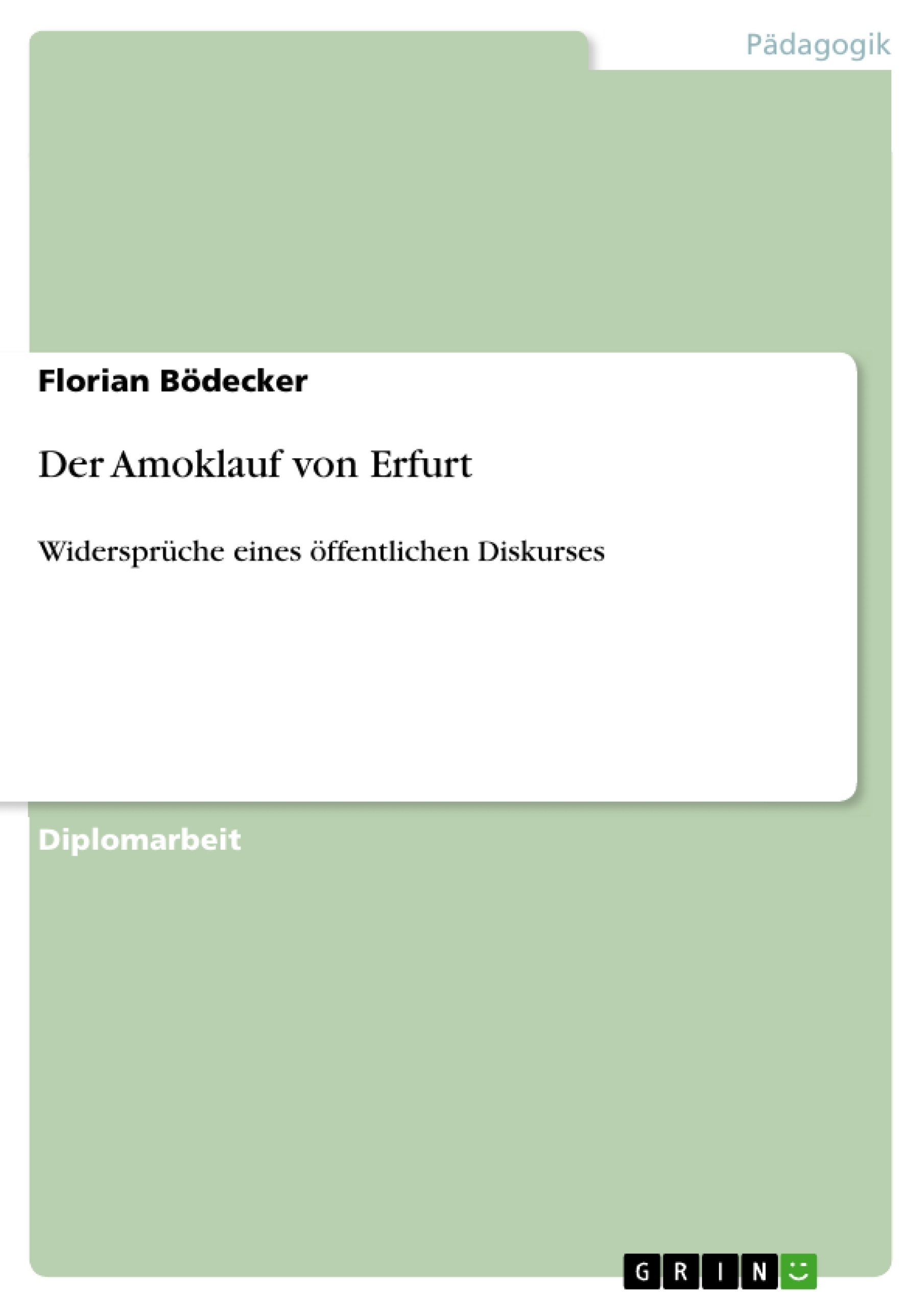In meiner Diplomarbeit untersuche ich den Amoklauf von Erfurt als "diskursives Ereignis", d.h. als ein Stück gesellschaftlicher Rede, das beschreibt, wie über das Ereignis gedacht wird, was über es gesagt und vor allem nicht gesagt wird. Dazu wurden über einen Zeitraum von zwei Wochen die Artikel von drei renommmierten Tageszeitungen, einer Wochenzeitung und eines Magazins ausgewertet. Dabei stellt sich heraus, das drei Themen im Vordergrund stehen: Die Diskussion über die Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Medien, die Täterpersönlichkeit und die Schule als gesellschaftliche Institution und Ort des Amoklaufs. Meine Analyse zeigt, daß sowohl bei der Diskussion der Medienwirkung als auch der Täterpersönlichkeit reale Handlungsgründe gar nicht erst vorkommen: So wird in der Debatte um Gewalt in Computerspielen, die gesellschaftiche Realität zugunsten der virtuellen ausgeblendet und der Amoklauf mit der Jugendlichkeit des Täters in Verbindung gebracht, die mit dem Alltag der Erwachsenen nichts zu tun hat. Die Diskussion um die Täterpersönlichkeit vereigenschaftet der Tat und ignoriert ihre Begründetheit in den Verhältnissen wie sie für den Täter bedeutungsvoll waren, womit sie zu einem singulären Ereignis wird, das mit anderen Bewältigungsweisen von Schule nichts zu tun. Die Schule gerät ebenfalls in den Fokus der Aufmerksamkeit, wird aber nicht in ihrer gesellschaftlichen Funktion begriffen (Auslese für die kapitalistische Berufshierarchie), sondern konstruktiv kritisiert: So gilt das Thüringische Schulsystem als besonders hart, und der Umgang mit den Schulverlieren könnte etwas sensibler erfolgen. Insgesamt ist der Diskurs um den Amoklauf von Erfurt dadurch gekennzeichnet, daß eine Kritik an der Lebensbedingungen entweder abgewehrt wird oder nur als konstruktive zugelassen wird.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zur Methode
- A. Allgemeine Überlegungen: Diskursanalyse und/oder Ideologiekritik?
- B. Konkrete Durchführung
- III. Der Diskurs
- A. Das Thema „mediale Gewalt“ im Diskurs
- 1. Vom Medienkonsum zur Medienwirkung
- 2. Ausdifferenzierung des Wirkungsgedankens durch Annahme eines multifaktoriellen Wirkungszusammenhangs
- 3. Kritik am Gedanken einer Medienwirkung
- 4. Wirken Medien oder wirken sie nicht? Versuch einer Antwort auf eine falsch gestellte Frage
- a) Exkurs: die Subjektivitätskonzeption der Kritischen Psychologie und ihre methodologischen Konsequenzen
- b) Die Widersprüchlichkeit der Medienwirkungsforschung und ihre begründungstheoretische Aufhebung
- 5. Zusammenfassung: Der Medien-Diskurs als doppelte Enteigentlichung realer Begründungsprämissen
- B. Das Thema „Täterpersönlichkeit“ im Diskurs
- 1. Die Pathologie des Täters als moralistischer Fehlschluss oder: was nicht sein kann, weil es nicht sein darf
- 2. Der Amokläufer als „narzisstische Persönlichkeit“
- 3. Biografische Entwicklungskonstruktionen als Tataufschluss?
- 4. Implikationen des Persönlichkeitsbegriffs
- 5. Zusammenfassung: Die „Täterpersönlichkeit“ als Suspendierung von Welt
- C. Das Thema „Schule“ im Diskurs
- 1. Programmatische Überlegungen zur Schulreformdiskussion nach dem Amoklauf von Erfurt
- a) Die Lehrerseite: Kritik an der zu fachwissenschaftlichen Lehrerausbildung, die zu wenig Pädagogik/Psychologie beinhalte
- b) Die Schülerseite: „Erziehung zu Selbstbewusstsein“, „soziales Lernen“ und „schülerorientierter Unterricht“ unter der Prämisse schulischer Bewertungsuniversalität?
- Die Schulseite allgemein: Verbesserung des Schulklimas durch die unmittelbar Beteiligten unter der Prämisse neoliberaler Hegemonie?
- 2. Die Schule als Gegenstand der Kritik
- a) Kritik am thüringenschen Schulsystem: Kein Abitur = Kein Abschluss?
- b) Allgemeine Kritik am bundesdeutschen Schulsystem
- 3. Zusammenfassung: Die Schule als Gewaltpräventionsinstitution unter der Prämisse universeller Bewertung und allgemeinem Selektionsauftrag
- 1. Programmatische Überlegungen zur Schulreformdiskussion nach dem Amoklauf von Erfurt
- A. Das Thema „mediale Gewalt“ im Diskurs
- IV. Zusammenfassung: Der Amoklauf von Erfurt als diskursives Ereignis im Spannungsfeld zwischen Kritikabwehr und konstruktiver Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den öffentlichen Diskurs um den Amoklauf von Erfurt im Jahr 2002. Ziel ist es, die Widersprüche und Ungereimtheiten in der medialen Berichterstattung und den öffentlichen Reaktionen aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf die Konstruktion der „medialen Gewalt“, die „Täterpersönlichkeit“ und die Rolle der „Schule“ im Diskurs.
- Die Konstruktion von Mediengewalt und deren Wirkung
- Die Darstellung der Täterpersönlichkeit und die damit verbundenen moralischen Urteile
- Kritik am deutschen Schulsystem im Kontext des Amoklaufs
- Der Diskurs als Mechanismus der Kritikabwehr und konstruktiven Kritik
- Die Widersprüchlichkeit des öffentlichen Diskurses
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Amoklauf von Erfurt und seine weltweite Wirkung. Sie hebt die Schockwirkung des Ereignisses hervor und stellt den Kontext im Hinblick auf die damalige PISA-Studie und die darauf folgende Krise des deutschen Bildungssystems dar. Der Begriff „Amoklauf“ wird kritisch hinterfragt und seine vielschichtige Bedeutung im öffentlichen Diskurs beleuchtet. Die Autorin/der Autor kündigt die methodische Vorgehensweise an und erläutert die Bedeutung des gewählten Ansatzes für die Untersuchung des Ereignisses.
II. Zur Methode: Dieses Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es werden die gewählten Methoden der Diskursanalyse und Ideologiekritik vorgestellt und ihre Anwendbarkeit auf den konkreten Fall des Amoklaufs von Erfurt begründet. Die konkreten Schritte der Analyse werden detailliert beschrieben, inklusive der Auswahl der Daten und der angewandten Analyseverfahren. Die methodischen Entscheidungen werden kritisch reflektiert und die damit verbundenen Limitationen transparent gemacht.
III. Der Diskurs: Dieses Kapitel analysiert den öffentlichen Diskurs um den Amoklauf von Erfurt, wobei die Themen „mediale Gewalt“, „Täterpersönlichkeit“ und „Schule“ im Fokus stehen. Es werden die verschiedenen Perspektiven und Argumentationslinien im Diskurs aufgezeigt und deren Widersprüche und Ungereimtheiten herausgearbeitet. Der Diskurs wird nicht nur deskriptiv dargestellt, sondern auch kritisch hinterfragt, indem die zugrundeliegenden Annahmen und Prämissen analysiert werden. Die Kapitel untersuchen, wie die drei genannten Themen im Diskurs konstruiert werden und welche Folgen diese Konstruktionen haben.
Schlüsselwörter
Amoklauf Erfurt, Diskursanalyse, Ideologiekritik, Mediengewalt, Täterpersönlichkeit, Schule, Bildungssystem, Gewaltprävention, öffentlicher Diskurs, Widersprüche, Kritikabwehr, konstruktive Kritik, Medienwirkung, Narzissmus, Schulreform.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Amoklaufs von Erfurt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den öffentlichen Diskurs um den Amoklauf von Erfurt im Jahr 2002. Sie untersucht die Widersprüche und Ungereimtheiten in der medialen Berichterstattung und den öffentlichen Reaktionen auf das Ereignis.
Welche Themen werden im Diskurs analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf drei zentrale Themen: die Konstruktion von „medialer Gewalt“, die „Täterpersönlichkeit“ und die Rolle der „Schule“ im Diskurs. Es wird untersucht, wie diese Themen konstruiert werden und welche Folgen diese Konstruktionen haben.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Methoden der Diskursanalyse und der Ideologiekritik. Es werden die konkreten Schritte der Analyse detailliert beschrieben, inklusive der Datenauswahl und der angewandten Analyseverfahren. Die methodischen Entscheidungen werden kritisch reflektiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Methode, ein Kapitel zur Diskursanalyse mit Fokus auf mediale Gewalt, Täterpersönlichkeit und Schule, und abschließend eine Zusammenfassung. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte und Unterabschnitte.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit zeigt die Widersprüche und Ungereimtheiten im öffentlichen Diskurs um den Amoklauf von Erfurt auf. Sie analysiert, wie die drei genannten Themen (mediale Gewalt, Täterpersönlichkeit, Schule) konstruiert werden und welche Folgen diese Konstruktionen haben. Der Diskurs wird als Spannungsfeld zwischen Kritikabwehr und konstruktiver Kritik dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Amoklauf Erfurt, Diskursanalyse, Ideologiekritik, Mediengewalt, Täterpersönlichkeit, Schule, Bildungssystem, Gewaltprävention, öffentlicher Diskurs, Widersprüche, Kritikabwehr, konstruktive Kritik, Medienwirkung, Narzissmus, Schulreform.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Widersprüche und Ungereimtheiten in der medialen Berichterstattung und den öffentlichen Reaktionen auf den Amoklauf von Erfurt aufzuzeigen und zu analysieren. Die Arbeit untersucht, wie der Diskurs zur Konstruktion von Wirklichkeit beiträgt und welche Implikationen dies hat.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, welche die Kernaussagen und die methodische Vorgehensweise in jedem Kapitel detailliert beschreiben. Die Zusammenfassungen geben einen umfassenden Überblick über die Inhalte der einzelnen Kapitel.
- Quote paper
- Florian Bödecker (Author), 2004, Der Amoklauf von Erfurt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166383