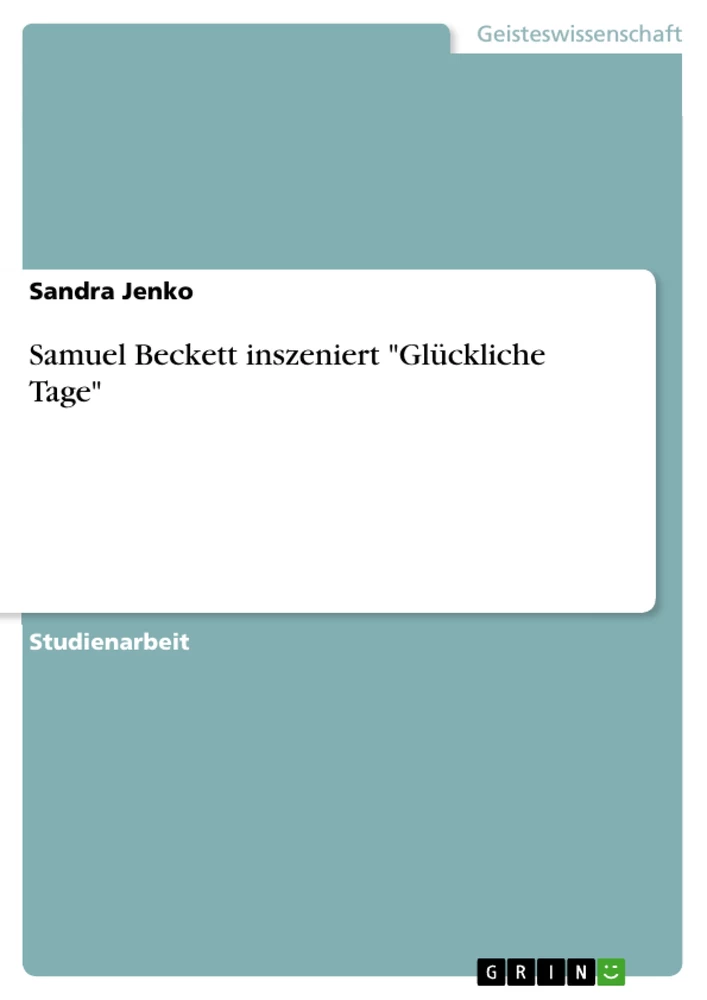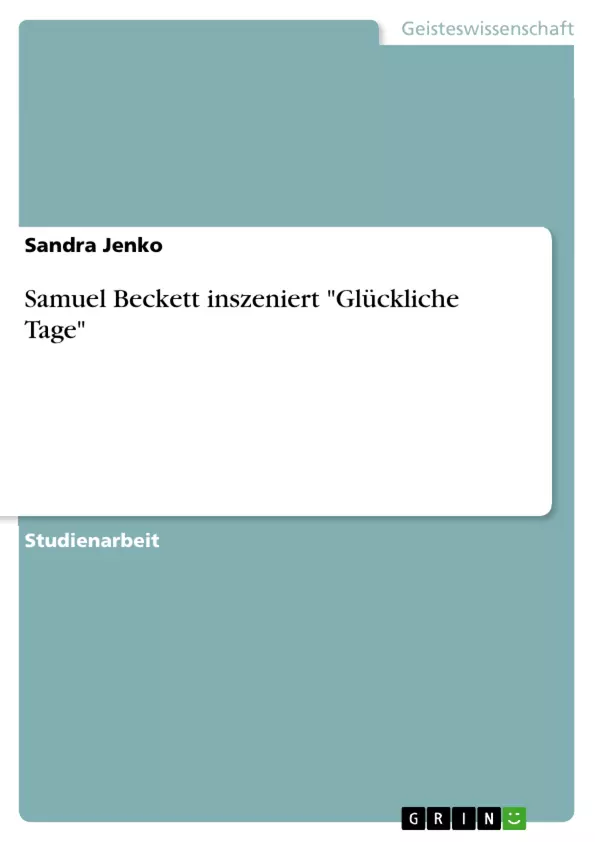Diese Referatsausarbeitung betrachtet Samuel Becketts Regietätigkeit, vor allem am Beispiel seiner Inszenierung von "Glückliche Tage" am Berliner Schiller-Theater im Jahr 1971 und im Vergleich zur Londoner Inszenierung des gleichen Stückes im Jahr 1979. Dabei interessieren vorrangig Becketts Herangehensweise und sein Umgang mit dem eigenen Stück.
Inhaltsverzeichnis
- Samuel Beckett als Regisseur
- Was bewegte Beckett dazu, seine eigenen Stücke zu inszenieren?
- Wie war Beckett als Regisseur?
- Die Berliner ,,Glückliche Tage\"- Inszenierung (1971)
- Wie kam es zur „Glückliche Tage\" - Inszenierung?
- Allgemeine Infos zur Inszenierung
- Becketts Vorbereitungen
- Becketts Regiearbeit am Schiller-Theater
- Die Londoner „Glückliche Tage“– Inszenierung (1979):
Besonderheiten, Parallelen und Unterschiede - Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht Samuel Becketts Regiearbeit am Beispiel seiner Inszenierung von „Glückliche Tage“. Er analysiert die Gründe, die Beckett dazu bewegten, selbst Regie zu führen, und beleuchtet seine Arbeitsweise und die Herausforderungen, die mit der Inszenierung seines eigenen Stücks verbunden waren.
- Becketts Motivation, seine eigenen Stücke zu inszenieren
- Becketts Arbeitsweise als Regisseur
- Die besondere Herausforderung der „Glückliche Tage“-Inszenierung
- Die Inszenierungsprozesse in Berlin und London im Vergleich
- Becketts Einfluss auf die Umsetzung seiner Stücke
Zusammenfassung der Kapitel
1. Samuel Beckett als Regisseur
Dieses Kapitel beleuchtet Becketts Motivation, selbst Regie zu führen. Es wird dargelegt, wie er zum einen auf Anfrage der Theater reagierte und zum anderen unzufrieden mit vielen Inszenierungen anderer Regisseure war. Beckett strebte nicht nach einer einzigen Interpretation, sondern forderte die Regisseure auf, seine Stücke nicht zu stark zu verändern. Er sah einen Unterschied zwischen Interpretation und Zerstörung seiner Werke. Beckett war überzeugt, dass er durch eigene Regie seine Stücke verbessern und Elemente wie Sprechweise und Tempo auf der Bühne ausprobieren konnte.
2. Die Berliner „Glückliche Tage“– Inszenierung (1971)
Das Kapitel beschreibt Becketts erste eigene Inszenierung von „Glückliche Tage“ am Berliner Schiller-Theater. Es werden die Vorbereitungen beleuchtet, die Beckett intensiv betrieb, einschließlich der Korrektur der deutschen Übersetzung, der Auswendiglernens des Textes und der Erstellung eines detaillierten Regiebuches. Dieses umfasste sogar Bewegungen des unsichtbaren Charakters Willie. Becketts präzise Arbeitsweise ist durch das Probenprotokoll seines Regieassistenten dokumentiert.
Schlüsselwörter
Samuel Beckett, Regie, „Glückliche Tage“, Inszenierung, Theater, Dramaturgie, Sprache, Bewegung, Tempo, Rhythmus, Emotion, Schauspiel, Regiebuch, Probenprozess, Berlin, Schiller-Theater, Übersetzung
Häufig gestellte Fragen
Warum inszenierte Samuel Beckett seine eigenen Stücke?
Beckett war oft unzufrieden mit den Interpretationen anderer Regisseure und wollte sicherstellen, dass Tempo, Rhythmus und Sprechweise seinen präzisen Vorstellungen entsprachen.
Wie bereitete sich Beckett auf die Berliner Inszenierung von „Glückliche Tage“ vor?
Er korrigierte die deutsche Übersetzung, lernte den Text auswendig und erstellte ein extrem detailliertes Regiebuch mit präzisen Bewegungsanweisungen.
Was ist das Besondere an der Inszenierung von „Glückliche Tage“?
Die Hauptfigur Winnie ist im Boden eingegraben, was extreme Anforderungen an die schauspielerische Leistung und die Regie bezüglich Sprache und Mimik stellt.
Wie unterschieden sich die Berliner (1971) und Londoner (1979) Inszenierungen?
Die Arbeit vergleicht Besonderheiten, Parallelen und Unterschiede in Becketts Herangehensweise über einen Zeitraum von acht Jahren.
Wie wurde Becketts Arbeitsweise am Theater dokumentiert?
Seine präzise Arbeit am Schiller-Theater ist unter anderem durch detaillierte Probenprotokolle seiner Regieassistenten belegt.
- Quote paper
- Mag. Sandra Jenko (Author), 2004, Samuel Beckett inszeniert "Glückliche Tage", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166412