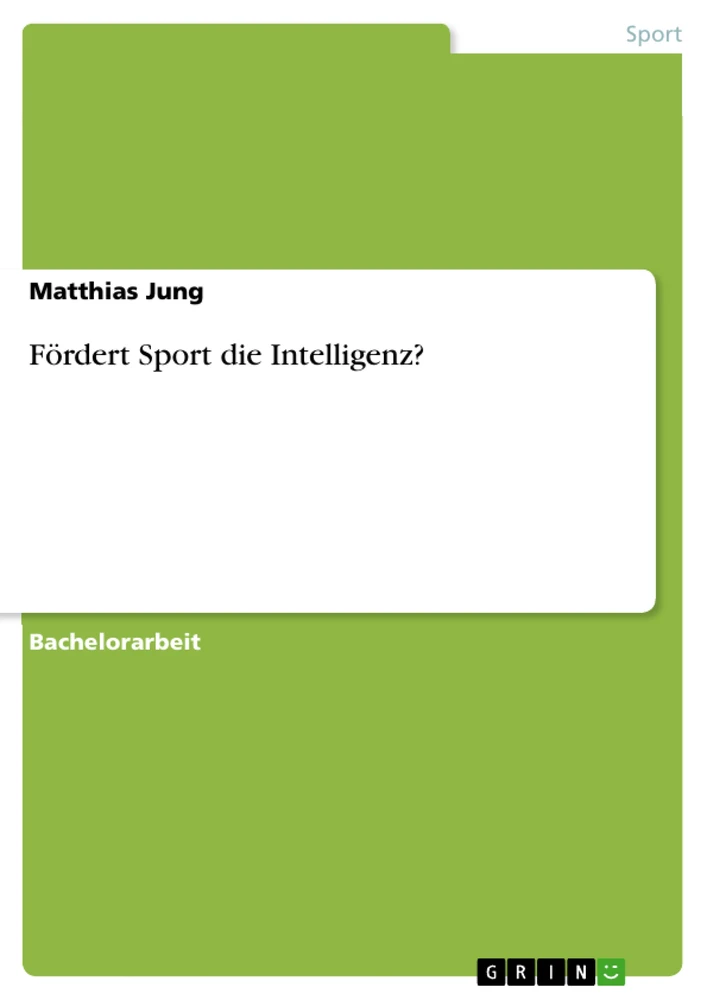Die Situation des Sportunterrichts an Schulen, besonders an Berufsschulen, ist sehr bedenklich, denn dem Fach wird, im Kanon mit den anderen Berufsschulfächern, nur ein sehr geringer Stellenwert eingeräumt. Während bei den Schülerinnen und Schülern statistisch gesehen, Sport das beliebteste Fach ist, so sind sich auf der anderen Seite besonders die Wirtschaftsverbände und Kammern größtenteils einig darüber, dass der Sportunterricht den berufsbezogenen Fächern weichen sollte. Dies führte dazu, dass die Sportstunden in unterschiedlicher Form und Intensität in einigen Bundesländern reduziert wurden. In Hamburg wurde der Sportunterricht zwischenzeitlich sogar gänzlich aus dem Berufsschulunterricht entfernt und durch das Gutscheinmodell ersetzt (vgl. Kuhfeld, 2000, S.24). In den allgemeinbildenden Schulen zeigt sich dies an der Tatsache, dass die dritte Sportstunde in vielen Bundesländern nicht gewährleistet wird. Ziel der Schulen ist es, den Intellekt der Kinder und Jugendlichen so zu fördern, dass sie ein erfolgreiches und selbstständiges Leben führen können. Dieses Ziel soll vor allem durch
Unterrichtsfächern, in denen eher die kognitiven als die motorischen Leistungen gefragt sind, erreicht werden. Dem Sportunterricht wird in diesem Zusammenhang nur wenig Bedeutung zuerkannt, was sich in der geringen wöchentlichen Stundenanzahl wiederspiegelt. Doch ist das eventuell ein Irrtum? Kann Sport nicht auch im gewissen Maße die Intelligenz fördern? Doch nicht nur für die Schule sollte diese Frage von Bedeutung sein, da der Mensch nicht nur in der Schule, sondern während seines ganzen Lebens auf seinen Intellekt angewiesen ist, um sich optimal in seiner Lebenswelt zurechtzufinden. Nach der Schule folgt das Berufsleben. Hier überwiegen in der heutigen Zeit mehr und mehr Berufe mit geringem Bewegungsanteil, bei denen mehr geistige Leistungen verlangt werden. Doch waren es früher eher Bandscheibenvorfälle, die häufig zu Berufsunfähigkeit führten, so sind es heute stressbedingte Depressionen, die sich negativ auf den Intellekt auswirken und ebenfalls zur Berufsunfähigkeit führen. Wie kann man dieser neuen Volkskrankheit entgegenwirken? Könnte neben medikamentöser Behandlung auch körperliche Betätigung ein Mittel sein, um Depressionen entgegenzuwirken? Im Rentenalter...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Intelligenz
- Messverfahren
- Lernen und Gedächtnis
- Bewegung und Sport
- Neurobiologischer Ansatz
- Das Gehirn lernt
- Wie lernt das Gehirn
- Die Plastizität des Gehirns
- Bewegungsneurowissenschaft
- Sport fördert die Gehirndurchblutung
- Sport fördert die Gehirnplastizität
- Sport hat Einfluss auf verschiedenste Neurotransmitter
- Fazit
- Psychologischer Ansatz
- Gibt es sportbedingte positive kognitive Veränderungen?
- Bei Älteren
- Bei Erwachsenen
- Bei Kindern und Jugendlichen
- Sport und ERP`s
- Sport fördert die exekutiven Funktionen
- Sport steigert das Wohlbefinden
- Das Übertrainingssyndrom
- Gibt es sportbedingte positive kognitive Veränderungen?
- Spezifische Interventionsinhalte und ihre kognitive Wirkung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht, ob sportliche Betätigung die Intelligenz fördern kann. Hierfür wird zunächst der Intelligenzbegriff definiert und beschrieben, wie Intelligenz gemessen werden kann. Anschließend wird die Entstehung von Intelligenz beleuchtet und untersucht, welche Faktoren sie beeinflussen können. Um zu prüfen, ob Sport diese Faktoren und damit die Intelligenz positiv beeinflussen kann, wird die Wirkung von Sport auf die neurobiologischen Vorgänge beim Lernen analysiert. Desweiteren wird untersucht, ob sportliche Betätigung sich auf die Psyche der Ausübenden auswirkt. Abschließend wird ergründet, ob es sportartspezifische Unterschiede in der Wirkung auf die Intelligenz gibt.
- Intelligenzbegriff und Messung
- Faktoren, die die Intelligenz beeinflussen
- Die Wirkung von Sport auf die neurobiologischen Prozesse beim Lernen
- Der Einfluss von Sport auf die Psyche
- Sportartspezifische Unterschiede in der Wirkung auf die Intelligenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Definition des Intelligenzbegriffs und beschreibt verschiedene Theorien und Messverfahren. Dabei werden auch die Zusammenhänge zwischen Lernen und Gedächtnis beleuchtet. Im Anschluss werden die verschiedenen Aspekte von Bewegung und Sport näher erläutert. Das Kapitel „Neurobiologischer Ansatz“ untersucht die neuronalen Prozesse im Gehirn, die für Lernen und Gedächtnis verantwortlich sind. Hier werden die Effekte von Sport auf die Gehirndurchblutung, die Gehirnplastizität und den Einfluss auf die Neurotransmitterkonzentration analysiert. Im „Psychologischen Ansatz“ werden die Ergebnisse von Verhaltensstudien zusammengefasst, die den Einfluss von Sport auf die kognitive Entwicklung in verschiedenen Altersgruppen untersuchen. Dabei werden auch die Auswirkungen von Sport auf die exekutiven Funktionen und das Wohlbefinden beleuchtet. Das Kapitel „Spezifische Interventionsinhalte und ihre kognitive Wirkung“ fasst die Ergebnisse von Interventionsstudien zusammen, die den Einfluss von verschiedenen Arten von Sport auf die kognitive Entwicklung untersuchen. Dabei werden auch die Effekte von kombinierten Trainingsformen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Intelligenz, Lernen, Gedächtnis, Sport, Bewegung, Neurobiologie, Psychologie, exekutiven Funktionen, Gehirnplastizität, Neurotransmitter, Übertraining, Interventionsstudien.
Häufig gestellte Fragen
Fördert Sport tatsächlich die Intelligenz?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass Sport neurobiologische Prozesse fördert, die sich positiv auf Lernen, Gedächtnis und kognitive Funktionen auswirken können.
Was ist Gehirnplastizität?
Gehirnplastizität bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, sich durch neue Erfahrungen und Reize (wie Bewegung) strukturell und funktionell zu verändern.
Welchen Einfluss hat Sport auf Neurotransmitter?
Körperliche Betätigung erhöht die Konzentration von Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin, was die Stimmung verbessert und die kognitive Leistungsfähigkeit steigert.
Können ältere Menschen durch Sport ihren Intellekt bewahren?
Studien belegen, dass regelmäßige Bewegung den altersbedingten Abbau kognitiver Fähigkeiten verlangsamen und das Wohlbefinden steigern kann.
Gibt es Gefahren durch zu viel Sport?
Die Arbeit warnt vor dem Übertrainingssyndrom, das sich negativ auf die Psyche und die körperliche Leistungsfähigkeit auswirken kann.
- Citation du texte
- Matthias Jung (Auteur), 2010, Fördert Sport die Intelligenz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166437