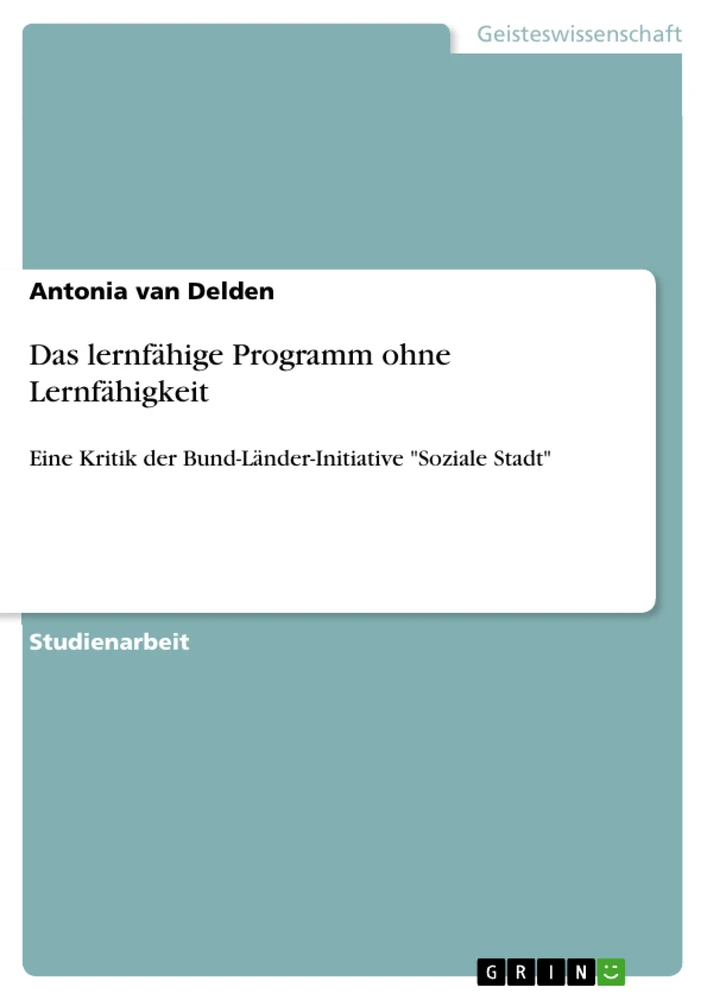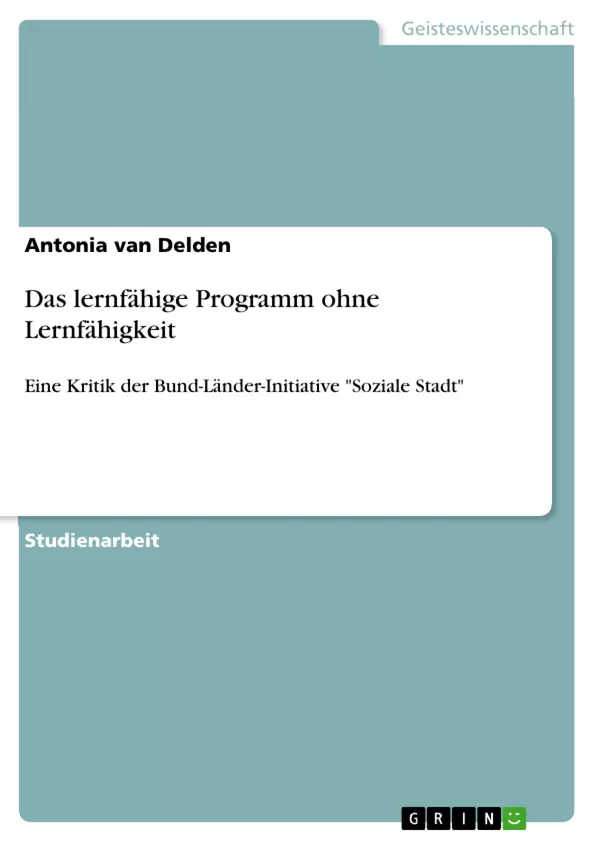Im Mai 1993 wird das Landesprogramm „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ als integriertes Handlungskonzept in Nordrhein-Westfalen (NRW) lanciert. Neben anderen internationalen Ansätzen soll es später als Vorläuferprogramm zum Bundesprogramm Soziale Stadt gelten. Dieses Bund-Länderprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ wird 1999 von der rot-grünen Bundesregierung ins Leben gerufen und stellt eine Reaktion auf die gestiegene soziale Polarisierung innerhalb deutscher Städte (Segregation) und den zunehmenden Bedeutungsgewinn des Sozialraumes für die individuellen Lebensentwicklung dar. Konnte das Programm seine Zielsetzung erreichen?
Das integrative Konzept hat ein experimentelles Projektdesign, das durch vielfache Evaluationen weiterentwickelt werden soll. In Hinblick auf bereits vorhandene Evaluationen soll in dieser Arbeit, nach einer knappen Vorstellung der Bund-Länder-Initiative Soziale Stadt, das Konzept in seiner bisherigen Form untersucht werden. Im Folgenden soll versucht werden Defizite aufzudecken, um dann in einem zweiten Schritt Handlungsempfehlungen formulieren zu können.
Die selektive Vorstellung und Einführung in das Konzept wird mit Fokus auf den Kern der Idee vorgenommen, der integrative Ansatz, der in dieser Arbeit variabel aufgefasst wird. Nicht nur ist damit der innovative Kern des Konzeptes, das integrierte Handlungskonzept, gemeint. Auch lässt sich das Stichwort Integration auf die Verbindung verschiedener Politikfelder beziehen. Gleichzeitig findet eine Integration unterschiedlicher Akteure im Quartier statt. Das Programm legt insoweit großen Wert auf die Verbindung von Gesamtstadt und benachteiligtem Quartier. Schlussendlich ist das Konzept auch eine Integration von Bund, Ländern und Kommunen. Diese Vielfalt des Integrationsbegriffes soll die Analyse leiten.
Das Programm lässt sich zudem aus zweierlei Perspektive betrachten. Anstatt der inhaltlichen Perspektive soll die instrumentell-strategische Perspektive bestimmender Rahmen der Analyse sein, um ein umfassendes Raster zur methodischen Bewertung des Programms zu haben. Des Weiteren wird der Schwerpunkt der Arbeiten auf der Umsetzung der Bund-Länder-Initiative liegen und nicht auf der Phase der Lancierung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung des Programms
- Defizite in der Umsetzung
- Empfehlungen und Perspektiven des Programms
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ wurde 1999 ins Leben gerufen, um auf die zunehmende soziale Polarisierung in deutschen Städten zu reagieren. Das Programm zielt darauf ab, die Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen zu verbessern, indem es verschiedene Politikfelder integriert und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren im Quartier fördert.
- Integrativer Handlungsansatz
- Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren
- Verbesserung der Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen
- Verstetigung von Projekten durch Quartiersmanagement
- Integration von Bund, Ländern und Kommunen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Programm „Soziale Stadt“ vor und skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, das Konzept des Programms zu untersuchen und Defizite aufzudecken. Das zweite Kapitel beschreibt das Programm detailliert und beleuchtet den integrativen Ansatz sowie die Einbindung verschiedener Akteure im Quartier. Das dritte Kapitel widmet sich den Defiziten in der Umsetzung des Programms und analysiert die Herausforderungen, die bei der Integration verschiedener Politikfelder und der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen auftreten.
Schlüsselwörter
Soziale Stadt, Stadtentwicklung, Benachteiligung, Integration, Quartiersmanagement, Föderalismus, Handlungskonzept, Projektdesign, Evaluation, Defizite, Empfehlungen, Perspektiven, Sozialraum, zivilgesellschaftliche Akteure, aktivierender Staat, Synergieeffekte, lernfähiges Programm.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Programm "Soziale Stadt"?
Ein 1999 gestartetes Bund-Länder-Programm zur Aufwertung benachteiligter Stadtteile und zur Bekämpfung sozialer Segregation.
Was bedeutet der "integrative Ansatz" in diesem Konzept?
Er verbindet verschiedene Politikfelder (z.B. Bau, Soziales, Wirtschaft) und bindet lokale Akteure sowie Bewohner direkt in die Stadtentwicklung ein.
Welche Rolle spielt das Quartiersmanagement?
Das Quartiersmanagement fungiert als Schnittstelle zwischen Verwaltung und Bürgern, um Projekte vor Ort zu steuern und zu verstetigen.
Welche Defizite wurden bei der Umsetzung festgestellt?
Herausforderungen liegen oft in der mangelnden Kooperation zwischen verschiedenen Ressorts und der Schwierigkeit, Projekte langfristig finanziell abzusichern.
Ist das Programm "lernfähig"?
Das Konzept sieht regelmäßige Evaluationen vor, um das experimentelle Projektdesign an neue Erkenntnisse und Bedürfnisse anzupassen.
- Quote paper
- Antonia van Delden (Author), 2010, Das lernfähige Programm ohne Lernfähigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166441