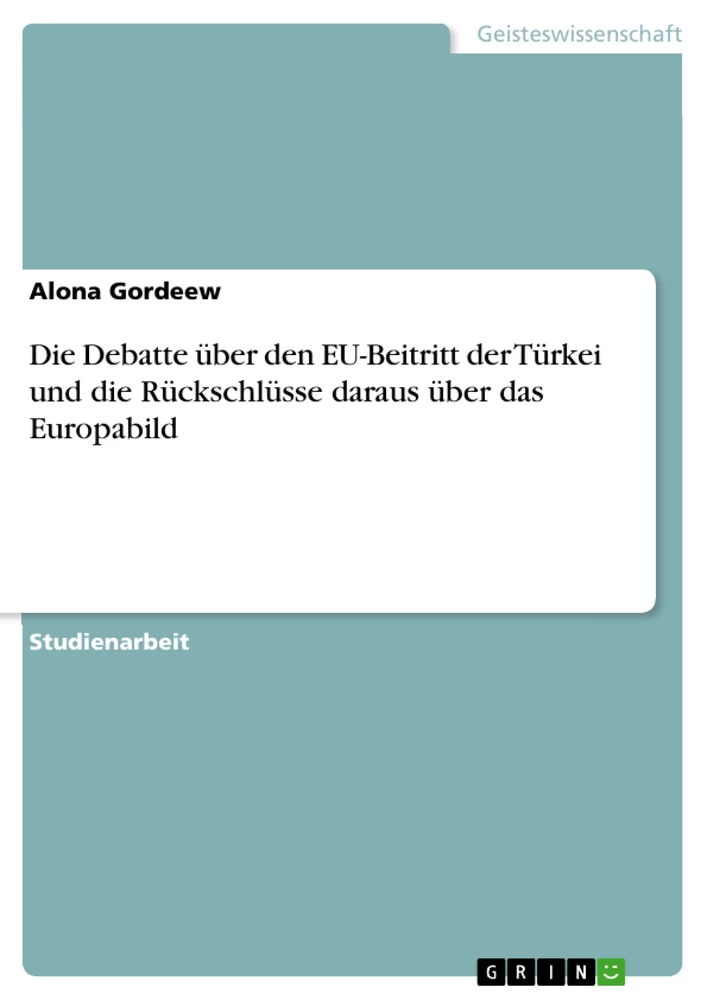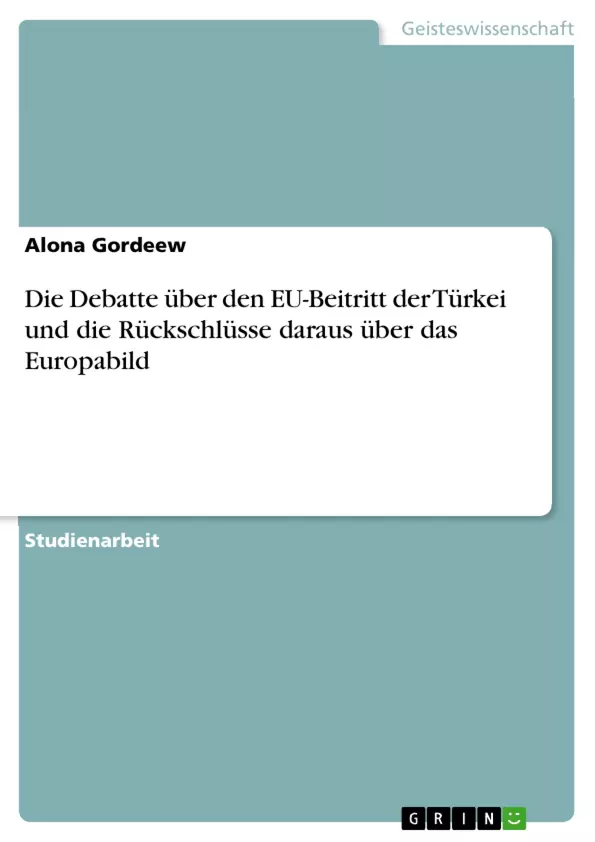Am 17. Dez. 2004 haben die europäischen Mitgliedsstaaten nach vierzigjährigen Beitrittsbemühungen der Türkei einstimmig den Beginn der Beitrittsverhandlungen beschlossen, wobei ein Beitritt um das Jahr 2015 angestrebt wird. Wenn die Türkei gegen Vorgaben verstößt, können die Gespräche abgebrochen werden. Doch bisher haben solche Verhandlungen stets zur Aufnahme des Kandidaten geführt.
Trotz der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen führt der mögliche Beitritt weiterhin auf EU-Ebene, im zwischenparteilichen sowie im innerparteilichen Diskurs zu heftigen Debatten. Kein anderes Beitrittsland hat bisher eine so große Beachtung wie die Türkei erfahren. Dies könnte daran liegen, dass der angehende Beitritt deutlich macht, dass es keine einheitliche Vorstellung von der EU gibt. Vielmehr hat das EU-Konzept viel Interpretationsspielraum gelassen. Manche Vorstellungen ergänzen sich, andere schließen sich gegenseitig aus. Interessant ist, dass oft Gegner und Befürworter dieselbe Idee von der Natur der EU vertreten, jedoch die einen mit der Türkei im Boot und die anderen ohne. Diese verschiedenartigen Vorstellungen der EU spiegeln sich in den Argumentationen wider und sollen in diesem Werk deutlich gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bisherige Entwicklung der EU-Türkei Beziehungen
- Zum Konzept der Argumentationslinie
- Vorpolitische Argumentation
- Geographische Kriterien
- Historisch-kulturelle Kriterien
- Religiöse Kriterien
- Die Europäische Identität als Kriterium
- Politische und geostrategische Argumentation
- Die Innenpolitische Situation in der Türkei als Kriterium
- Ökonomische Kriterien
- Geostrategische Kriterien
- Europapolitische Kriterien
- Demographische und migrationspolitische Kriterien
- Die Folgen einer Absage als Kriterium
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um den EU-Beitritt der Türkei und analysiert die zugrundeliegenden Argumentationslinien. Sie beleuchtet das Europabild, das sich aus den verschiedenen Argumenten herauskristallisiert, und zeigt auf, wie sich dieses Bild zwischen Befürwortern und Gegnern des türkischen Beitritts unterscheidet.
- Entwicklung der EU-Türkei Beziehungen
- Argumentationslinien für und gegen den Beitritt
- Europabild im Kontext der Beitrittsdebatte
- Politische und geostrategische Aspekte des Beitritts
- Kulturelle und religiöse Identitätsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel erläutert den aktuellen Stand der Beitrittsverhandlungen und betont die kontroversen Diskussionen um den möglichen Beitritt der Türkei.
- Bisherige Entwicklung der EU-Türkei Beziehungen: Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union wird anhand der verschiedenen Phasen der Zusammenarbeit, vom Assoziierungsabkommen bis zum Kandidatenstatus, nachgezeichnet.
- Zum Konzept der Argumentationslinie: Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Kategorien der Argumentationslinien vor, die in der Beitrittsdebatte verwendet werden.
- Vorpolitische Argumentation: Hier werden die verschiedenen Argumente vorgestellt, die sich auf geographische, historisch-kulturelle, religiöse und identitätsbezogene Aspekte des Beitritts beziehen.
- Politische und geostrategische Argumentation: Dieses Kapitel behandelt Argumente, die sich auf die innenpolitische Situation in der Türkei, ökonomische Kriterien, geostrategische Überlegungen, europapolitische Aspekte und die Folgen einer möglichen Ablehnung konzentrieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem EU-Beitritt der Türkei, den Argumentationslinien in der Beitrittsdebatte, dem Europabild, der kulturellen und religiösen Identität, der politischen und geostrategischen Bedeutung der Türkei und dem Konzept der europäischen Integration.
Häufig gestellte Fragen
Wann begannen die offiziellen EU-Beitrittsverhandlungen der Türkei?
Die EU-Mitgliedstaaten beschlossen am 17. Dezember 2004 einstimmig den Beginn der Beitrittsverhandlungen.
Welche geographischen Argumente werden in der Debatte genutzt?
Kritiker führen oft an, dass nur ein kleiner Teil der Türkei auf dem europäischen Kontinent liegt, während Befürworter die Brückenfunktion betonen.
Welche Rolle spielt die Religion bei der Argumentation?
Religiöse Kriterien werden häufig genutzt, um über die Vereinbarkeit islamischer Traditionen mit einem christlich geprägten Europa zu diskutieren.
Was sind die wichtigsten geostrategischen Argumente?
Dazu gehören die Bedeutung der Türkei als Sicherheitsakteur in der Region und die potenziellen Folgen einer Absage an das Land.
Was sagt die Debatte über das "Europabild" aus?
Die Arbeit zeigt, dass es keine einheitliche Vorstellung von der EU gibt; der Fall Türkei macht deutlich, wie unterschiedlich Konzepte der europäischen Identität interpretiert werden.
- Arbeit zitieren
- Alona Gordeew (Autor:in), 2008, Die Debatte über den EU-Beitritt der Türkei und die Rückschlüsse daraus über das Europabild, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166468