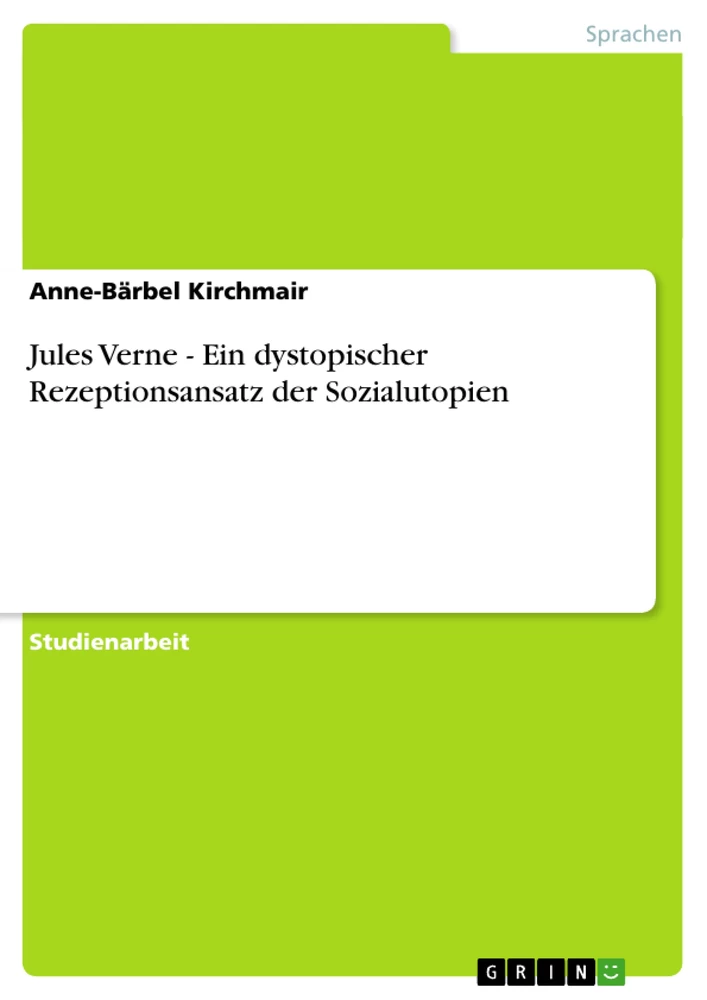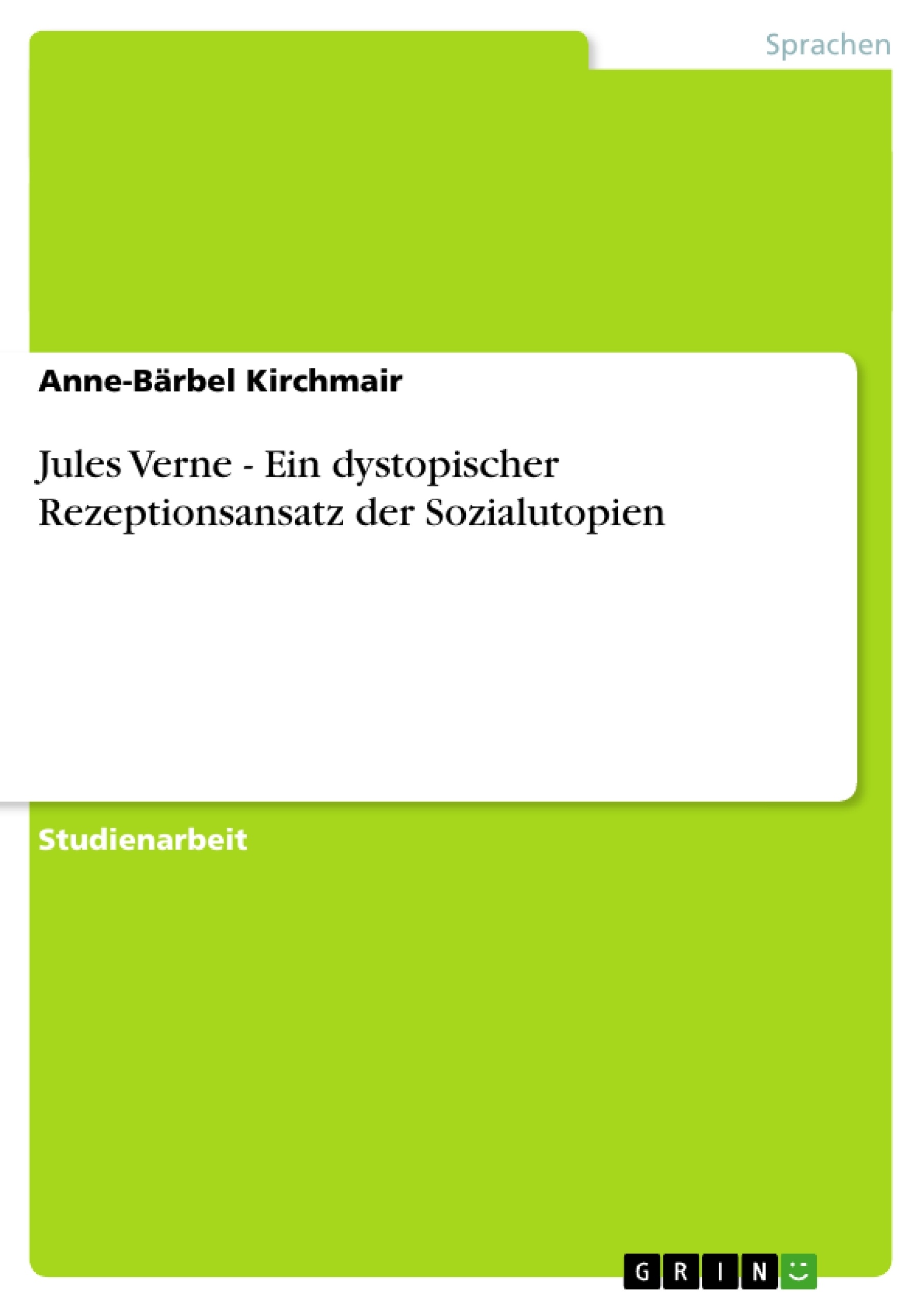Mit dem ausklingenden 18. Jahrhundert bricht für Frankreich eine Zeit bedeutsamer
politischer, ökonomischer und sozialer Umwälzungen an. Die französische Revolution
besiegelt das Ende des Ancien régime, eines Ordnungsmodells, das über Jahrhunderte hinweg
dem Einzelnen seinen Platz in der Gesellschaft zugewiesen, gesichert hatte. Es gelingt der
Restauration im folgenden nicht, die Eigendynamik dieses Prozesses zu stoppen; in der
Julirevolution erreicht er seinen vorläufigen Kulminationspunkt.
Im Zuge dieser Erschütterungen werden die politischen Karten neu gemischt, den Zeichen der
Zeit gemäß – Frankreich steht an der Schwelle zur Industrialisierung – steigt das Finanz- und
Wirtschaftsbürgertum zur staatstragenden Schicht auf. Rasch zeitigt die Devise des
Enrichissez-vous! mit all ihren sozialen Härten jedoch Widerstand und Gegenbewegungen,
deren Einfluß auf den politischen Diskurs des 19. Jahrhunderts nicht unterschätzt werden darf:
Hier sei besonders auf die frühsozialistischen Strömungen verwiesen.
In Opposition zum bestehenden System greifen diese auf ein bewährtes Mittel der
Gegenwartskritik zurück: Die Fiktion eines idealen, auf Egalität basierenden Gemeinwesens,
wie es unter anderem in La Ville nouvelle, ou le Paris des Saint-Simoniens sowie – zehn Jahre
später– in Le Voyage en Icarie von Etienne Cabet zum Ausdruck kommt. Als
Hoffnungsträger gelten den Frühsozialisten die Errungenschaften der modernen Technik,
mittels derer sie alle dringlichen sozialen Probleme zu bewältigen gedenken.
Setzen die Sozialutopien den Akzent eindeutig auf die Gestaltung eines besseren, gerechteren
und freieren Gesellschaftswesens, so bringen sie indes einen bedeutenden Wandel in der
Begriffsgeschichte der Utopie in Gang: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gilt der Terminus
„Schimäre“ als Synonym für den der„Utopie“. Parallel zu dieser Entwicklung treten auch die
ersten „Mahner“ auf den Plan, die den Optimismus der „Sozialutopisten“ nicht zu teilen
vermögen und statt dessen ein Schreckensszenario der Unfreiheit, ja Versklavung des
Einzelnen entwerfen: Die Antiutopie als Gegenreaktion auf die allzu hoffnungsfrohe
Sozialutopie ist geboren.
Vor diesem Hintergrund gewinnt auch das Werk Jules Verne’s neue Tiefe und Bedeutung.
Seiner literarischen Beeinflussung durch die genannten Strömungen nachzuspüren und deren
Tragweite für einen kleinen Teil seines OEuvre zu erfassen, sei Ziel dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Hintergrund: Frühsozialistische Konzeptionen
- Der Saint-Simonismus und seine Ausläufer
- Der Cabetismus als urkommunistisches Modell
- Paris au XXe siècle – Ideologiekritik des Saint-Simonismus
- Die Hypertrophierung von Industrie- und Finanzwelt
- Die Liquidierung der Kunst und das Schicksal des Künstlers
- Les Cinq cents millons de la Bégum - Das Experimentierfeld der Science…
- Stahlstadt und France-Ville als idealtypische Versuchsanordnung
- Die vernesche Synthese
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die literarische Beeinflussung von Jules Verne durch frühsozialistische Konzeptionen zu untersuchen und deren Tragweite für einen kleinen Teil seines Œuvre zu erfassen.
- Frühsozialistische Strömungen und ihre Kritik am bestehenden System
- Der Saint-Simonismus und seine Forderung nach gesellschaftlicher Erneuerung
- Die Rolle der Technik in der Gestaltung eines idealen Gemeinwesens
- Die Entwicklung der Utopie und die Entstehung der Antiutopie
- Die literarische Auseinandersetzung Jules Vernes mit sozialutopischen Themen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die politische, ökonomische und soziale Situation Frankreichs im ausgehenden 18. Jahrhundert ein und stellt den historischen Kontext für die Entstehung frühsozialistischer Strömungen dar. Kapitel 2 analysiert den Saint-Simonismus und seine Weiterentwicklung durch seine Schüler, mit besonderem Fokus auf die Rolle der Industrie und der Finanzwelt in der Gestaltung der neuen Gesellschaftsordnung. Kapitel 3 widmet sich der Kritik am Saint-Simonismus durch die Figur des „Künstlers“ in Jules Vernes „Paris au XXe siècle“. Schließlich befasst sich Kapitel 4 mit dem Werk „Les Cinq cents millons de la Bégum“ und untersucht die Darstellung von Stahlstadt und France-Ville als idealtypische Versuchsanordnungen in Jules Vernes sozialutopischen Visionen.
Schlüsselwörter
Frühsozialismus, Saint-Simonismus, Utopie, Antiutopie, Technik, Gesellschaft, Industrialisierung, Kunst, Literatur, Jules Verne, Paris au XXe siècle, Les Cinq cents millons de la Bégum.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte der Frühsozialismus auf Jules Verne?
Verne setzte sich in seinem Werk intensiv mit frühsozialistischen Ideen wie dem Saint-Simonismus und Cabetismus auseinander, oft als kritische Reflexion.
Was kritisiert Verne in „Paris im 20. Jahrhundert“?
Er entwirft eine Antiutopie, in der Industrie und Finanzwelt dominieren, während Kunst und Kultur liquidiert werden und der Einzelne in Unfreiheit lebt.
Was sind Stahlstadt und France-Ville?
In „Die 500 Millionen der Begum“ stellt Verne zwei gegensätzliche Modelle dar: die militaristische, industrielle Stahlstadt und die ideale, humanistische Stadt France-Ville.
Wie veränderte sich der Begriff der Utopie im 19. Jahrhundert?
Gegen Ende des Jahrhunderts wandelte sich der Optimismus der Sozialutopien oft in Skepsis, und die Antiutopie (Dystopie) entstand als warnende Gegenreaktion.
Welche Rolle spielt die Technik in Vernes Sozialutopien?
Technik gilt einerseits als Hoffnungsträger zur Lösung sozialer Probleme, wird bei Verne aber auch als Instrument der Unterdrückung kritisch hinterfragt.
Was ist der „Cabetismus“?
Ein urkommunistisches Modell von Étienne Cabet, das auf vollkommener Gleichheit basiert und als Vorlage für viele utopische Entwürfe der Zeit diente.
- Citar trabajo
- Anne-Bärbel Kirchmair (Autor), 2001, Jules Verne - Ein dystopischer Rezeptionsansatz der Sozialutopien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16650