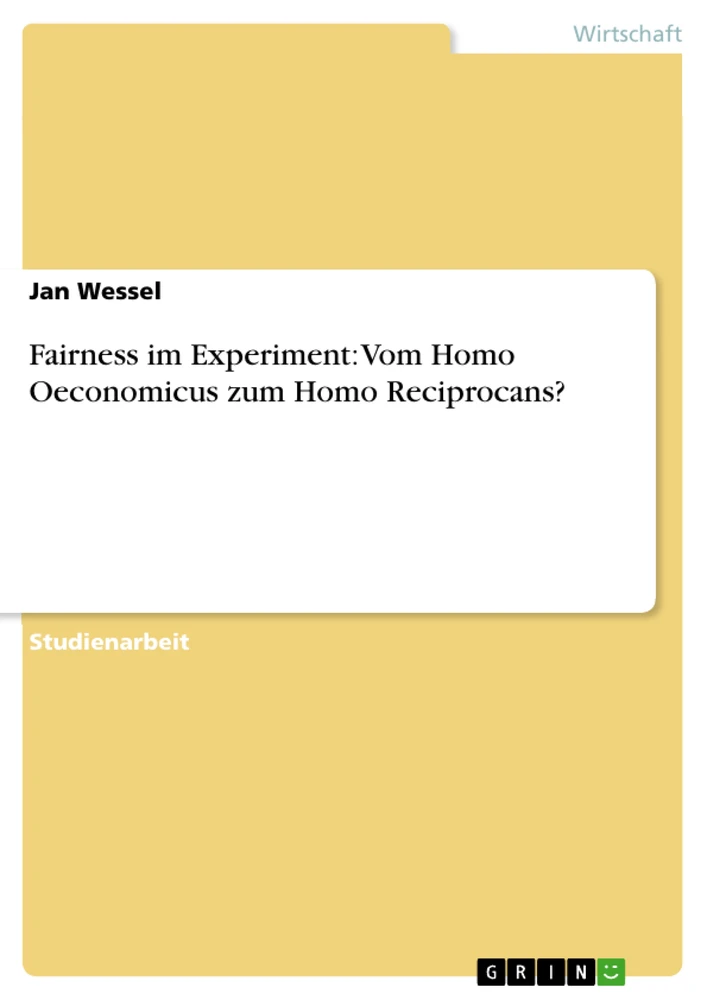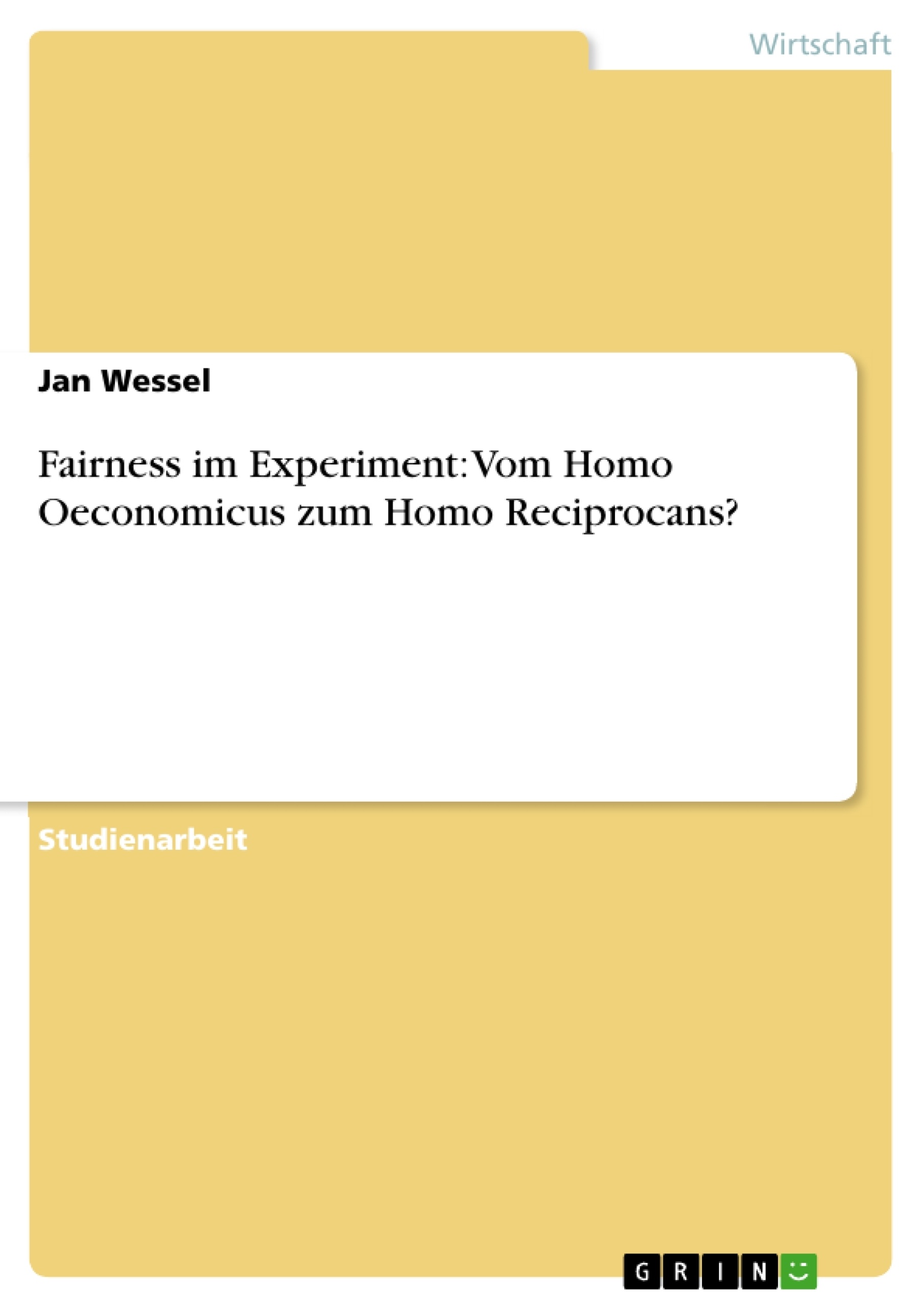Menschen sind vor allem eigennützig! Diese Annahme ist die Grundlage für wesentliche
Theorien der Wirtschaftswissenschaften. Gleichzeitig stößt diese Annahme aber
auch immer wieder auf Protest. Dieses Menschenbild scheint nicht nur gegen ein
Wunschbild zu verstoßen, sondern es kann auch vermutlich jeder Mensch von Situationen
berichten, in denen sich andere Menschen tatsächlich nicht eigennützig verhalten
haben. So tauschen Menschen Geschenke aus und belohnen einander für positives
Verhalten. Auf der anderen Seite kann man aber auch beobachten, wie schlechtes
Verhalten bestraft wird, obwohl das dem Strafenden keinen erkennbaren Nutzen bringt.
Diese Beobachtungen sind nur schwer mit dem traditionellen wirtschaftswissenschaftlichen
Modell des Homo Oeconomicus zu vereinbaren. Daher wird im Folgenden untersucht
werden, ob ein anderes Modell menschliches Verhalten nicht besser modellieren
kann. Dabei stützt sich diese Arbeit im wesentlichen auf die Experimentelle
Wirtschaftsforschung, mit deren Hilfe menschliches Verhalten unter kontrollierten Bedingungen
erforscht werden kann. Im Folgenden werden einige Experimente beschrieben
und aus ihnen einige allgemeine Erkenntnisse abgeleitet. Dann sollen die
wesentlichen Theorien, die versuchen, dieses Phänomens zu erfassen, erläutert und
kritisch betrachtet werden. Abschließend soll grundsätzlich Stellung genommen werden
zu dem Ansatz, die Reziprozität in die wirtschaftswissenschaftliche Theorie einzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der ,,Homo Oeconomicus“ und seine Kritik
- Reziprozität
- Experimentelle Wirtschaftsforschung
- Experimente und Ergebnisse
- Ultimatumspiel
- Marktexperimente
- Öffentliche Güter
- Formale Modelle
- Die Verteilungshypothese
- ERC Das Modell von Ockenfels und Bolton
- Eine Theorie von Fairness, Wettbewerb und Cooperation - Das Modell von Fehr und Schmidt
- Vergleich der beiden Modelle
- Die Intentionshypothese
- Die Verteilungshypothese
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob das traditionelle wirtschaftswissenschaftliche Modell des Homo Oeconomicus, das von einem ausschließlich eigennützigen Individuum ausgeht, menschliche Verhaltensweisen in allen Situationen adäquat abbilden kann. Die Arbeit analysiert experimentelle Befunde aus der Wirtschaftsforschung, die Hinweise auf ein reziprokes Verhalten von Menschen liefern, d. h. auf das Belohnen von fairem und das Bestrafen von unfairem Verhalten.
- Kritik am Homo Oeconomicus Modell
- Reziprozität als alternatives Modell
- Experimentelle Ergebnisse zur Reziprozität
- Formale Modelle der Reziprozität
- Einordnung der Reziprozität in die wirtschaftswissenschaftliche Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein und stellt die Problematik des Homo Oeconomicus Modells in den Vordergrund. Kapitel 2 befasst sich mit dem traditionellen Modell des Homo Oeconomicus und seiner Kritik. Kapitel 3 definiert den Begriff der Reziprozität und unterscheidet reziprokes Verhalten von egoistischem und altruistischem Verhalten. Kapitel 4 gibt eine Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung als Methode zur Untersuchung menschlichen Verhaltens. In Kapitel 5 werden einige Experimente und ihre Ergebnisse vorgestellt, die Hinweise auf reziprokes Verhalten liefern. Kapitel 6 diskutiert verschiedene formale Modelle, die versuchen, das Phänomen der Reziprozität zu erklären.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Homo Oeconomicus, Reziprozität, Experimentelle Wirtschaftsforschung, Fairness, Ultimatumspiel, Marktexperimente, Öffentliche Güter, Verteilungshypothese, Intentionshypothese.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Homo Oeconomicus“?
Ein theoretisches Modell des Menschen als rein rationaler, eigennütziger Nutzenmaximierer, das die Basis vieler wirtschaftswissenschaftlicher Theorien bildet.
Was versteht man unter Reziprozität?
Reziprozität bedeutet „Gegenseitigkeit“: Menschen belohnen faires Verhalten und bestrafen unfaires Verhalten, selbst wenn dies für sie keinen direkten materiellen Nutzen hat.
Was zeigt das Ultimatumspiel?
In diesem Experiment lehnen viele Menschen unfaire Angebote ab, obwohl sie dadurch Geld verlieren. Dies widerlegt das Modell des rein eigennützigen Homo Oeconomicus.
Was ist der „Homo Reciprocans“?
Ein alternatives Menschenbild, das davon ausgeht, dass menschliches Handeln stark von Fairnessnormen und dem Verhalten des Gegenübers geprägt ist.
Welche Rolle spielt die Intentionshypothese?
Sie besagt, dass Menschen nicht nur das Ergebnis einer Handlung bewerten, sondern auch die Absicht (Intention) dahinter, was ihr reziprokes Verhalten beeinflusst.
- Quote paper
- Jan Wessel (Author), 2009, Fairness im Experiment: Vom Homo Oeconomicus zum Homo Reciprocans?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166645