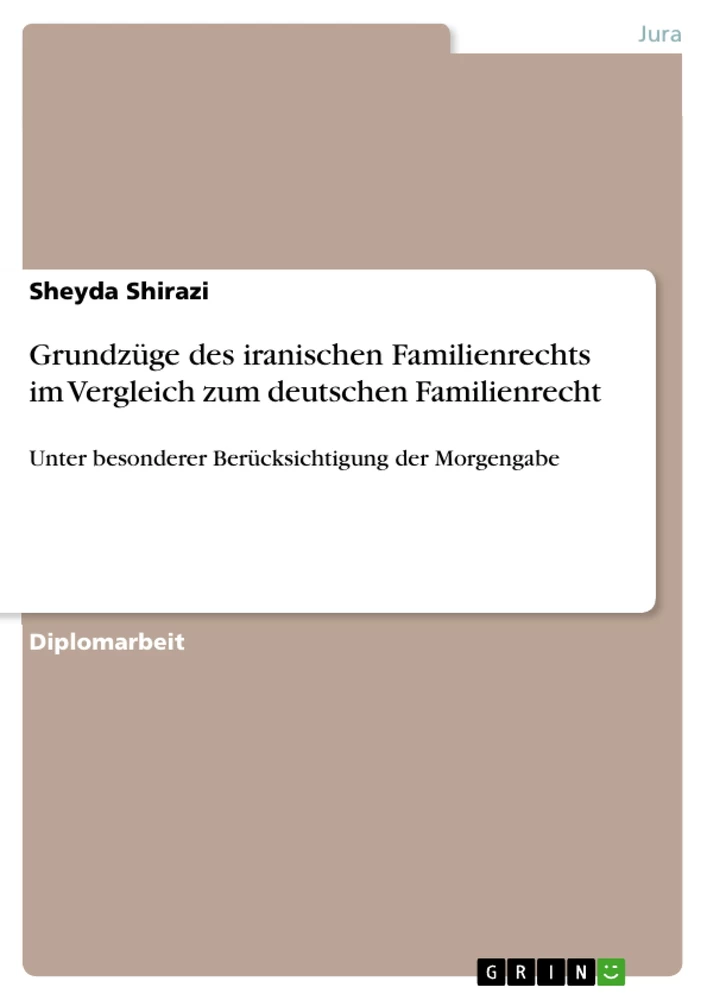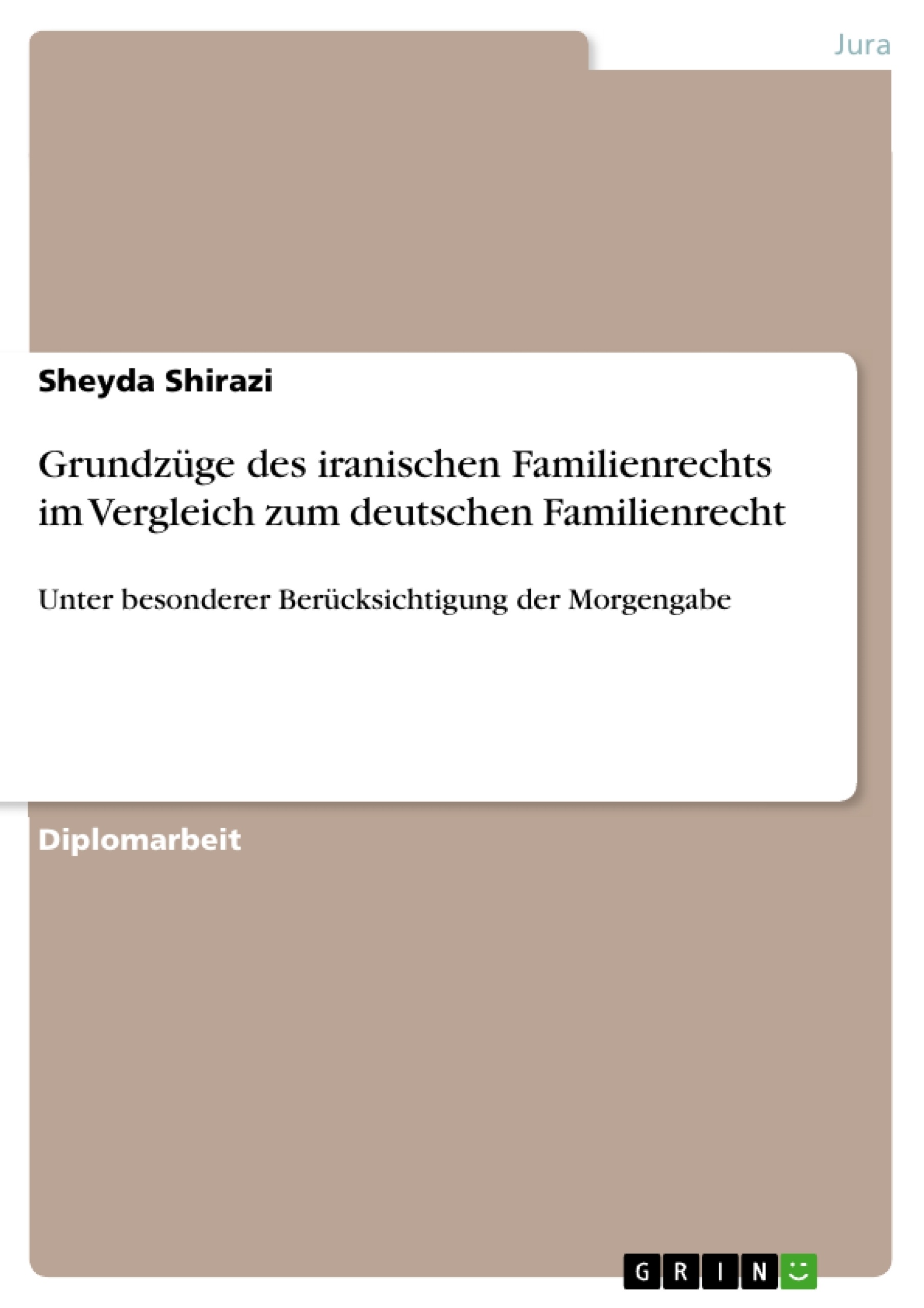„Das iranische Recht stellt sich heute als eine Mischung zwischen traditionellem Gewohnheitsrecht, unkodifiziertem islamischen Recht und positivem, staatlich gesetztem Recht dar, ist also durch Rechtspluralismus gekennzeichnet“.
Iran ist ein islamisches Land, in dem seit über 1400 Jahren Islam herrscht. Die islamische Weltanschauung, die hauptsächlich aus Koran und anderen theologischen Büchern zu interpretieren sind, wurde in Laufe der vergangen 1400 Jahre ein großer Teil der Iranischen Rechtsgeschichte geworden. Die Regelungen des Islam sind als Norm oder Gewohnheitsrecht zu sehen. Diese Regelungen sind Teil des Alltagslebens der Iraner und werden seit Jahren praktiziert.
In der Monarchischen Geschichte des Iran gab es keine exekutive oder Judikative.
Der Monarch bzw. König war der allmächtigste Gesetzgeber für Adler und Untertanen. Die Konflikte und Streiten zwischen Untertanten waren in traditionelle islamische Gerichte, also nach Koran durch einen islamischen Richter zu lösen.
Seit den 20er2 Jahren des letzten Jahrhunderts, ist im Iran das traditionelle islamische Gericht abgeschafft worden. Das erste bürgerliche Buch war eine Mischung von französischem und belgischem Zivilbuch mit islamischen Regelungen. Im Laufe des Jahres und vor allem nach der islamischen Revolution im Jahre 1979 wurden die islamischen Regelungen von größerer Bedeutung, so dass das heutige Zivilgesetzbuch als islamisch- iranisches Zivilgesetzbuch zu bezeichnen ist.
Somit ist Koran als einzige Rechtsquelle des iranischen Zivilgesetzbuches zu sehen.
Das Iranische Rechtssystem ist Religionsabhängig und könnte sich nicht von dem islamischen Recht ausweichen. Also alle wichtigsten Gesetze sind aus dem Koran zu interpretieren. Wenn der Gesetzgeber beispielsweise keine Rechtsquellen aus dem Koran oder andere theologisch anerkannten Bücher finden kann, dann hat er nach dem Ermessen zu entscheiden. Dieser Ermessenspielraum ist auch von islamischen erste schiitische Imam .
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Aufbau und Inhalt der Arbeit
- II. Das Familienrecht im Iran
- 2.1 Allgemeines
- 2.2 Iranisch-islamisches Recht
- 2.2.1 Rechtsquellen
- 2.2.2 Begriffserläuterung
- 2.2.2.1 Familie (Khanewadeh)
- 2.2.2.2 Ehe (Nekah)
- 2.3 Das Eherecht
- 2.3.1 Allgemeines
- 2.3.2 Richtigkeit der Eheschließung
- 2.3.2.1 Die Ehefähigkeit
- 2.3.2.1.1 Die Ehefähigkeit nach Islam
- 2.3.2.1.2 Ehefähigkeit nach iranischem Recht
- 2.3.2.1.3 Voraussetzungen der Eheschließung der Jungfrauen
- 2.3.2.2 Nichtvorliegen der Ehehindernisse
- 2.3.2.3 Besondere Ehehindernisse
- 2.3.3 Eintragung der Ehe
- 2.4 Wirkung der Ehe
- 2.4.1 Rechte und Pflichten
- 2.4.2 Immaterielle Seite der Ehe
- 2.4.2.1 Führung der Familie
- 2.4.2.2 Bleiberecht
- 2.4.2.3 Gehorsamspflicht der Frau (Tamkin)
- 2.4.2.4 Berufsausübung der Ehefrau
- 2.4.2.5 Sonstige Immaterielle Rechte
- 2.4.2.5.1 Namensrecht
- 2.4.2.5.2 Staatsangehörigkeit
- 2.4.3 Der Materielle Aspekt
- 2.4.3.1 Unterhaltszahlung (Nafaghe)
- 2.4.3.2 Unterhalt und Scheidung
- 2.4.3.3 Sonstige Materielle Ansprüche
- 2.4.4.3.1 Unterhaltsansprüche der Blutverwandten
- 2.4.4.3.2 Kinderunterhalt
- 2.5 Scheidung (Verstoßung)
- 2.5.1 Einführung im iranischen Scheidungsrecht
- 2.5.2 Die verschiedenen Arten der Scheidungen
- III. Morgengabe
- 3.1 Allgemein
- 3.2 Morgengabe im iranischen Familienrecht
- 3.2.1 Der Gegenstand und die Höhe der vereinbarten Morgengabe
- 3.2.1.1 Klarheit des Morgengabengegenstands
- 3.2.1.2 Übergabepflicht des Ehemannes und Fälligkeit der Morgengabe
- 3.2.1.2.1 Übergabe der Morgengabe
- 3.2.1.2.2 Fälligkeit der Morgengabe
- 3.2.2 Gesetzliche Regelungen beim Nicht-Vereinbarung der Morgengabe
- 3.2.3 Die übliche Morgengabe
- 3.2.3.1 Die Berechnung der üblichen Morgengabe
- 3.2.4 Zurückbehaltungsrecht
- 3.2.4.1 Zurückbehaltungsrecht der Ehefrau
- 3.2.4.2 Zurückbehaltungsrecht des Ehemannes
- 3.2.5 Sexuelle Beziehungen der Ehegatten und deren Einfluss auf Morgengabe
- 3.2.5.1 Einfluss auf Morgengabe
- 3.2.6 Die Berechnung der Morgengabe
- 3.2.6.1 Lebenshaltungskostenindices
- 3.3 Morgengabe und das Erbschaft
- 3.3.1 Erbschaft
- 3.3.2 Erbrecht aufgrund der Eheschließung
- 3.3.3 Morgengabeanspruch vom Nachlass
- IV. Das iranische Familienrecht aus der Perspektive der deutschen Gerichte
- 4.1 Allgemein
- 4.2 Die Einordnung des iranischen Familienrechts in das deutsche Privatrecht
- 4.3 Das deutsch-iranische Niederlassungsabkommen
- 4.3.1 Das Verhältnis des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens zu anderen völkerrechtlichen Verträgen mit familienrechtlichen Bezügen
- 4.4 Doppelte Staatsbürgerschaft und die Folgen für die Bestimmung des anwendbaren Familienrechts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit verfolgt das Ziel, die Grundzüge des iranischen Familienrechts im Vergleich zum deutschen Familienrecht darzustellen und dabei die „Morgengabe“ besonders zu berücksichtigen. Die Arbeit analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Rechtssysteme und beleuchtet die komplexen kulturellen und rechtlichen Aspekte der Institution der Morgengabe.
- Vergleich des iranischen und deutschen Familienrechts
- Die Bedeutung der Morgengabe im iranischen Recht
- Rechtliche Aspekte der Eheschließung und Scheidung in beiden Rechtssystemen
- Rechte und Pflichten der Ehegatten im iranischen und deutschen Recht
- Die Relevanz des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens im Kontext des Familienrechts
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt die Problemstellung sowie die Zielsetzung der Arbeit. Sie erläutert den Aufbau und den Inhalt der folgenden Kapitel und gibt einen Überblick über den methodischen Ansatz.
II. Das Familienrecht im Iran: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das iranische Familienrecht, das auf islamischen Prinzipien basiert. Es werden die relevanten Rechtsquellen, die Definition von Familie und Ehe, sowie die Voraussetzungen und die rechtlichen Folgen der Eheschließung und Scheidung ausführlich erläutert. Besonderes Augenmerk wird auf die Rechte und Pflichten der Ehegatten gelegt, inklusive der materiellen und immateriellen Aspekte der Ehe. Die verschiedenen Arten der Scheidung im iranischen Recht werden detailliert beschrieben.
III. Morgengabe: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Thema der Morgengabe, einem zentralen Element des iranischen Familienrechts. Es wird die Bedeutung der Morgengabe im Kontext der Ehe, ihre rechtliche Relevanz, der Umfang und die Fälligkeit des Anspruchs, sowie die rechtlichen Konsequenzen bei Nichtvereinbarung oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Morgengabe erörtert. Die Beziehungen zwischen Morgengabe, Erbrecht und den finanziellen Verpflichtungen der Ehegatten werden analysiert.
IV. Das iranische Familienrecht aus der Perspektive der deutschen Gerichte: Dieses Kapitel analysiert die Anerkennung und Anwendung des iranischen Familienrechts durch deutsche Gerichte. Es beleuchtet die Einordnung des iranischen Rechts in das deutsche Privatrecht, die Rolle des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens und die Herausforderungen bei der Anwendung internationalen Privatrechts im Kontext der doppelten Staatsbürgerschaft.
Schlüsselwörter
Iranisches Familienrecht, deutsches Familienrecht, Morgengabe (Mehr), Ehe, Scheidung, Rechtsvergleichung, islamisches Recht, Rechte und Pflichten der Ehegatten, Unterhalt, Erbrecht, internationales Privatrecht, deutsch-iranisches Niederlassungsabkommen, Doppelte Staatsbürgerschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Iranisches Familienrecht und Morgengabe
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das iranische Familienrecht im Vergleich zum deutschen Recht, wobei der Fokus besonders auf der Institution der „Morgengabe“ (Mehr) liegt. Sie analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Rechtssysteme und beleuchtet die kulturellen und rechtlichen Aspekte der Morgengabe.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich des iranischen und deutschen Familienrechts; die Bedeutung der Morgengabe im iranischen Recht; rechtliche Aspekte der Eheschließung und Scheidung in beiden Rechtssystemen; Rechte und Pflichten der Ehegatten; Relevanz des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens im Kontext des Familienrechts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel I (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau. Kapitel II bietet einen umfassenden Überblick über das iranische Familienrecht, inklusive Rechtsquellen, Definitionen von Familie und Ehe, Eheschließung, Scheidung und den Rechten und Pflichten der Ehegatten. Kapitel III befasst sich ausführlich mit der Morgengabe, ihrer rechtlichen Relevanz, dem Umfang des Anspruchs und den rechtlichen Konsequenzen. Kapitel IV analysiert die Anerkennung und Anwendung des iranischen Familienrechts durch deutsche Gerichte, die Rolle des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens und Herausforderungen bei der Anwendung internationalen Privatrechts im Kontext doppelter Staatsbürgerschaft.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Darstellung der Grundzüge des iranischen Familienrechts im Vergleich zum deutschen Recht unter besonderer Berücksichtigung der Morgengabe. Die Arbeit analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede und beleuchtet die komplexen kulturellen und rechtlichen Aspekte der Morgengabe.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Iranisches Familienrecht, deutsches Familienrecht, Morgengabe (Mehr), Ehe, Scheidung, Rechtsvergleichung, islamisches Recht, Rechte und Pflichten der Ehegatten, Unterhalt, Erbrecht, internationales Privatrecht, deutsch-iranisches Niederlassungsabkommen, Doppelte Staatsbürgerschaft.
Wie wird die Morgengabe in der Arbeit behandelt?
Die Morgengabe (Mehr) wird als zentrales Element des iranischen Familienrechts ausführlich behandelt. Die Arbeit untersucht ihre Bedeutung im Kontext der Ehe, ihre rechtliche Relevanz, den Umfang und die Fälligkeit des Anspruchs, sowie die rechtlichen Konsequenzen bei Nichtvereinbarung oder Streitigkeiten. Die Beziehungen zwischen Morgengabe, Erbrecht und den finanziellen Verpflichtungen der Ehegatten werden analysiert.
Welche Rolle spielt das deutsch-iranische Niederlassungsabkommen?
Das deutsch-iranische Niederlassungsabkommen spielt eine wichtige Rolle bei der Anerkennung und Anwendung des iranischen Familienrechts durch deutsche Gerichte. Die Arbeit beleuchtet sein Verhältnis zu anderen völkerrechtlichen Verträgen und die Herausforderungen bei der Anwendung internationalen Privatrechts im Kontext doppelter Staatsbürgerschaft.
Wie werden das iranische und das deutsche Familienrecht verglichen?
Die Arbeit vergleicht das iranische und deutsche Familienrecht in Bezug auf Eheschließung, Scheidung, Rechte und Pflichten der Ehegatten und die rechtlichen Aspekte der Morgengabe. Sie hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor und analysiert die kulturellen und rechtlichen Hintergründe dieser Unterschiede.
- Citation du texte
- Sheyda Shirazi (Auteur), 2010, Grundzüge des iranischen Familienrechts im Vergleich zum deutschen Familienrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166670