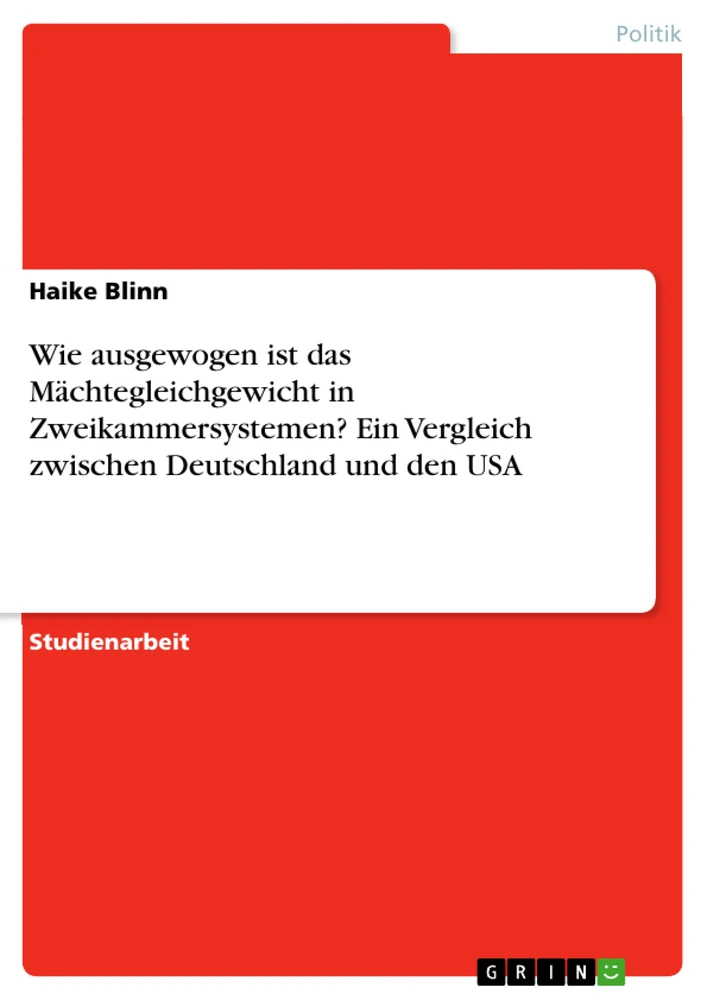1. Einleitung
Am 15.05.2009 wurde der Gesetzentwurf des “American Clean Energy and Security Act” (kurz: CES), der die Reduzierung der Treibhausgase und die Schaffung erneuerbarer Energie-quellen vorsieht, unter der Regierung Barack Obamas im Kongress vorgelegt . Da die Klima-politik unter dem Gesichtspunkt des „climate change“ mittlerweile eine große weltpolitische Rolle spielt, sind Gesetze, die das Klima betreffen, auch innenpolitisch von großer Bedeutung. Um aber ein Gesetz in den USA zu verabschieden, ist sowohl die Zustimmung des Senats als auch die des Repräsentantenhauses notwendig . Der Entwurf des CES-Gesetzes wird jedoch, seit seiner Verabschiedung im Repräsentantenhaus am 26.06.2009, im Senat beraten . Der Senat, die zweite Kammer der USA, kann Gesetzesvorhaben blockieren, da er mit dem Repräsentantenhaus diesbezüglich gleichgestellt ist .
Im Vergleich dazu sieht die Gesetzgebung in Deutschland anders aus, seit Jahren versucht man, den Einfluss der zweiten Kammer, des Bundesrates, in der Gesetzgebung zu verringern, das letzte Mal durch die Föderalismusreform 2006, indem man die Zahl der durch den Bun-desrat zustimmungspflichtigen Gesetze, reduziert hat. Ziel dieser Untersuchung ist es, die zweite Kammer der USA mit der in Deutschland zu vergleichen, um darüber eine Aussage zu machen, wie ausgewogen das Mächtegleichgewicht zwischen den jeweiligen beiden Kammern (Bundesrat/Bundestag und Senat/Repräsentantenhaus) ist, d.h. wie viel Macht die zweite Kammer im Vergleich zur ersten Kammer hat bzw., ob sie überhaupt als richtige zweite Kammer bezeichnet werden kann.
Bevor aber dieser Vergleich erfolgt, sollen zunächst die Begriffe des Föderalismus und des Bikameralismus erläutert werden. Danach werden die föderalen Systeme Deutschlands und der USA sowie ihre Zweikammersysteme dargestellt. Abschließend wird aus dem Vergleich zwischen beiden ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe
- Föderalismus
- Bikameralismus
- Der Föderalismus Deutschlands – im Grundgesetz doppelt verankert
- Die Schwäche des Bundesrats im Zweikammersystem Deutschlands
- Unzufriedenheit im deutschen Föderalismus
- Der Föderalismus der USA – keine Absicherung durch die Verfassung
- Die Stärke des Senats im Zweikammersystem der USA
- Größtenteils Zufriedenheit im amerikanischen Föderalismus
- Senat vs. Bundesrat - Zwei unterschiedliche zweite Kammern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Mächtegleichgewicht in Zweikammersystemen, indem sie den Bundesrat in Deutschland und den Senat in den USA vergleicht. Ziel ist es, die Machtverhältnisse zwischen den zweiten Kammern und den ersten Kammern (Bundestag und Repräsentantenhaus) zu analysieren und zu bewerten, ob die zweiten Kammern tatsächlich als gleichberechtigte legislative Instanzen gelten können.
- Föderalismus und Bikameralismus als zentrale Konzepte
- Vergleich der föderalen Systeme in Deutschland und den USA
- Analyse der Machtverhältnisse in den Zweikammersystemen
- Bewertung der Rolle der zweiten Kammern in der Gesetzgebung
- Zusammenfassendes Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den „American Clean Energy and Security Act“ (CES) als Beispiel für die Relevanz von Zweikammersystemen in der Gesetzgebung vor und erläutert das Ziel der Untersuchung: den Vergleich der zweiten Kammern in Deutschland und den USA.
- Begriffe: Die Kapitel erläutern die Begriffe Föderalismus und Bikameralismus, indem sie auf die verschiedenen Formen des Föderalismus und die Funktion von Zweikammersystemen in der Gesetzgebung eingehen.
- Der Föderalismus Deutschlands: Dieses Kapitel beschreibt die Verankerung des Föderalismus im Grundgesetz und analysiert die Bedeutung der Bundesländer im deutschen politischen System.
- Die Schwäche des Bundesrats: Das Kapitel untersucht den Einfluss des Bundesrats auf die Gesetzgebung in Deutschland und stellt die Kritik an seiner begrenzten Macht dar.
- Unzufriedenheit im deutschen Föderalismus: Dieser Abschnitt beleuchtet die kritischen Stimmen gegenüber dem deutschen Föderalismus, die sich auf die Machtverteilung zwischen Bund und Ländern konzentrieren.
- Der Föderalismus der USA: Dieses Kapitel beschreibt die Besonderheiten des US-amerikanischen föderalen Systems und die Unterschiede zum deutschen System.
- Die Stärke des Senats: Der Einfluss des Senats auf die Gesetzgebung in den USA wird untersucht und mit der Situation in Deutschland verglichen.
- Größtenteils Zufriedenheit im amerikanischen Föderalismus: Dieser Abschnitt beleuchtet die allgemeine Zustimmung zum US-amerikanischen Föderalismus.
- Senat vs. Bundesrat: Das Kapitel vergleicht die beiden zweiten Kammern im Detail und analysiert ihre unterschiedlichen Funktionen und Machtpositionen.
Schlüsselwörter
Zentrale Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: Föderalismus, Bikameralismus, Zweikammersystem, Bundesrat, Bundestag, Senat, Repräsentantenhaus, Mächtegleichgewicht, Gesetzgebung, politische Macht, Verfassungsrecht, Deutschland, USA.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich der deutsche Bundesrat und der US-Senat?
Der US-Senat gilt als deutlich machtvoller, da er dem Repräsentantenhaus in der Gesetzgebung fast völlig gleichgestellt ist, während der Einfluss des Bundesrats oft auf zustimmungspflichtige Gesetze begrenzt ist.
Was ist das Ziel der Föderalismusreform 2006 in Deutschland gewesen?
Ziel war es, die Anzahl der zustimmungspflichtigen Gesetze im Bundesrat zu verringern, um Blockaden in der Gesetzgebung abzubauen und die Handlungsfähigkeit des Bundes zu stärken.
Was bedeutet "Bikameralismus"?
Bikameralismus bezeichnet ein parlamentarisches System mit zwei Kammern, die in der Regel unterschiedliche Repräsentationsfunktionen (z. B. Gesamtvolk vs. Gliedstaaten) wahrnehmen.
Warum ist der US-Senat in der Gesetzgebung so einflussreich?
In den USA kann kein Bundesgesetz ohne die explizite Zustimmung des Senats verabschiedet werden, was ihm eine starke Blockademacht gegenüber dem Präsidenten und dem Unterhaus verleiht.
Wie ist der Föderalismus im deutschen Grundgesetz abgesichert?
Der Föderalismus ist in Deutschland durch die sogenannte Ewigkeitsklausel (Art. 79 Abs. 3 GG) geschützt, die eine Abschaffung der Gliederung des Bundes in Länder verbietet.
- Arbeit zitieren
- Haike Blinn (Autor:in), 2010, Wie ausgewogen ist das Mächtegleichgewicht in Zweikammersystemen? Ein Vergleich zwischen Deutschland und den USA, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166728