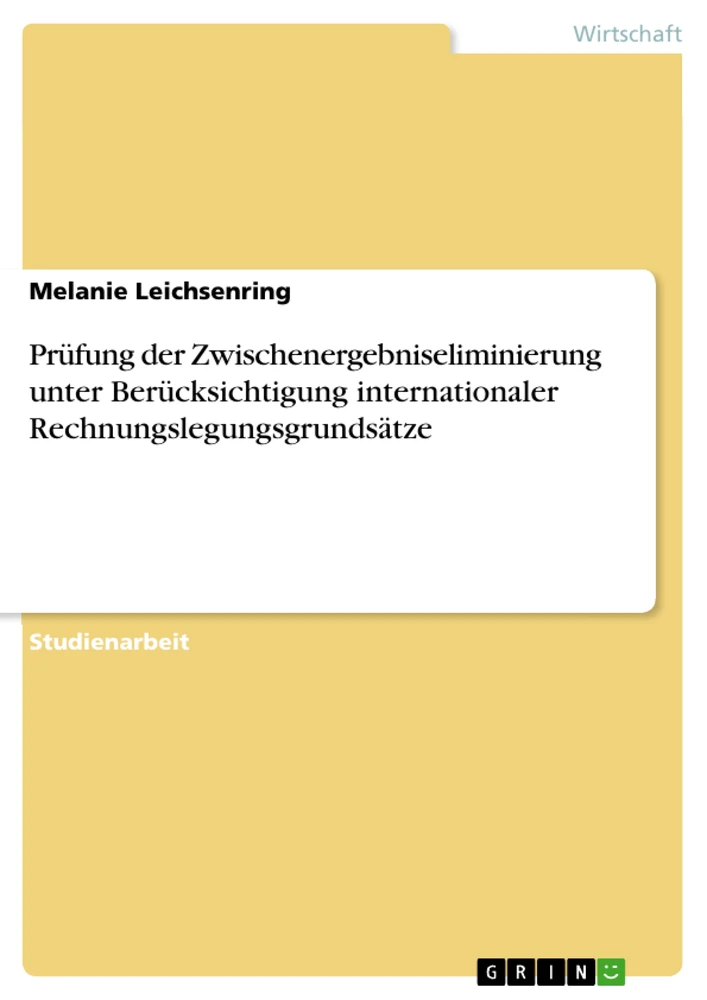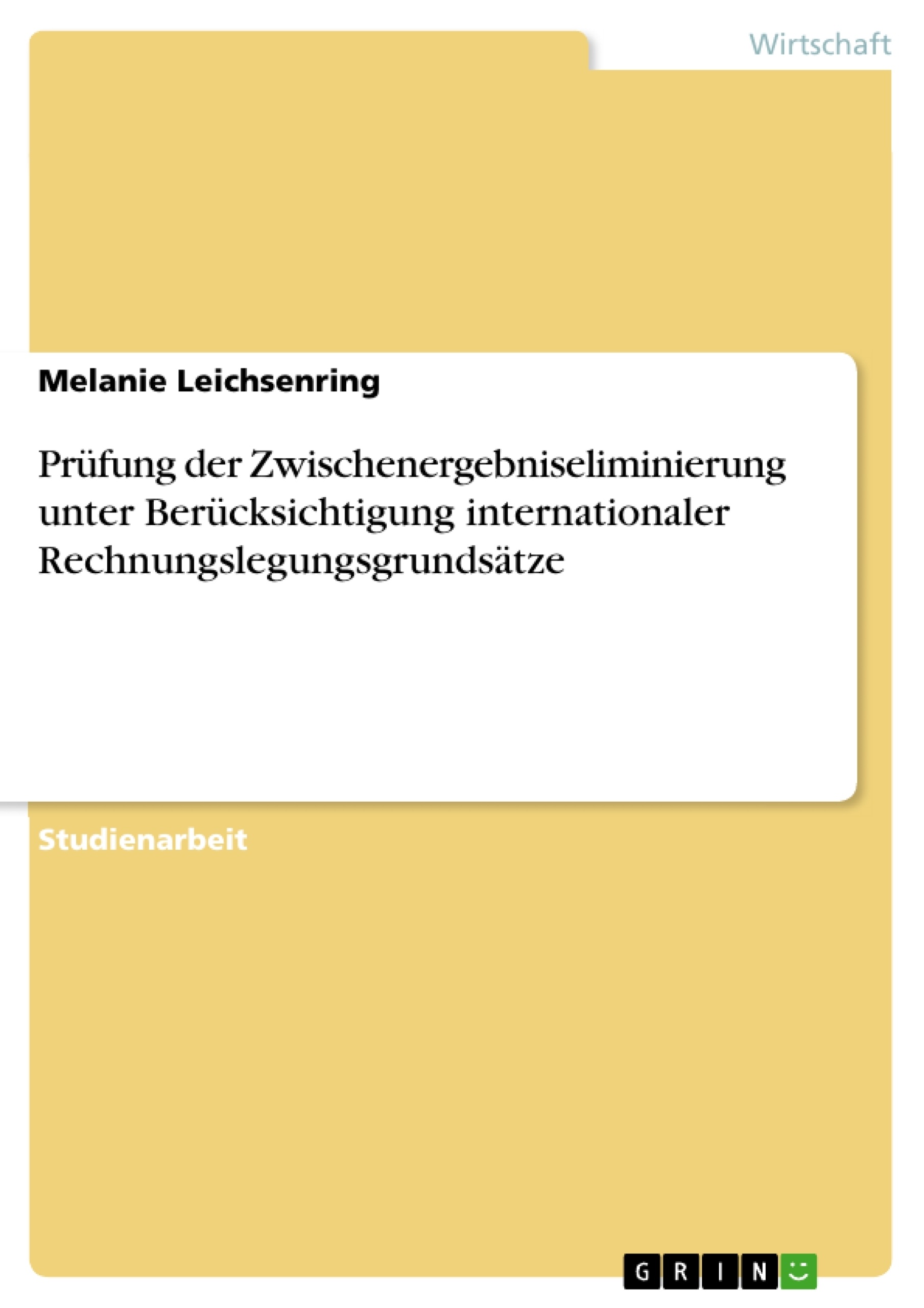1 Einleitung
Nach den handelsrechtlichen GoB gelten Gewinne erst dann als realisiert, wenn sie tatsächlich eingetreten sind, das heißt wenn sie durch den Markt bestätigt wurden. Betrachtet man nun die Situation in einem Konzern, muss man feststellen, dass dieses Realisationsprinzip nicht auf Gewinne aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen von Vermögensgegenständen zutrifft. Somit wird deutlich, dass die Gewinne keine zulässigen Bestandteile bei der Bewertung eines Vermögensgegenstandes darstellen. Die Vermögensgegenstände werden hingegen nur mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, die gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen fortgeschrieben werden. Für die innerkonzernlichen Verluste gilt ebenfalls, dass diese erst angesetzt werden dürfen, wenn sie durch den Außenumsatz bestätigt wurden. Das Vorsichts- und Niederstwertprinzip, das im Einzelanschluss Anwendung findet, trifft auf die Verluste aus innerlichen Geschäften nicht zu.
Im Folgenden werden der Begriff sowie der Anwendungsbereich der Zwischenergebniseliminierung näher erläutert und es wird auf die rechtlichen Grundlagen sowohl nach HGB als auch nach IAS7IFRS eingegangen. Danach werden die Konzernbestandsprüfung sowie die Ermittlung der Wertansätze für die Konzernbestände betrachtet. Zum Abschluss werden verschiedene Möglichkeiten der Prüfung der Zwischenergebniseliminierung vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Begriff und Anwendungsbereich der Zwischenergebniseliminierung
- Rechtliche Grundlagen
- Regelungen nach HGB
- Regelungen nach IAS/IFRS
- Konzernbestandsprüfung
- Wertansätze für die Konzernbestände
- Konzernanschaffungskosten
- Konzernherstellungskosten
- Konzernhöchstwert und Konzernmindestwert
- Ermittlung der Wertansätze
- Prüfung der Zwischenergebniseliminierung
- Verrechnung der Zwischenergebnisse im Jahresergebnis
- Verrechnung mit dem Eigenkapital
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Zwischenergebniseliminierung im Konzernabschluss. Sie analysiert den Begriff und Anwendungsbereich der Zwischenergebniseliminierung sowie die rechtlichen Grundlagen nach HGB und IAS/IFRS. Außerdem werden die Konzernbestandsprüfung und die Ermittlung von Wertansätzen für Konzernbestände behandelt. Schließlich werden verschiedene Möglichkeiten der Prüfung der Zwischenergebniseliminierung vorgestellt.
- Begriff und Anwendungsbereich der Zwischenergebniseliminierung
- Rechtliche Grundlagen der Zwischenergebniseliminierung
- Konzernbestandsprüfung und Wertansätze für Konzernbestände
- Prüfung der Zwischenergebniseliminierung
- Einheitstheorie im Konzernabschluss
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet das Realisationsprinzip im Konzern und stellt die Notwendigkeit der Zwischenergebniseliminierung heraus.
Das Kapitel "Grundlagen" definiert den Begriff der Zwischenergebnisse und erläutert seinen Anwendungsbereich. Außerdem werden die rechtlichen Grundlagen der Zwischenergebniseliminierung nach HGB und IAS/IFRS betrachtet.
Das Kapitel "Konzernbestandsprüfung" behandelt die Prüfung von Konzernbeständen, die auf Lieferungen und Leistungen zwischen Konzernunternehmen beruhen.
Im Kapitel "Wertansätze für die Konzernbestände" werden die Konzernanschaffungs- und Konzernherstellungskosten erläutert, sowie die Prüfung der Wertansätze für Konzernbestände.
Das Kapitel "Prüfung der Zwischenergebniseliminierung" stellt verschiedene Möglichkeiten zur Prüfung der Zwischenergebniseliminierung vor, beispielsweise die Verrechnung der Zwischenergebnisse im Jahresergebnis und die Verrechnung mit dem Eigenkapital.
Schlüsselwörter
Zwischenergebniseliminierung, Konzernabschluss, HGB, IAS/IFRS, Konzernbestände, Wertansätze, Prüfung, Einheitstheorie, Realisationsprinzip, Innenumsätze, Konzernabschlussprüfung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Zwischenergebniseliminierung im Konzernabschluss?
Dabei werden Gewinne oder Verluste aus konzerninternen Lieferungen und Leistungen herausgerechnet, da diese aus Konzernsicht erst dann realisiert sind, wenn sie durch einen Umsatz mit Externen bestätigt wurden.
Welche rechtlichen Grundlagen gelten nach HGB und IFRS?
Sowohl das HGB als auch die IAS/IFRS schreiben die Eliminierung von Zwischenergebnissen vor, um den Konzern als wirtschaftliche Einheit (Einheitstheorie) darzustellen.
Wie werden Wertansätze für Konzernbestände ermittelt?
Vermögensgegenstände werden mit den Konzernanschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, wobei interne Gewinnaufschläge korrigiert werden müssen.
Was versteht man unter dem Realisationsprinzip im Konzern?
Es besagt, dass Gewinne erst dann als erzielt gelten, wenn sie durch den Markt (Außenumsatz) bestätigt wurden; rein interne Transaktionen dürfen das Konzernergebnis nicht erhöhen.
Wie erfolgt die Verrechnung der Zwischenergebnisse?
Die Verrechnung kann entweder im Jahresergebnis oder direkt mit dem Eigenkapital erfolgen, je nachdem, welche Bilanzierungsvorschriften und Prüfungsmethoden angewandt werden.
- Citar trabajo
- Diplom-Kffr. (FH) Melanie Leichsenring (Autor), 2009, Prüfung der Zwischenergebniseliminierung unter Berücksichtigung internationaler Rechnungslegungsgrundsätze, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166803