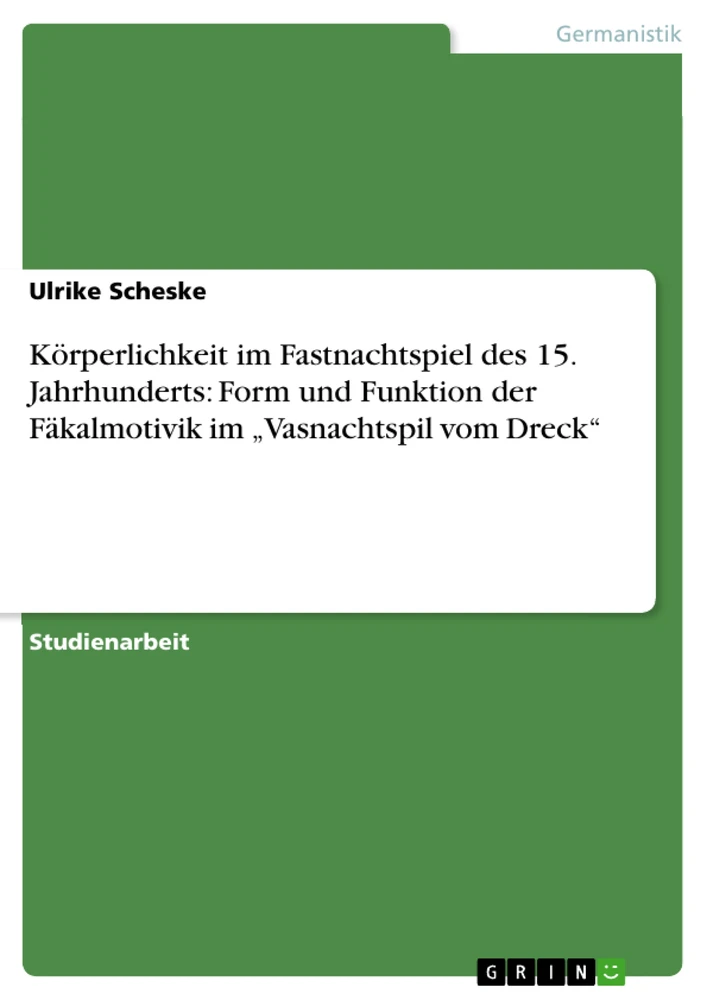Im Nürnberger Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts ist die Trieb- und Vitalsphäre des Menschen Gegenstand vieler Darstellungen. Ein Großteil der überlieferten Fastnachtspiele thematisiert die Bereiche des Sexuellen und Fäkalen. Der Rahmen der Festlichkeiten zur Fastnacht erlaubte es, sich über die geltenden Normen gesellschaftlicher Moralvorstellungen und Werte hinwegzusetzen und sie ins Gegenteil zu verkehren.
Im „Vasnachtspil vom Dreck“ wird der Bereich des Fäkalen zum Mittelpunkt der Darstellung gemacht und im Schutz der ´Narrenfreiheit` ein unterhaltsames Spiel mit gesellschaftlichen Verhaltensvorschriften getrieben. Die Rolle des Bauernnarren wird genutzt, um gesellschaftlich tabuisierte Körperfunktionen zu benennen, sich in skatologischen Wortspielen zu ergehen und das affektive Ausleben von Körperlichkeit zu inszenieren. Triebhafte Verhaltensweisen und Unmäßigkeit werden auf diese Weise spielerisch zur Norm erklärt und treten an die Stelle des gesellschaftlichen Zwangs zur Selbstbeherrschung, der "mâze".
Die Werteverkehrung betrifft Themen, die für das soziale Miteinander des Handwerkerstandes von Bedeutung waren. In der vorliegenden Arbeit soll herausgestellt werden, auf welche Weise die Inszenierung verkehrter Welt durch Bezugnahme auf verschiedene Bereiche des Alltagslebens der Nürnberger Handwerker erfolgt. Außerdem wird reflektiert, welche Funktion die Fäkalmotivik haben könnte. Nach einer kritischen Reflexion einiger kontroverser Forschungsbeiträge erfolgt eine detaillierte Analyse des Fastnachtspiels, die dem dreiteiligen Aufbau des Stücks folgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Funktion des Obszönen im Fastnachtspiel
- Form und Funktion der Fäkalmotivik im „Vasnachtspil vom Dreck“
- Verkehrung der Alltagswelt durch die Bauern
- Verkehrung der medizinischen Kunst durch die Ärzte
- Die Lehre des Bauern
- Funktion des Epilogs
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Inszenierung von Fäkalmotivik im Nürnberger Fastnachtspiel „Vasnachtspil vom Dreck“ aus dem 15. Jahrhundert und analysiert, wie diese die Umkehrung gesellschaftlicher Normen und Werte durch den Bauernnarren darstellt.
- Verkehrung der Alltagswelt und sozialer Normen durch den Bauernnarren
- Satire auf gesellschaftliche Institutionen und Figuren
- Die Rolle von Fäkalmotivik als Ausdruck von Körperlichkeit und Triebhaftigkeit
- Funktion der Fastnacht als Ventil für soziale Spannungen und Rebellion
- Die Bedeutung der Narrenfreiheit für den Ausdruck von Tabuthemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema und den Kontext des „Vasnachtspil vom Dreck“ vor und beleuchtet die Rolle der Fastnacht im 15. Jahrhundert.
Das erste Kapitel beleuchtet verschiedene Thesen zur Funktion des Obszönen im Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts. Es werden kritische Reflektionen zu den Thesen von Johannes Müller, Werner Mezger und Rüdiger Krohn vorgestellt, die sich mit der psychosexuellen Entwicklung, der Narrenidee und der Ventilfunktion der Fastnacht beschäftigen.
Das zweite Kapitel analysiert die Fäkalmotivik im „Vasnachtspil vom Dreck“. Es wird untersucht, wie der Bauernnarr die Alltagswelt und die medizinische Kunst in ein satirisches Licht rückt und tabuisierte Körperfunktionen zum Mittelpunkt der Darstellung macht.
Das dritte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und reflektiert die Bedeutung des Stücks für die Fastnachtskultur des 15. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Fastnachtspiel, Fäkalmotivik, Bauernnarr, Narrenfreiheit, Obszönität, Körperlichkeit, soziale Normen, Alltagswelt, Satire, Verkehrung, Nürnberger Handwerkerstand.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am „Vasnachtspil vom Dreck“?
In diesem Nürnberger Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts wird das Fäkale zum zentralen Thema gemacht, um gesellschaftliche Normen und Tabus spielerisch zu durchbrechen.
Welche Funktion hatte die Obszönität in mittelalterlichen Spielen?
Sie diente als Ventil für soziale Spannungen, ermöglichte die Kritik an Autoritäten (z.B. Ärzten) und feierte die triebhafte Körperlichkeit im Rahmen der zeitlich begrenzten Narrenfreiheit.
Warum wurde oft die Figur des Bauern für solche Darstellungen genutzt?
Der „Bauer“ galt im städtischen Fastnachtspiel als Projektionsfläche für Unmäßigkeit und Triebhaftigkeit. Er verkörperte das Gegenteil des bürgerlichen Ideals der Selbstbeherrschung (mâze).
Was bedeutet „verkehrte Welt“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die Umkehrung der normalen sozialen Ordnung während der Fastnacht, in der das Niedrige über das Hohe triumphiert und Tabus zur vorübergehenden Norm werden.
Wie reagierte das Handwerkertum auf diese Spiele?
Die Spiele wurden oft von Handwerkern für ein Publikum aus dem eigenen Stand aufgeführt. Sie dienten der Unterhaltung, aber auch der Bestätigung der eigenen sozialen Werte durch die Abgrenzung vom „närrischen“ Verhalten.
- Quote paper
- Ulrike Scheske (Author), 2010, Körperlichkeit im Fastnachtspiel des 15. Jahrhunderts: Form und Funktion der Fäkalmotivik im „Vasnachtspil vom Dreck“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166851