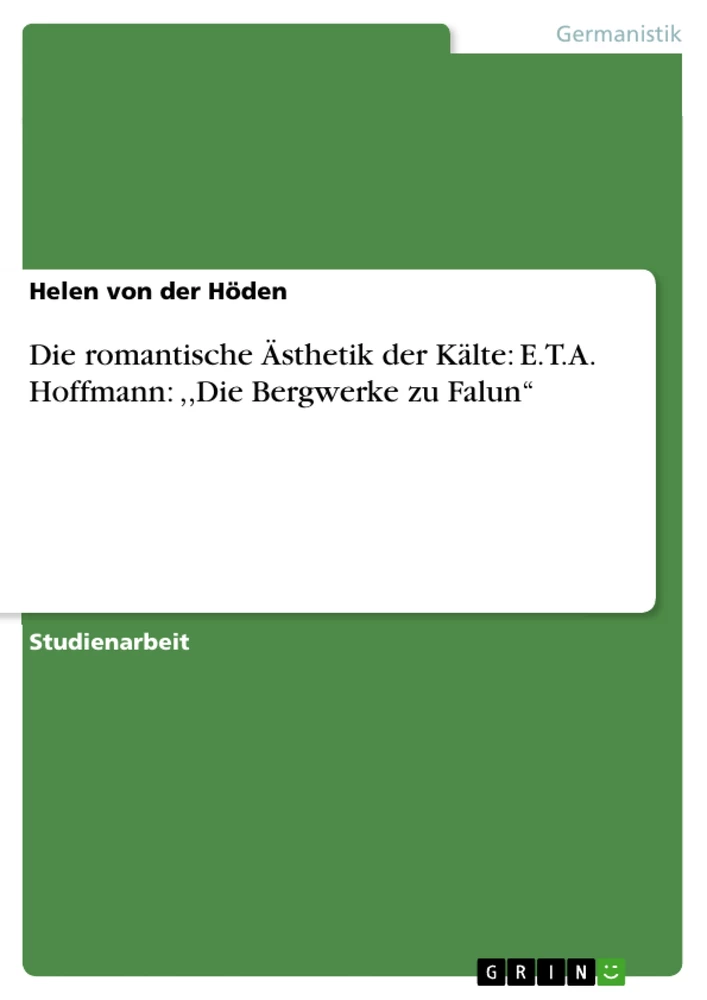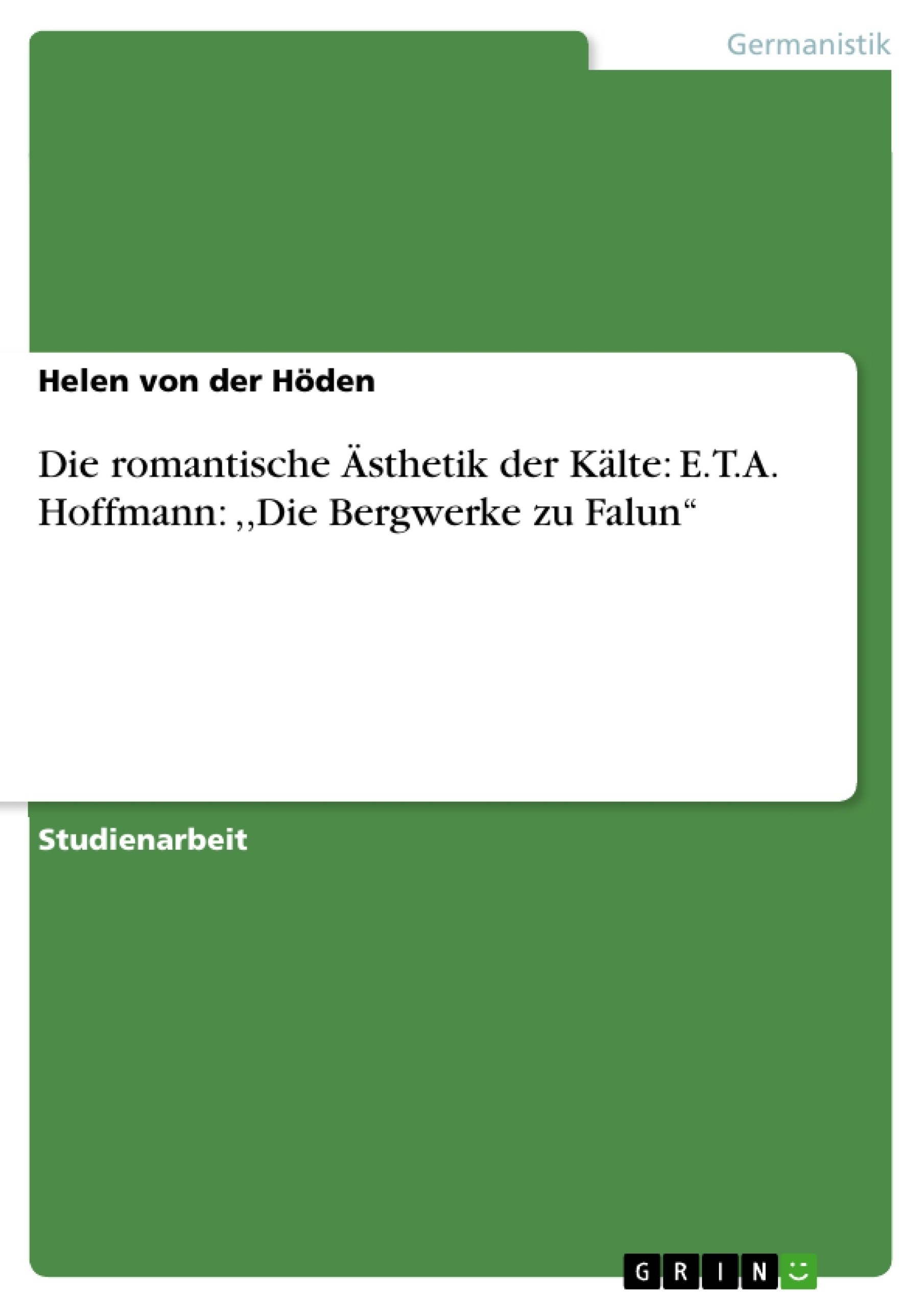Helmut Lethen beschreibt in seinem Werk „Verhaltenslehren der Kälte“ die kalte
Prägung der modernen Gesellschaft. Er veranschaulicht verschiedene Handlungsoptionen zur Distanzwahrung, die von der Gesellschaft vorgegeben werden. Damit erklärt er die emotionale Kälte zur Signatur der modernen Epoche. Das Verständnis von Kälte als sozial anerkannte Verhaltensweise führt Lethen auf höfisch barocke Sitten zurück. E.T.A. Hoffmann bedient sich in „Die Bergwerke von Falun“ diverser Inszenierungsformen von Kälte. Die Erzählung aus dem Sammelwerk „Die Serapionsbrüder“ stellt immer wieder der Wärme der Oberwelt die Verlockungen der kalten Bergwerkswelt entgegen.
Der Dualismus Wärme - Kälte, Liebe - Erotik, Alltag - Kunst macht diese Erzählung zu
einer „modernen“ Studie über den Menschen und seine Gelüste. Die Erkaltung bietet
dem Menschen die Möglichkeit sich von der Gesellschaft, der er sich nicht zugehörig
fühlt, abzugrenzen. Die Flucht des jungen Bergmanns Elis aus der natürlichen Oberwelt
in eine künstliche, kalte Unterwelt der Selbstbespiegelung bietet viele
Interpretationsmöglichkeiten:
Kann die Kälte der Bergwerkswelt exemplarisch gesehen werden für das Ideal des
asketischen Künstlers? Wie sind die zwei gegensätzlich dargestellten Frauentypen
konstituiert – ist die Bergkönigin der Vorläufer der modernen femme fatale? Kann nur die
„Erkaltung“ des Menschen den Zugang zu einem höheren Künstlerideal ermöglichen?
Bietet das Abkehren von der Natur und die Hinwendung zum Künstlichen
(Künstlerischen) dem Künstler Erfüllung? Ist der Rückzug des Menschen in die Einsamkeit die Konsequenz einer sich ständig verändernden unverständlicher werdenden Welt?
Die intertextuelle Betrachtung bildet die Grundlage dafür, die Hoffmann´sche Erzählung
in einen größeren Zusammenhang einzuordnen zu können. Denn Hoffmanns
erzählerisches Werk ist durchsetzt von Verweisen und Zitaten auf die Schriften anderer
Autoren. Deshalb wird untersucht, inwieweit sich die Erzählungen gegenseitig
beeinflussten. Alle drei Erzählungen werden der Epoche der Romantik zugeordnet,
jedoch weist Hoffmanns Bearbeitung des tragischen Unglücks in Falun erstmals moderne
Elemente auf.
Inhaltsverzeichnis
- I.) Einleitung
- II.) Historische Begebenheit
- III.) Johann Peter Hebel: Unverhofftes Wiedersehen
- IV.) Achim von Arnim: Des ersten Bergmanns ewige Jugend
- V.) E.T.A. Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun
- V.1.) Zwischen Ober- und Unterwelt: Die Reise ins Selbst
- V.2.) Kalte Materialien
- V.2.1.) Der Fall ins Kristall
- V.2.2.) Künstlichkeit und Naturbeherrschung
- V.3) Die eiskalte femme fatale
- V.4) Die Kälte als Künstlerideal
- VI.) Fazit
- VII.) Quellenverzeichnis
- VIII.) Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die romantische Ästhetik der Kälte anhand von E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Die Bergwerke zu Falun“. Sie analysiert, wie Hoffmann die Kälte in der Erzählung inszeniert und welche Bedeutung sie für die Charakterentwicklung und die Darstellung der menschlichen Psyche hat.
- Die Darstellung von Kälte als ästhetisches Prinzip
- Die Rolle der Kälte in der Beziehung zwischen Mensch und Natur
- Die Verbindung von Kälte und Künstlichkeit
- Die Bedeutung der Kälte für die Entwicklung des Künstlerideals
- Die Ambivalenz der Kälte im Kontext von Liebe und Erotik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der romantischen Ästhetik der Kälte ein und stellt den Kontext von E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Die Bergwerke zu Falun“ dar. Sie beleuchtet die Bedeutung von Kälte als ästhetisches Prinzip und die Rolle der Kälte in der Entwicklung des Künstlerideals.
Kapitel II beleuchtet die historische Begebenheit, die als Grundlage für die Erzählung „Die Bergwerke zu Falun“ dient. Es werden die verschiedenen Bearbeitungen des Themas durch Johann Peter Hebel, Achim von Arnim und E.T.A. Hoffmann vorgestellt.
Kapitel III analysiert Johann Peter Hebels Erzählung „Unverhofftes Wiedersehen“ und stellt die Bedeutung der Kalendergeschichte als literarische Gattung dar.
Kapitel IV untersucht Achim von Arnims Ballade „Des ersten Bergmanns ewige Jugend“ und die Rolle der Ballade in der romantischen Literatur.
Kapitel V widmet sich E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Die Bergwerke zu Falun“ und analysiert die verschiedenen Aspekte der Kälte, die in der Erzählung dargestellt werden. Es werden die Reise des jungen Bergmanns Elis in die kalte Unterwelt, die kalten Materialien und die eiskalte femme fatale untersucht.
Schlüsselwörter
Romantische Ästhetik, Kälte, E.T.A. Hoffmann, „Die Bergwerke zu Falun“, Künstlerideal, Femme Fatale, Unterwelt, Naturbeherrschung, Künstlichkeit, Liebe, Erotik.
Häufig gestellte Fragen zu „Die Bergwerke zu Falun“
Worum geht es in E.T.A. Hoffmanns „Die Bergwerke zu Falun“?
Die Erzählung handelt von dem jungen Seemann Elis Fröbom, der sich von der Oberwelt abwendet und in die künstliche, kalte Welt des Bergwerks von Falun hineingezogen wird, was letztlich zu seinem Untergang führt.
Welche Bedeutung hat die „Kälte“ in der Erzählung?
Kälte dient als ästhetisches Prinzip und Symbol für die Abgrenzung von der Gesellschaft. Sie steht für die künstliche Welt des Künstlers im Gegensatz zur natürlichen Wärme des Alltags.
Wer ist die Bergkönigin?
Die Bergkönigin wird als eine Art eiskalte „Femme Fatale“ dargestellt, die Elis verführt und ihn von seiner menschlichen Braut Ulla weg in die Tiefe lockt.
Was ist das „Künstlerideal“ in diesem Werk?
Es wird die Frage aufgeworfen, ob erst die „Erkaltung“ – die emotionale Distanz und Einsamkeit – den Zugang zu einem höheren, asketischen Künstlerideal ermöglicht.
Welche historischen Quellen nutzte Hoffmann?
Die Erzählung basiert auf einem realen Grubenunglück in Falun. Auch andere Autoren wie Johann Peter Hebel und Achim von Arnim bearbeiteten diesen Stoff.
- Citation du texte
- Helen von der Höden (Auteur), 2009, Die romantische Ästhetik der Kälte: E.T.A. Hoffmann: ,,Die Bergwerke zu Falun“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166864