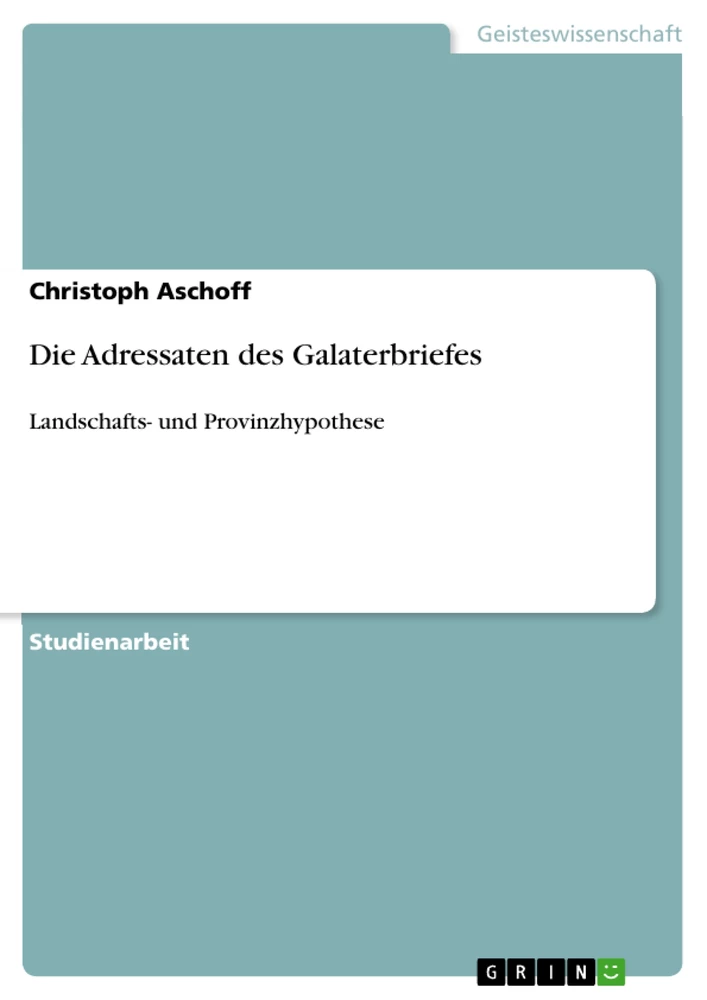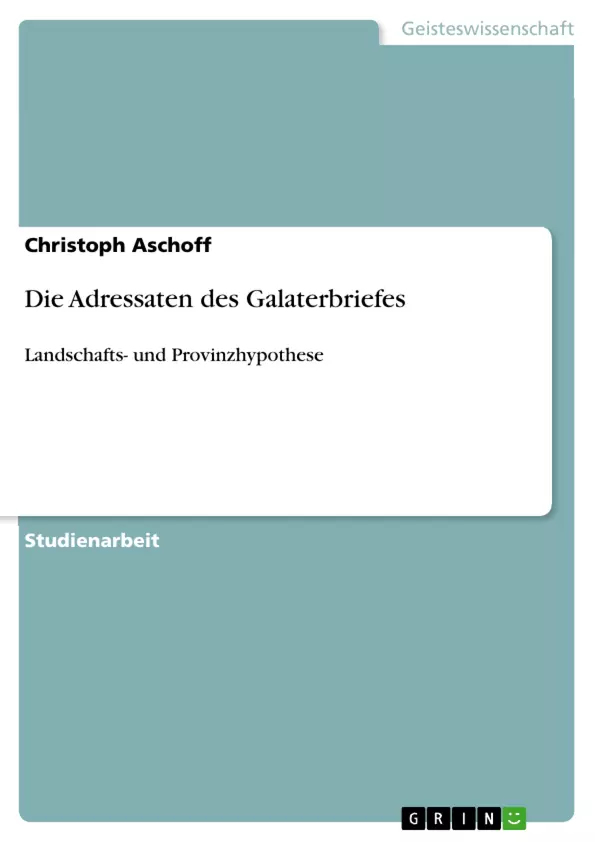Anstoß für die vorliegende Arbeit und die eingehendere Beschäftigung mit der Frage nach den Adressaten des Galaterbriefes und ihrer Lokalisierung war der Vortrag zu diesem Thema von Prof. Dr. Sänger aus Kiel auf dem Symposium anlässlich des 70. Geburtstages von Prof. Ulrich B. Müller (a.D.) im April 2008 in Saarbrücken. Prof. Sänger vertrat in seinem Vortrag – was eher für den englischen Sprachraum üblich ist – die Ansicht, die Adressaten seien im Süden der römischen Provinz Galatien zu verorten.
Die im wissenschaftlichen Diskurs anzutreffende Gegenposition, deren derzeitige Verfechter meist aus dem deutschsprachigen Raum stammen , besagt, dass die Adressaten jedoch weiter nördlich, in der Landschaft Galatien zu lokalisieren seien. Diese beiden Hypothesen, entsprechend der jeweiligen Verortung der angeschriebenen Personen und Gemeinden „südgalatische Hypothese“ oder „Provinzhypothese“ sowie „nordgalatische“ oder „Landschaftshypothese“ genannt , sollen im Folgenden genau untersucht und diskutiert werden. Zuvor dienen jedoch einige grundlegende Informationen zum Galaterbrief (Autor, Aufbau, Inhalt) als Einstieg und Hinführung zur eigentlichen Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Informationen zum Galaterbrief
- Die Adressaten des Galaterbriefes
- Der Begriff „Galater“ und sein geschichtlicher Hintergrund
- Der Begriff „Galatien“ und sein geschichtlicher Hintergrund
- Die Provinzhypothese (südgalatische Hypothese)
- Die Landschaftshypothese (nordgalatische Hypothese)
- Diskussion der Hypothesen
- Diskussion der Provinzhypothese
- Diskussion der Landschaftshypothese
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage nach den Adressaten des Galaterbriefes und deren Lokalisierung. Sie analysiert die beiden vorherrschenden Hypothesen - die südgalatische (Provinzhypothese) und die nordgalatische (Landschaftshypothese) - und diskutiert deren Argumente. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die wissenschaftliche Diskussion zu bieten und die verschiedenen Positionen zu bewerten.
- Die Identität der Adressaten des Galaterbriefes
- Die Lokalisierung der Galater-Gemeinden
- Die historische und geographische Bedeutung der Provinz Galatien
- Die verschiedenen wissenschaftlichen Interpretationen der Adressatenfrage
- Die Relevanz der Adressatenfrage für das Verständnis des Galaterbriefes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Adressatenfrage ein und erläutert den wissenschaftlichen Hintergrund sowie den Anlass für die vorliegende Arbeit. Das zweite Kapitel behandelt grundlegende Informationen zum Galaterbrief, wie Autor, Aufbau, Inhalt und Stil. Im dritten Kapitel wird der Begriff „Galater“ und sein geschichtlicher Hintergrund beleuchtet, um die geographische Lage der Adressaten besser zu verstehen.
Schlüsselwörter
Galaterbrief, Adressaten, Galatien, Provinzhypothese, Landschaftshypothese, Paulinische Briefe, Judentum, Christentum, Geschichte, Geographie, Exegese.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Adressaten des Galaterbriefes?
Die Identität und Lokalisierung der Adressaten ist wissenschaftlich umstritten. Es wird zwischen der südgalatischen und der nordgalatischen Hypothese unterschieden.
Was besagt die „südgalatische Hypothese“ (Provinzhypothese)?
Diese Hypothese nimmt an, dass die Adressaten in den Städten im Süden der römischen Provinz Galatien lebten, die Paulus auf seiner ersten Missionsreise besuchte.
Was besagt die „nordgalatische Hypothese“ (Landschaftshypothese)?
Sie verortet die Gemeinden weiter nördlich in der eigentlichen Landschaft Galatien, dem Siedlungsgebiet der Kelten, was besonders in der deutschsprachigen Forschung verbreitet ist.
Warum ist die Lokalisierung der Adressaten für die Exegese wichtig?
Die Verortung beeinflusst die Datierung des Briefes und das Verständnis der historischen Situation der Gemeinden, an die Paulus schrieb.
Wer gilt als Autor des Galaterbriefes?
Der Apostel Paulus wird allgemein als Autor des Briefes anerkannt, der sich darin intensiv mit dem Verhältnis zwischen Judentum und Christentum auseinandersetzt.
- Quote paper
- Christoph Aschoff (Author), 2009, Die Adressaten des Galaterbriefes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166968