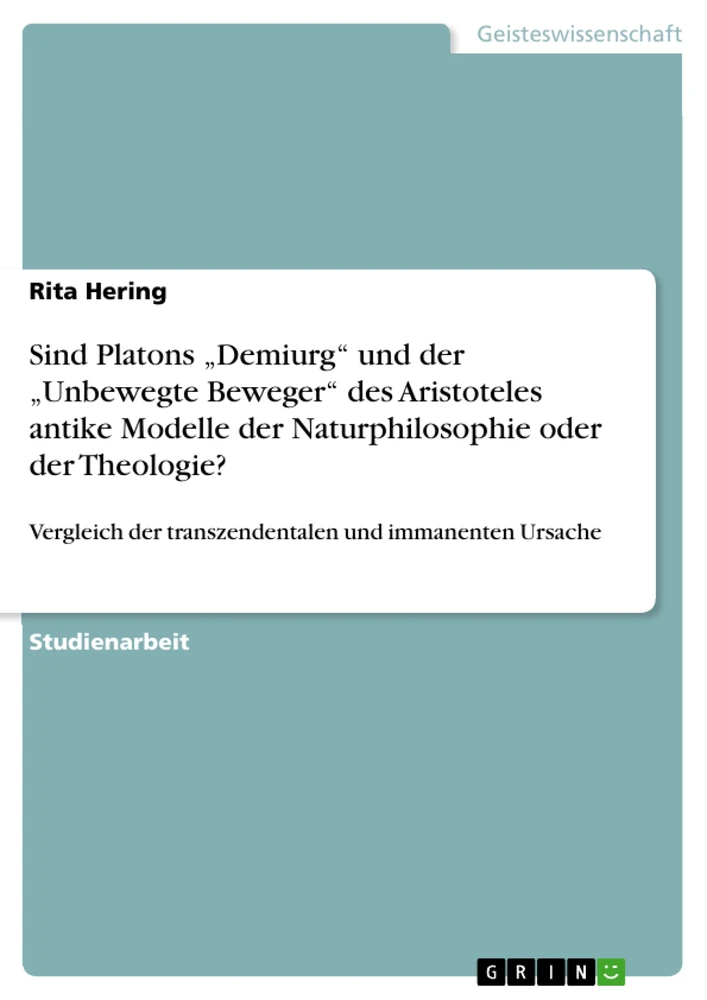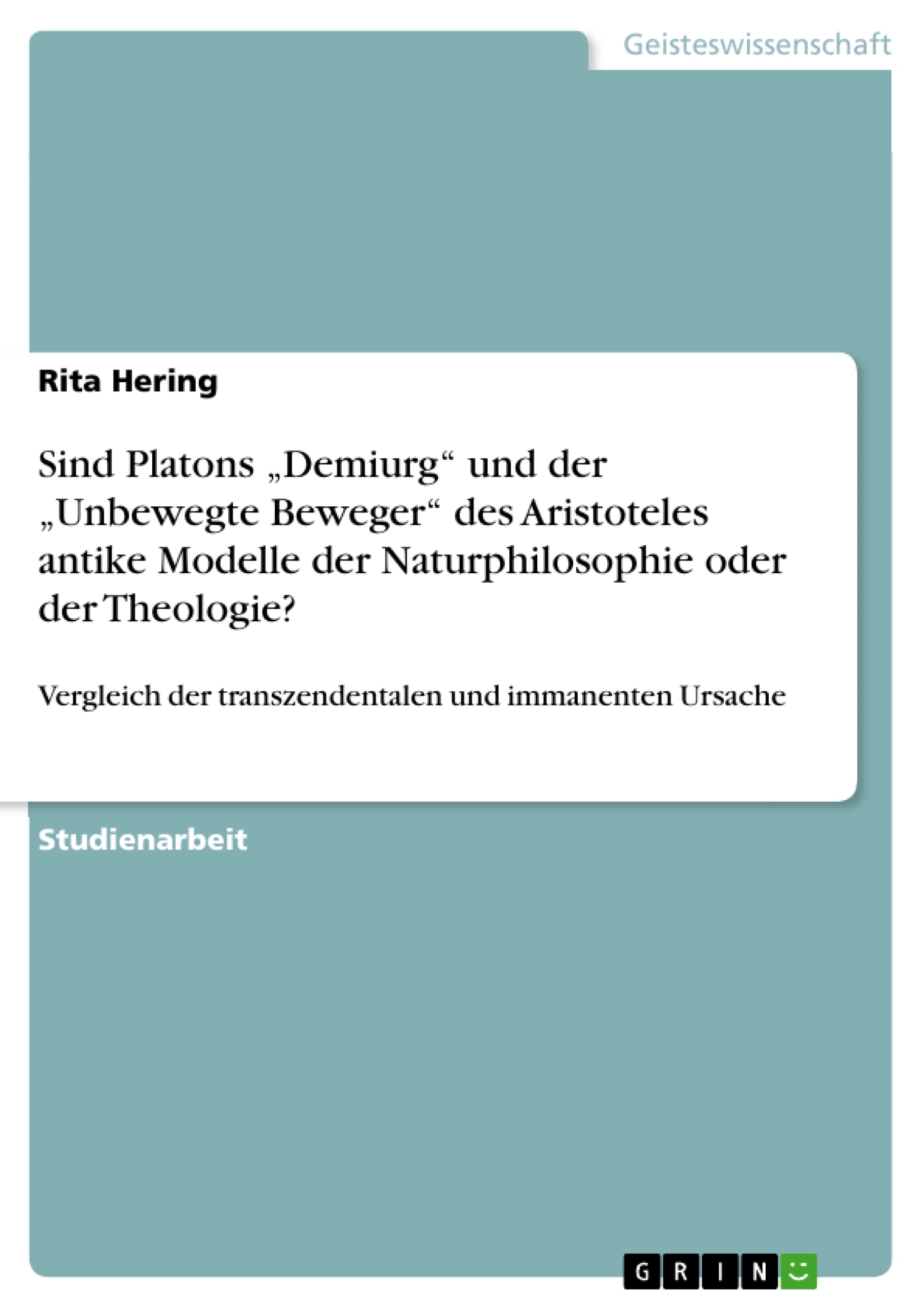In der antiken Naturphilosophie wird die Welt „entgöttert“ und Naturphänomene anhand von Beobachtungen und theoretischen Annahmen erklärt.
Schon vor Platon (428 – 348 v. Chr.) und Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) haben sich Philosophen wie Demokrit, Anaxagoras, Pythagoras und Thales – um nur einige der so genannten Vorsokratiker (ca. 600 – 400 v. Chr.) zu nennen – Fragen über die Beschaffenheit der Natur, der Seele und deren Zusammenwirken gestellt. Sie versuchten mit unterschiedlichen Methoden, einerseits durch Beobachtungen, andererseits durch antike Experimente und Theorien, herauszufinden, wie die Bestandteile der Natur geformt sind und in welcher Art und Weise diese einzelnen Bausteine aufeinander wirken.
Erst Platon entwickelt eine allumfassende Theorie der Welt und deren Schöpfung, die in seinem Dialog „Timaios“ als Schöpfungsgeschichte dargestellt wird. In dieser teleologischen Theorie verknüpft er die Kosmologie mit seiner Ideenlehre und sucht eine transzendentale Ursache für die Entstehung des Kosmos, der durch den Demiurgen – der letzten Ursache als ethisches Element – geschaffen worden ist.
Auch Aristoteles – ein Schüler Platons – entwickelt eine teleologische Theorie, die universell die Natur und deren Ziel erklären soll. In seiner Schrift mit dem Titel „Metaphysik“ , besonders im Buch XII, wird als logische Konsequenz aller Bewegungen und Entwicklungsprozesse der unbewegten Beweger als immanente Ursache bestimmt, auf die er bereits in seinem Werk „Physik“ , in dem er die belebte Natur beschreibt, deutlich hinweist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das platonische Konzept
- Die platonische Naturphilosophie
- Der Demiurg
- Das aristotelische Konzept
- Die aristotelische Naturphilosophie
- Der unbewegte Beweger
- Die wesentlichen Merkmale der Konzepte im Vergleich
- Die Finalursachen im Vergleich
- Fazit
- Quellen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Konzepte des Platonschen Demiurgen und des Aristoteleschen unbewegten Bewegers als antike Modelle der Naturphilosophie oder der Theologie verstanden werden können. Sie vergleicht die Darstellung des Demiurgen in Platons "Timaios" mit der Darstellung des unbewegten Bewegers in Aristoteles' "Physik" und "Metaphysik".
- Platons Konzept des Demiurgen als transzendentale Ursache der Weltentstehung
- Aristoteles' Konzept des unbewegten Bewegers als immanente Ursache von Bewegung und Entwicklung
- Vergleich der wesentlichen Merkmale der beiden Konzepte
- Untersuchung der Finalursachen im Vergleich
- Klärung der Frage, ob die Theorien von Platon und Aristoteles eher naturphilosophisch oder theologisch ausgerichtet sind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und erläutert den historischen Hintergrund der antiken Naturphilosophie. Sie führt die Konzepte des Demiurgen und des unbewegten Bewegers ein und skizziert den Forschungsgegenstand. Das zweite Kapitel widmet sich der platonischen Naturphilosophie und untersucht die Beziehung zwischen Ideenlehre und Naturphilosophie. Im dritten Kapitel wird der Demiurg als transzendentale Ursache der Weltentstehung vorgestellt. Das vierte Kapitel befasst sich mit der aristotelischen Naturphilosophie und erläutert den unbewegten Beweger als immanente Ursache von Bewegung und Entwicklung. Das fünfte Kapitel vergleicht die wesentlichen Merkmale der Konzepte von Platon und Aristoteles. Im sechsten Kapitel werden die Finalursachen der beiden Konzepte gegenübergestellt. Das siebte Kapitel führt die Arbeit zum Abschluss und beantwortet die Frage, ob es sich bei den Theorien von Platon und Aristoteles um Modelle der Naturphilosophie oder der Theologie handelt.
Schlüsselwörter
Antike Naturphilosophie, Platon, Demiurg, Aristoteles, unbewegter Beweger, transzendentale Ursache, immanente Ursache, Finalursache, Timaios, Physik, Metaphysik, Kosmologie, Schöpfung, Bewegung, Entwicklung, Theologie, Philosophie, Ideenlehre
- Quote paper
- Rita Hering (Author), 2010, Sind Platons „Demiurg“ und der „Unbewegte Beweger“ des Aristoteles antike Modelle der Naturphilosophie oder der Theologie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167001