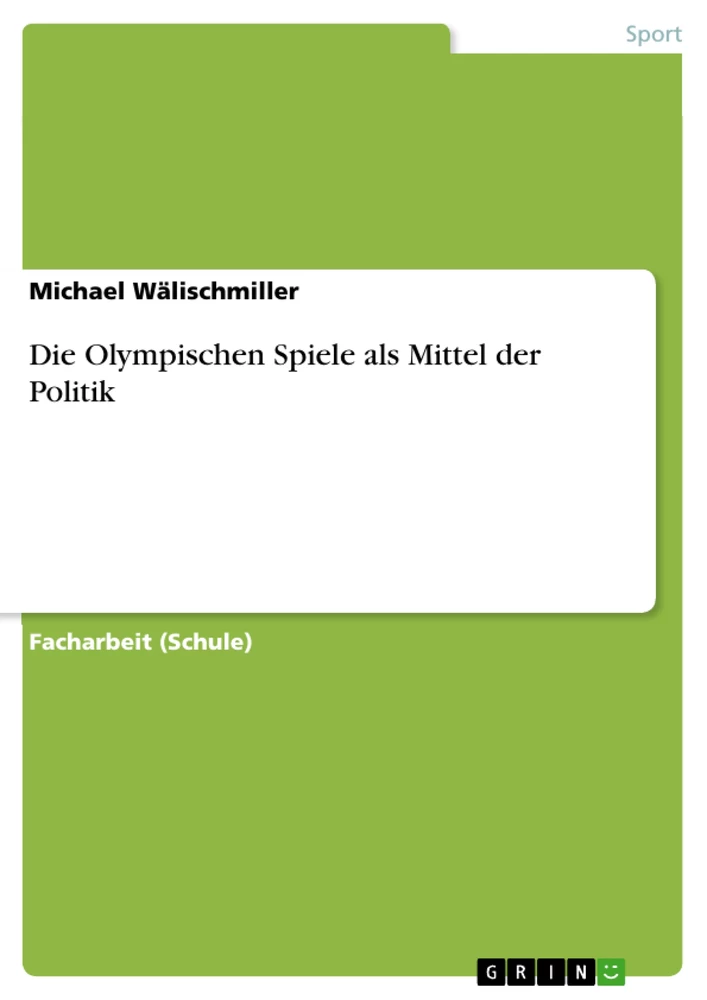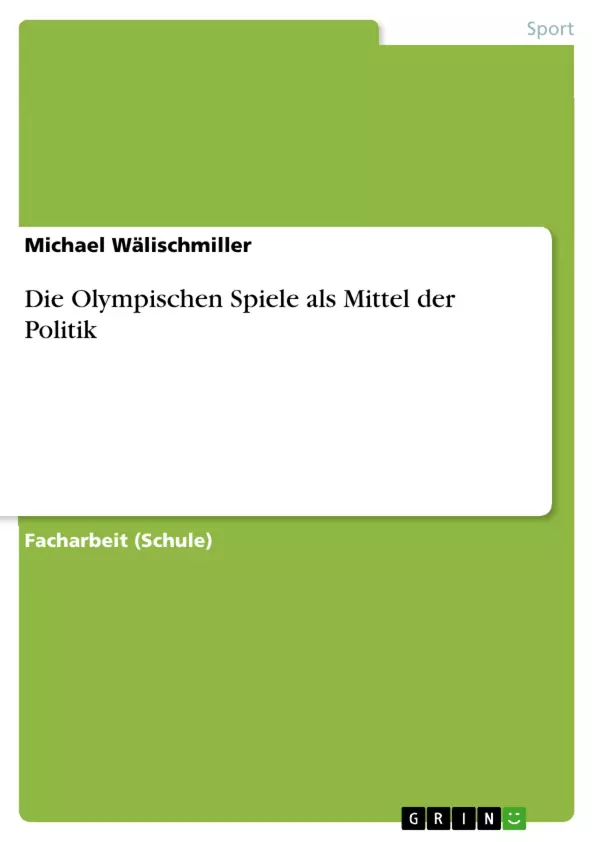Nach Baron Pierre de Coubertin, dem Mann, der die Olympischen Spiele 1896 in Athen wieder zum Leben erweckte, ist das oberste Ziel der Spiele Völkerverständigung. Ausdruck findet dieser Wunsch in der Olympischen Charta, dem „Regelwerk“ der Spiele, an das sich jede teilnehmende Nation und jeder Sportler zu halten hat, zum anderen ist auch die olympische Flagge ein Symbol dafür. Sie besteht aus fünf verschiedenfarbigen ineinander verschlungenen Ringen, wobei die Ringe für die fünf Kontinente der Erde stehen. Auf der olympischen Fahne erscheinen die Ringe auf weißem Grund. Ihre Farben – blau, gelb, schwarz, grün, rot und weiß – repräsentieren gleichzeitig die Nationalflaggen aller Nationen. Die Flagge veranschaulicht so also gewissermaßen einen internationalen Zusammenhalt aller Staaten. Coubertins große Hoffnung war es, dass die Spiele durch die Begegnung der Jugend im sportlichen Wettkampf einen wichtigen Beitrag zum Weltfrieden leisten würden. Die Hoffnung blieb Utopie.
Von Beginn an hatte es die olympische Bewegung nicht leicht. Man hatte einerseits mit der Zerstrittenheit der europäischen Staaten zu kämpfen und andererseits mit den imperialistischen Ansprüchen der Großmächte weltweit. Direkt und indirekt nahm die Politik damit stets Einfluss auf die Olympiaden. Doch damit nicht genug: Immer wieder in ihrer Geschichte wurden die Olympischen Spiele von Staaten, Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen dazu benutzt, sich Gehör zu verschaffen und politische Interessen zu vertreten oder durchzusetzen. Die Spiele, bis hin zu den Sportlern, wurden dafür instrumentalisiert. Allzu oft wirkten die Absichten die dahinter standen, dem ursprünglichen Friedensgedanken von Coubertin entgegen.
Aber auch seine Intuition ist keineswegs eine rein sportliche. Geht es um die Frage, ob die Olympischen Spiele ein Mittel der Politik sind, ist schon Coubertins Zielsetzung ein eindeutiger Hinweis. Denn Frieden und Völkerverständigung sind Aufgaben der Politik. Der Sport kann dabei höchstens Mittel zum Zweck sein, also ein Werkzeug der Politik. Die Olympischen Spiele sind im Positiven wie im Negativen Mittel der Politik. Diese Aussage soll in der nun folgenden Arbeit untermauert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Der olympische Gedanke nach Baron Pierre de Coubertin.
- Die Olympischen Spiele in der Antike
- Der heilige Friede\": Politik als Voraussetzung für die Spiele
- Kräftemessen zwischen Stadtstaaten
- Wiedereinführung der Spiele im 19. Jahrhundert.
- Coubertin und die olympische Bewegung.
- Die ersten Spiele 1896 bis 1912
- Die Spiele als Mittel der Politik.
- Der Erste Weltkrieg: Die Spiele in Abhängigkeit von der Politik.
- Antwerpen 1920: Ausschluss als Sanktionsmittel.
- Die Olympischen Spiele 1936: Nationalsozialistische Propaganda, Beschwichtigung und Verschleierung.
- Die Olympischen Spiele als „Waffe“ im Kalten Krieg: Sportpolitik am Beispiel der DDR
- Die Olympischen Spiele in Mexiko 1968.
- Blutiges Massaker.
- Protest und Demonstration: Black Power
- Die Olympiade in München 1972: Terrorismus.
- Boykotte
- Rassismus und Sticheleien: Die Spiele 1952 bis 1972.
- Höhepunkt des Kalten Krieges.
- Der Krieg in Afghanistan und die Spiele in Moskau 1980
- Die Spiele in Los Angeles 1984
- Das Internationale Olympische Komitee
- Status und Aufgaben
- Politische Möglichkeiten
- Die Spiele als Beitrag zum Frieden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit befasst sich mit der Rolle der Olympischen Spiele als Mittel der Politik. Es wird untersucht, wie die Spiele im Laufe der Geschichte von Staaten und Organisationen für politische Zwecke instrumentalisiert wurden und welche Auswirkungen dies auf die Olympische Bewegung hatte.
- Der olympische Gedanke nach Baron Pierre de Coubertin
- Die Olympischen Spiele als Mittel der Politik im 20. Jahrhundert
- Die Instrumentalisierung der Spiele durch den Nationalsozialismus und im Kalten Krieg
- Der Einfluss des Internationalen Olympischen Komitees auf die politische Ausrichtung der Spiele
- Die Bedeutung der Olympischen Spiele als Beitrag zum Frieden
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt den olympischen Gedanken nach Baron Pierre de Coubertin, dem Gründer der modernen Olympischen Spiele. Es wird die Bedeutung des Friedensideals im olympischen Kontext erörtert und die Utopie Coubertins, durch die Spiele Völkerverständigung zu fördern, vorgestellt.
Kapitel 2 widmet sich den Olympischen Spielen in der Antike. Es werden die Rolle der Spiele im politischen Leben der griechischen Stadtstaaten und die Bedeutung des „heiligen Friedens“ für die Durchführung der Spiele beleuchtet.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Wiedereinführung der Spiele im 19. Jahrhundert. Es wird die Rolle Coubertins bei der Gründung der modernen Olympischen Bewegung und die Entwicklung der ersten Spiele von 1896 bis 1912 dargestellt.
Kapitel 4 untersucht den Einfluss der Politik auf die Olympischen Spiele im 20. Jahrhundert. Es werden verschiedene Beispiele für die Instrumentalisierung der Spiele für politische Zwecke, wie z. B. die Spiele 1936 in Berlin unter der nationalsozialistischen Herrschaft oder die Spiele während des Kalten Krieges, analysiert.
Kapitel 5 befasst sich mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dessen politischer Rolle. Es werden die Aufgaben und Möglichkeiten des IOC im Hinblick auf die politische Ausrichtung der Spiele dargestellt.
Kapitel 6 untersucht die Bedeutung der Olympischen Spiele als Beitrag zum Frieden. Es wird diskutiert, ob die Spiele tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Beziehungen zwischen den Nationen haben können.
Schlüsselwörter
Olympische Spiele, Olympische Bewegung, Baron Pierre de Coubertin, Friedensgedanke, Völkerverständigung, Politik, Nationalsozialismus, Kalter Krieg, Boykott, Internationales Olympisches Komitee, Sportpolitik, Terrorismus.
- Citar trabajo
- Michael Wälischmiller (Autor), 2010, Die Olympischen Spiele als Mittel der Politik , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167008