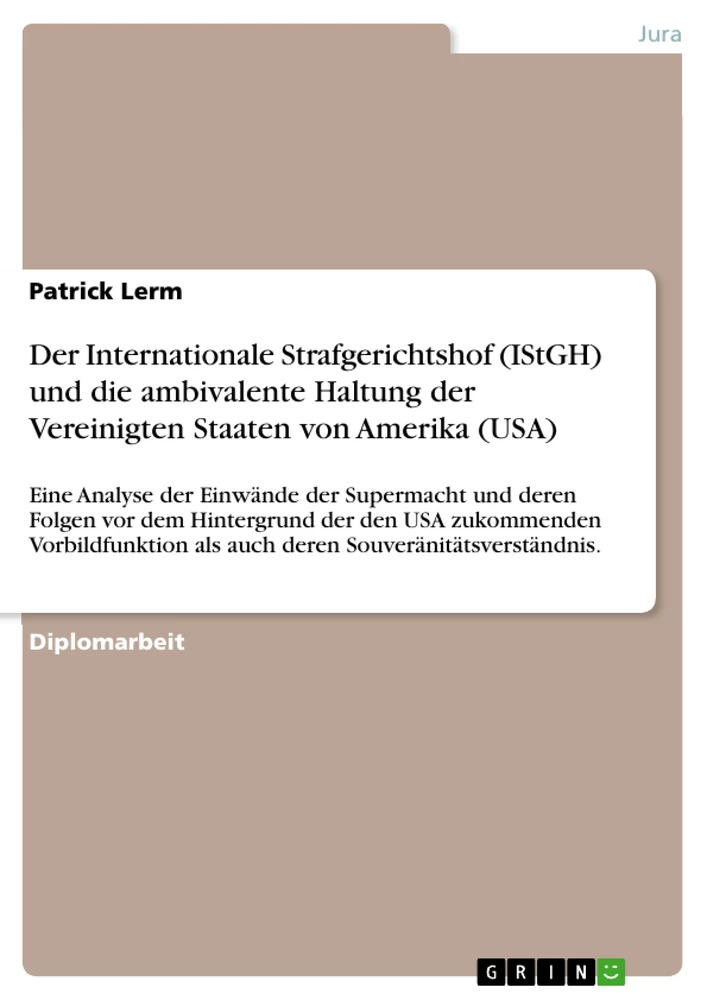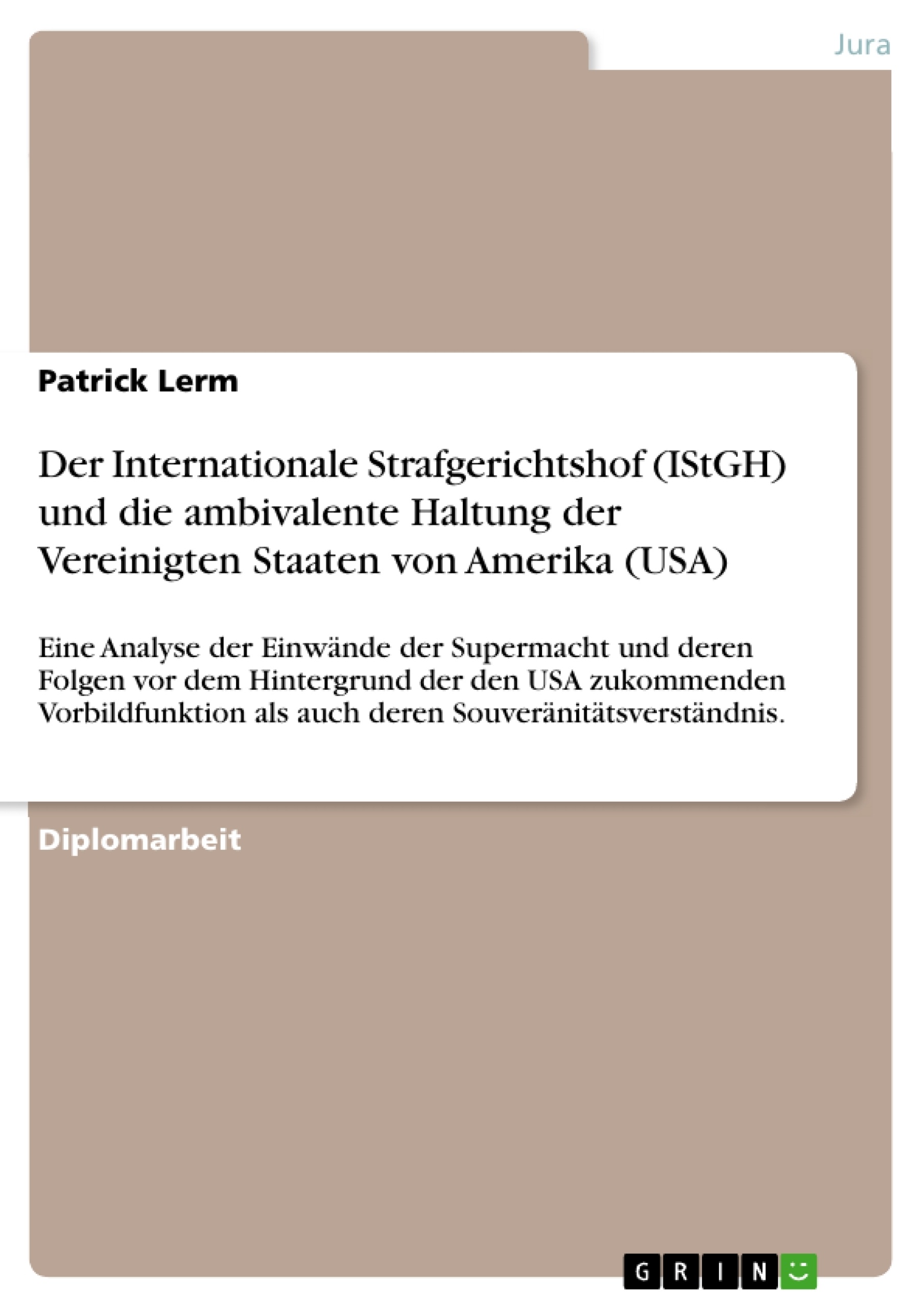Abstract
Der IStGH ist der Beweis dafür, dass die Mehrheit der internationalen
Staatengemeinschaft von dem Willen geprägt ist, der Begehung
schwerster völkerrechtlicher Verbrechen Einhalt zu gebieten. Es existiert jedoch ein Defizit der noch jungen Institution – nämlich die Ablehnung durch die USA. Dabei war es gerade jene Supermacht, die im Verlauf der Geschichte beachtliche Beiträge zur Durchsetzung des Völkerstrafrechts leistete. Ein Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die Argumente der USA zu analysieren und zu diskutieren. Zunächst werden jedoch – unter Verzicht auf die Tiefe der Darstellung – die „Eckpfeiler‘‘ des IStGH wie etwa die Zulässigkeit eines Verfahrens herausgearbeitet, ohne die die Argumente der USA nicht zu verstehen sind. Die mangelnde Kontrollmöglichkeit des IStGH, gepaart mit der Befürchtung, dass Teile der souveränen Strafgewalt an ein internationales Strafgericht übertragen werden könnten, stellt ein zentrales Ergebnis dar. Zudem kommt, dass der US-Kongress einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Außenpolitik besitzt. Das Verhältnis der USA zum Völkerrecht ist dabei durch das Vorliegen von zwei Grundtendenzen, nämlich die des Uni- und Multilateralismus gekennzeichnet (Ambivalenz). Wird ein multilateraler Mechanismus wie der IStGH als „störend“ empfunden, so wird dieser nicht angewandt. Die Untersuchung der Folgen des Fernbleibens der USA hat gezeigt, dass obwohl der IStGH ohne die USA geschwächt wird, ein Scheitern des Gerichtshofes nicht wahrscheinlich ist. Bezogen auf die USA, so reiht sich die Ablehnung des IStGH in eine Reihe von Ereignissen ein, die zu einer gegenwärtigen Glaubwürdigkeitskrise geführt haben.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Institution – Internationaler Strafgerichtshof
- I. Diplomatische Konferenz von Rom
- 1. Beteiligte
- 2. Ergebnis
- 3. Verhandlungsposition der USA
- II. IStGH-Statut im Überblick
- III. Organisationsstruktur
- IV. Zuständigkeit
- 1. Materielle Zuständigkeit
- 2. Zuständigkeit in personeller und zeitlicher Hinsicht
- 3. Formelle Zuständigkeit
- V. Das Initiieren eines Verfahrens
- 1. Vertragsstaat
- 2. Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
- 3. Anklagebehörde
- VI. Grundsatz der Komplementarität
- I. Diplomatische Konferenz von Rom
- C. Analyse und Diskussion der Einwände der USA
- I. Unzulässige Rechtswirkung auf Drittstaaten
- 1. Das Territorialitätsprinzip und das daraus resultierende Anklagepotential
- 2. Das Prinzip der Komplementarität und der Zwang zur Strafverfolgung für Nicht-Vertragsstaaten
- 3. Die Problematik ausgewählter Bestimmungen des IStGH-Statuts
- a) Artikel 121 V IStGH-Statut
- b) Artikel 124 IStGH-Statut
- II. Die Rolle des unabhängigen Anklägers und die Gefahr politisch motivierter Strafverfolgung
- III. Das IStGH-Statut im Widerspruch zur Verfassung der USA
- IV. Ungerechtfertigter Eingriff in den Einflussbereich des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
- V. Verlust von nationaler Souveränität
- I. Unzulässige Rechtswirkung auf Drittstaaten
- D. Ursachen der US-amerikanischen Haltung
- I. Die US-Außenpolitik und das Verhältnis zum Völkerrecht
- II. Der Kongress und das Souveränitätsverständnis der USA
- E. Initiativen der USA zur Verhinderung einer Strafverfolgung durch den IStGH
- I. Nationale Ebene: American Service Members Protection Act
- 1. Sinn und Zweck von Artikel 98 IStGH-Statut
- 2. Intention der USA
- 3. Problematiken des Artikels 98 II IStGH-Statut
- II. Multilaterale Ebene
- 1. Rücknahme der Unterzeichnung des IStGH-Statuts
- 2. Resolutionen 1422 (2002) und 1487 (2003) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
- III. Bilaterale Ebene: Nicht-Überstellungsübereinkommen auf der Grundlage von Artikel 98 II IStGH-Statut
- I. Nationale Ebene: American Service Members Protection Act
- F. Folgen der US-amerikanischen Haltung
- I. Die USA als Akteur im internationalen System
- 1. Ansehen der USA
- 2. Wirkungen auf andere Staaten
- II. Der IStGH und die Folgen für dessen Effektivität
- I. Die USA als Akteur im internationalen System
- G. Lösungsansätze, um die USA von der Unterstützung des IStGH zu überzeugen
- I. Zugeständnisse an die USA: Chance oder Risiko?
- 1. Zusicherung einer generellen Immunität
- 2. Hinzufügung des Terrorismus als weiteren Verbrechenstatbestand
- II. Die Resolution 1593 (2005), die Rolle des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und die Position der USA
- 1. Historischer Kontext
- 2. Die Bewertung der Resolution 1593 (2005) im Hinblick auf die zukünftige Haltung der USA
- I. Zugeständnisse an die USA: Chance oder Risiko?
- H. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der ambivalenten Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). Sie analysiert die Einwände der Supermacht gegen den IStGH und deren Folgen, vor dem Hintergrund der den USA zukommenden Vorbildfunktion sowie deren Souveränitätsverständnis.
- Die Entstehungsgeschichte und Struktur des IStGH
- Die zentralen Einwände der USA gegen den IStGH
- Die Ursachen der US-amerikanischen Haltung
- Die Folgen der US-amerikanischen Haltung für den IStGH und das internationale System
- Mögliche Lösungsansätze, um die USA von der Unterstützung des IStGH zu überzeugen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel B: Dieses Kapitel stellt den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) als Institution vor. Es beschreibt die Entstehung des IStGH auf der Diplomatischen Konferenz von Rom, beleuchtet die Verhandlungsposition der USA und gibt einen Überblick über das IStGH-Statut. Zudem werden die Organisationsstruktur, die Zuständigkeit und das Verfahren zur Einleitung eines Verfahrens erläutert. Schließlich wird der Grundsatz der Komplementarität im Kontext des IStGH-Statuts beleuchtet.
- Kapitel C: In diesem Kapitel werden die zentralen Einwände der USA gegen den IStGH analysiert und diskutiert. Dabei werden die Argumente der USA hinsichtlich der unzulässigen Rechtswirkung auf Drittstaaten, der Rolle des unabhängigen Anklägers, des Widerspruchs zwischen dem IStGH-Statut und der US-Verfassung, des Eingriffs in den Einflussbereich des Sicherheitsrates und des Verlustes von nationaler Souveränität behandelt.
- Kapitel D: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen der US-amerikanischen Haltung gegenüber dem IStGH. Dabei werden die US-Außenpolitik und das Verhältnis zum Völkerrecht sowie das Souveränitätsverständnis der USA im Kontext des Kongresses beleuchtet.
- Kapitel E: In diesem Kapitel werden die Initiativen der USA zur Verhinderung einer Strafverfolgung durch den IStGH vorgestellt. Dazu gehören die nationalen Maßnahmen des American Service Members Protection Act, multilaterale Initiativen wie die Rücknahme der Unterzeichnung des IStGH-Statuts und Resolutionen des Sicherheitsrates, sowie bilaterale Nicht-Überstellungsübereinkommen.
- Kapitel F: Dieses Kapitel analysiert die Folgen der US-amerikanischen Haltung für die USA als Akteur im internationalen System sowie für den IStGH und dessen Effektivität. Es beleuchtet die Auswirkungen auf das Ansehen der USA, die Reaktionen anderer Staaten und die Herausforderungen für den IStGH.
- Kapitel G: In diesem Kapitel werden Lösungsansätze diskutiert, um die USA von der Unterstützung des IStGH zu überzeugen. Dabei werden Zugeständnisse an die USA sowie die Rolle des Sicherheitsrates im Kontext der Resolution 1593 (2005) behandelt.
Schlüsselwörter
Internationaler Strafgerichtshof, IStGH, USA, Diplomatische Konferenz von Rom, IStGH-Statut, Souveränität, Völkerrecht, US-Außenpolitik, Komplementarität, Anklagebehörde, Sicherheitsrat, American Service Members Protection Act, Resolutionen, Nicht-Überstellungsübereinkommen, Effektivität.
Häufig gestellte Fragen
Warum lehnen die USA den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ab?
Zentrale Gründe sind die Sorge vor dem Verlust nationaler Souveränität, die Befürchtung politisch motivierter Anklagen gegen US-Bürger und der vermeintliche Widerspruch zur US-Verfassung.
Was bedeutet der Grundsatz der Komplementarität beim IStGH?
Der IStGH wird nur dann tätig, wenn nationale Justizsysteme nicht willens oder nicht in der Lage sind, schwerste Verbrechen selbst zu verfolgen.
Welche Maßnahmen ergriffen die USA gegen den Gerichtshof?
Die USA verabschiedeten den American Service Members Protection Act, zogen ihre Unterschrift unter das Statut zurück und schlossen bilaterale Nicht-Überstellungsübereinkommen ab.
Wie wirkt sich das Fernbleiben der USA auf den IStGH aus?
Obwohl der Gerichtshof ohne die Supermacht geschwächt ist, gilt ein Scheitern der Institution als unwahrscheinlich. Die USA leiden jedoch unter einer Glaubwürdigkeitskrise im Völkerrecht.
Gibt es Lösungsansätze für eine künftige Zusammenarbeit?
Diskutiert werden Zugeständnisse wie Immunitätszusagen oder die Aufnahme von Terrorismus als Straftatbestand, sowie eine stärkere Einbindung über den UN-Sicherheitsrat.
- Citation du texte
- Patrick Lerm (Auteur), 2009, Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und die ambivalente Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167028