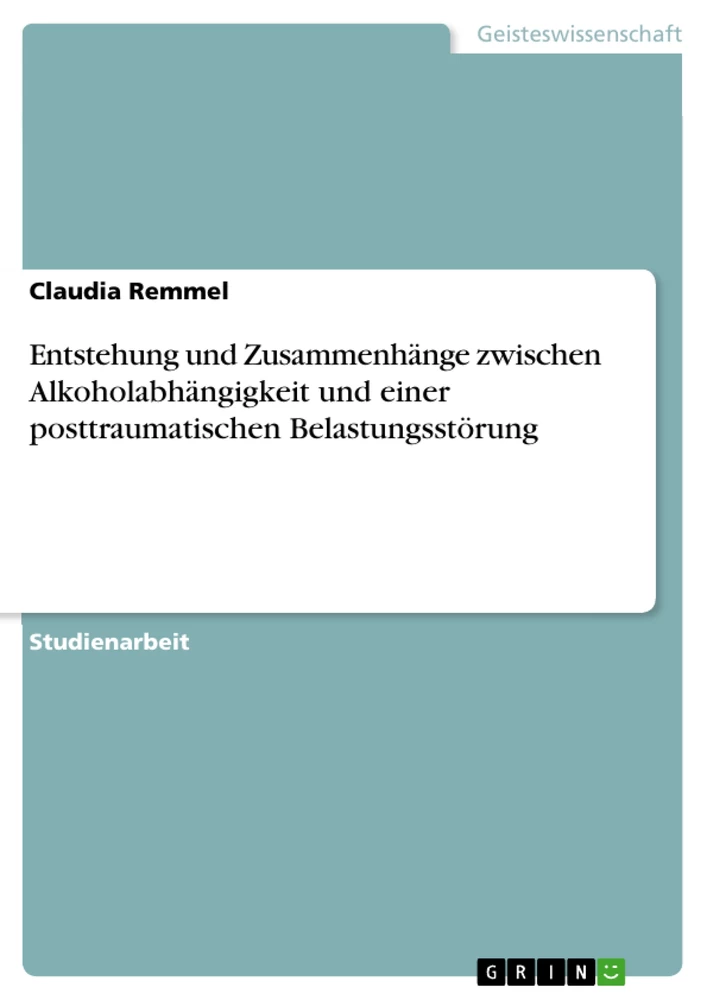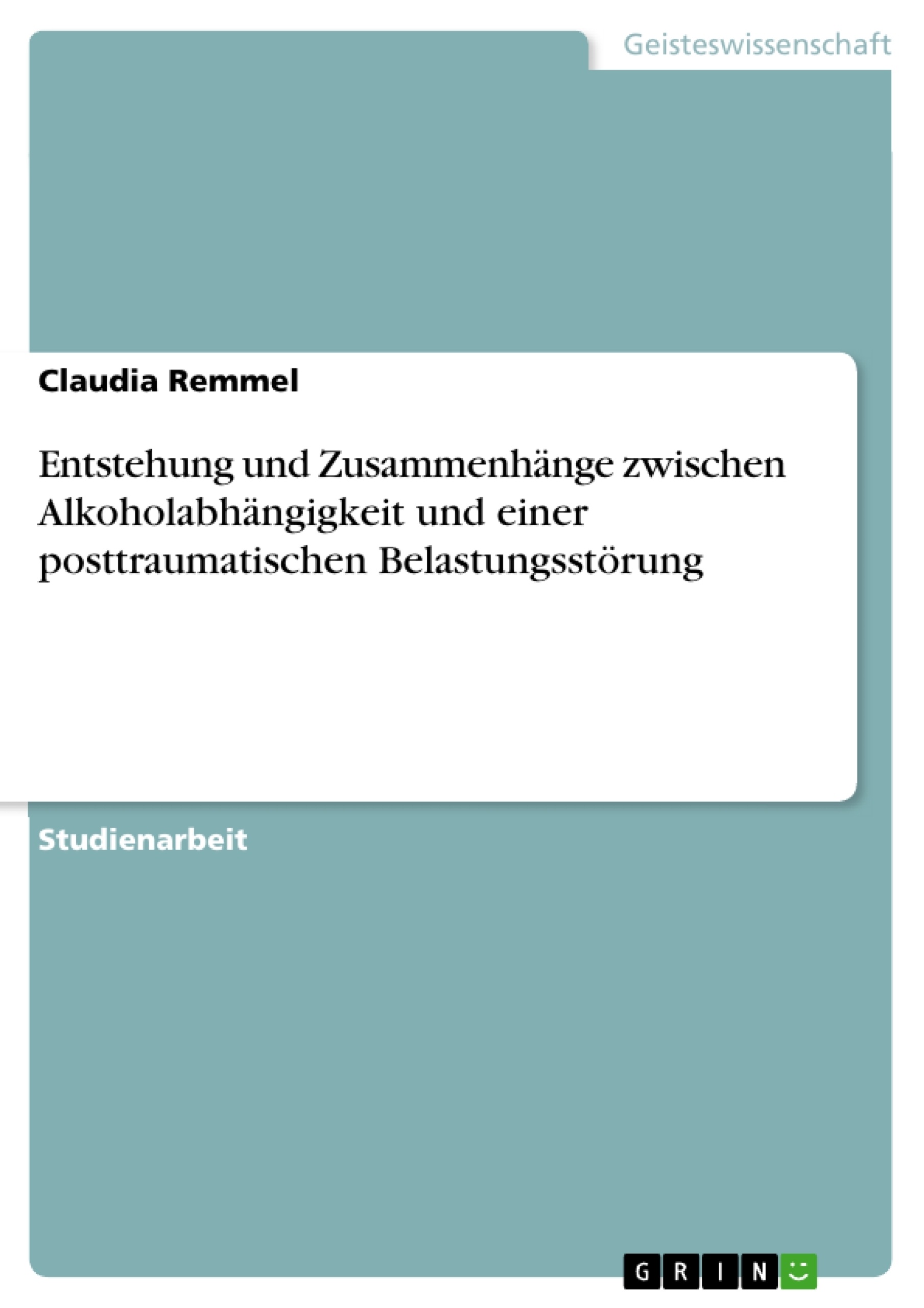Aufgrund mehrerer Studien lassen sich Zusammenhänge zwischen Traumatisierungen und Substanzabhängigkeit belegen. In der folgenden Ausarbeitung werden wir uns mit der Thematik auseinandersetzen, worin diese Zusammenhänge bestehen, wie diese sich äußern und gegenseitig beeinflussen. Um eine weitreichende Vertiefung in diese Thematik gewährleisten zu können, werden wir uns nur auf eine Folge einer Traumatisierung, die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), beschränken. Zudem werden wir uns aus den zuvor genannten Gründen, auf den Alkoholismus konzentrieren, da Alkoholismus generell die häufigste Prävalenz für Missbrauch und Abhängigkeit darstellt.
In dem Großteil der von uns verwendeten Literatur, die wir zur Ausarbeitung unserer Thematik verwenden werden, wird zumeist die allumfassende Bezeichnung „Substanzabhängigkeit“ verwendet. Im Folgenden werden wir ebenfalls den Begriff „Substanz“ einsetzen, welcher immer auch den Alkohol einschließt.
Um den Einstieg in diese komplexe Thematik zu erleichtern, werden wir uns zu Beginn umfassend mit der Definition und den damit zusammenhängenden Auswirkungen eines traumatischen Ereignisses befassen. Ebenfalls werden wir auf die Arten eines Traumas eingehen, da diese auf die PTBS-Symptome Einfluss nehmen und somit die individuelle Personen-Umwelt-Bewältigung beeinflussen. Desweiteren werden wir sowohl auf die Risikofaktoren für die Entstehung einer PTBS, als auch einer Alkoholabhängigkeit eingehen, denn diese spielen eine entscheidende Rolle, inwieweit das Individuum mit seinen Schutzfaktoren auf diese Risikofaktoren einwirken kann.
Um dieses multifaktorielle Geschehen in Verbindung zu bringen, werden wir das Trias-Modell zur Entstehung der Drogenabhängigkeit anführen und erläutern.
Darauf folgen zwei Hypothesen, die Kunzke (2008) als mögliche kausale Zusammenhänge zwischen Sucht und Trauma anführt. Diese Hypothesen dienen uns zur Verdeutlichung des wechselseitigen Verhältnisses von Person, Umwelt und Droge.
Um zu veranschaulichen, dass nicht jedes traumatische Ereignis und die daraus entstandene PTBS zu einer Alkoholabhängigkeit führt, werden wir die individuellen Bewältigungsformen einer komplexen Personen-Umwelt-Beziehung darlegen.
Abschließend werden wir die Entstehungszusammenhänge von Alkoholkonsum aufgrund einer PTBS anhand der Selbstmedikamentionshypotese sowie die daraus entstehende Abhängigkeit mittels des Teufelskreismodels von Küfner (1981) beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Trauma und PTBS
- 2.1 Definition Trauma
- 2.2 Arten von Traumata
- 2.3 Definition Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- 2.4 Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS
- 2.4.1 Demografische Variablen
- 2.4.2 Prätraumatische Variablen
- 2.4.3 Peritraumatische Variablen
- 2.6 Das Trias-Modell zur Entstehung der Drogenabhängigkeit
- 2.7 Mögliche kausale Zusammenhänge zwischen Sucht und Trauma
- 3. Bewältigungsformen von PTBS im Kontext einer komplexen Personen-Umwelt-Beziehung
- 3.1 Posttraumatische Attributionen und Kognitionen
- 3.2 Dimensionen der Bewältigung
- 3.3 Soziale Unterstützung
- 4. Entstehung einer Alkoholabhängigkeit aufgrund einer PTBS
- 4.1 Hypothese der Selbstmedikation
- 4.2 Teufelskreismodell der Sucht
- 5. Folgen für die Behandlung der Sucht
- 6. Eigene kritische Analyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Traumatisierungen, insbesondere der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), und Alkoholabhängigkeit. Ziel ist es, die bestehenden Beziehungen zwischen Trauma und Sucht aufzuzeigen und deren gegenseitige Beeinflussung zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf dem Alkoholismus aufgrund seiner hohen Prävalenz.
- Definition und Auswirkungen traumatischer Ereignisse
- Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS und Alkoholabhängigkeit
- Kausale Zusammenhänge zwischen Trauma und Sucht anhand von Modellen (Trias-Modell, Teufelskreismodell)
- Individuelle Bewältigungsstrategien im Kontext einer komplexen Personen-Umwelt-Beziehung
- Die Selbstmedikationshypothese im Zusammenhang mit der Entstehung von Alkoholabhängigkeit aufgrund von PTBS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Zusammenhänge zwischen Traumatisierungen und Substanzabhängigkeit ein und begründet die Fokussierung auf PTBS und Alkoholismus aufgrund der hohen Prävalenz von Alkoholismus und der Notwendigkeit einer eingegrenzten Betrachtung für eine tiefgreifende Analyse. Es wird der Forschungsansatz skizziert, der die Definition und Auswirkungen traumatischer Ereignisse, Risikofaktoren für PTBS und Alkoholabhängigkeit sowie Bewältigungsmechanismen umfasst. Das Trias-Modell und die Selbstmedikationshypothese werden als zentrale Erklärungsmodelle angekündigt.
2. Trauma und PTBS: Dieses Kapitel definiert Trauma als eine extreme, existenzbedrohende Situation, die zu bleibenden Schäden führen kann. Es differenziert zwischen verschiedenen Arten von Traumata (Ursachen, Modi, sekundäres Trauma, Typen) und erläutert die diagnostischen Kriterien der PTBS gemäß ICD-10. Die detaillierte Darstellung verschiedener Traumaarten und deren Auswirkungen auf die PTBS-Symptome legt den Grundstein für das Verständnis der individuellen Bewältigungsmechanismen, die später im Text behandelt werden. Die ausführliche Auseinandersetzung mit den Risikofaktoren (demografisch, prätraumatisch, peritraumatisch) liefert wertvolle Einblicke in die Vulnerabilität und Widerstandsfähigkeit von Individuen.
3. Bewältigungsformen von PTBS im Kontext einer komplexen Personen-Umwelt-Beziehung: Dieses Kapitel erörtert, wie Betroffene mit PTBS die komplexen Herausforderungen ihrer Situation bewältigen. Es beleuchtet posttraumatische Attributionen und Kognitionen, verschiedene Dimensionen der Bewältigung und die Bedeutung sozialer Unterstützung. Der Fokus liegt auf der individuellen Anpassung an das Trauma und die Bedeutung des sozialen Umfelds für den Heilungsprozess. Die Zusammenhänge zwischen individuellen Bewältigungsstrategien und dem Verlauf der PTBS werden hier detailliert untersucht.
4. Entstehung einer Alkoholabhängigkeit aufgrund einer PTBS: Dieses Kapitel widmet sich der Entstehung von Alkoholabhängigkeit als Folge einer PTBS. Es erläutert die Hypothese der Selbstmedikation als mögliche Erklärung für den Substanzmissbrauch und das Teufelskreismodell der Sucht. Die Kapitel analysiert die Wechselwirkung zwischen Trauma, PTBS und dem Entwicklungsverlauf einer Alkoholabhängigkeit, um die Entstehung besser zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Mechanismen, die zu einer Abhängigkeit führen, unter besonderer Berücksichtigung des selbstregulierenden Verhaltens der Betroffenen.
Schlüsselwörter
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Alkoholabhängigkeit, Trauma, Risikofaktoren, Bewältigungsmechanismen, Selbstmedikation, Teufelskreismodell, Trias-Modell, Personen-Umwelt-Beziehung, Suchtentstehung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Trauma, PTBS und Alkoholabhängigkeit
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments?
Das Dokument untersucht die Zusammenhänge zwischen Traumatisierungen, insbesondere der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), und der Alkoholabhängigkeit. Es beleuchtet die gegenseitige Beeinflussung und konzentriert sich dabei aufgrund der hohen Prävalenz auf den Alkoholismus.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Auswirkungen traumatischer Ereignisse, Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS und Alkoholabhängigkeit, kausale Zusammenhänge zwischen Trauma und Sucht (Trias-Modell, Teufelskreismodell), individuelle Bewältigungsstrategien im Kontext einer komplexen Personen-Umwelt-Beziehung, und die Selbstmedikationshypothese im Zusammenhang mit der Entstehung von Alkoholabhängigkeit aufgrund von PTBS.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Trauma und PTBS (inkl. Definition, Arten von Traumata, Risikofaktoren), Bewältigungsformen von PTBS, die Entstehung von Alkoholabhängigkeit aufgrund von PTBS (Selbstmedikationshypothese, Teufelskreismodell), die Folgen für die Behandlung der Sucht, und eine eigene kritische Analyse. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Modelle zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Trauma und Sucht werden vorgestellt?
Das Dokument verwendet das Trias-Modell und das Teufelskreismodell der Sucht, um die kausalen Zusammenhänge zwischen Trauma und Sucht zu erläutern. Das Trias-Modell wird im Kontext des Kapitels zu Trauma und PTBS vorgestellt, das Teufelskreismodell im Zusammenhang mit der Entstehung von Alkoholabhängigkeit aufgrund von PTBS.
Welche Rolle spielt die Selbstmedikationshypothese?
Die Selbstmedikationshypothese wird als mögliche Erklärung für den Substanzmissbrauch im Kontext einer PTBS dargestellt. Sie wird im Kapitel zur Entstehung einer Alkoholabhängigkeit aufgrund einer PTBS ausführlicher behandelt.
Welche Bewältigungsmechanismen werden betrachtet?
Das Dokument untersucht posttraumatische Attributionen und Kognitionen, verschiedene Dimensionen der Bewältigung und die Bedeutung sozialer Unterstützung als Bewältigungsmechanismen von PTBS im Kontext einer komplexen Personen-Umwelt-Beziehung.
Welche Risikofaktoren werden für die Entwicklung von PTBS und Alkoholabhängigkeit genannt?
Das Dokument differenziert zwischen demografischen, prätraumatischen und peritraumatischen Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS. Die spezifischen Risikofaktoren für Alkoholabhängigkeit werden im Kontext des Zusammenhangs mit PTBS diskutiert.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die bestehenden Beziehungen zwischen Trauma und Sucht aufzuzeigen und deren gegenseitige Beeinflussung zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf dem Alkoholismus aufgrund seiner hohen Prävalenz.
- Citar trabajo
- Claudia Remmel (Autor), 2011, Entstehung und Zusammenhänge zwischen Alkoholabhängigkeit und einer posttraumatischen Belastungsstörung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167032