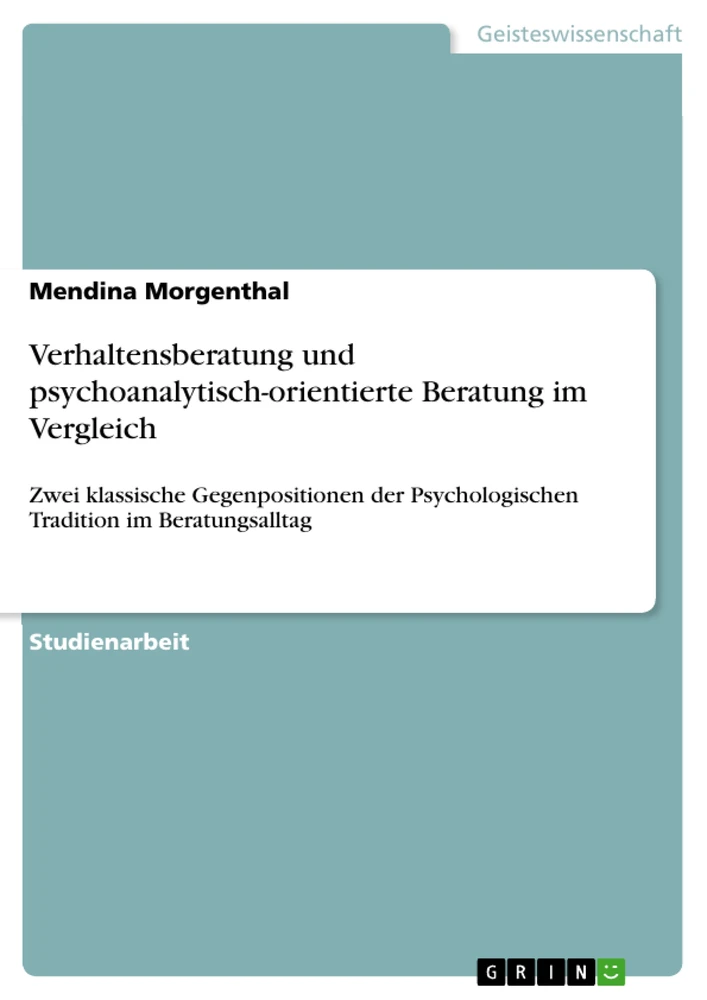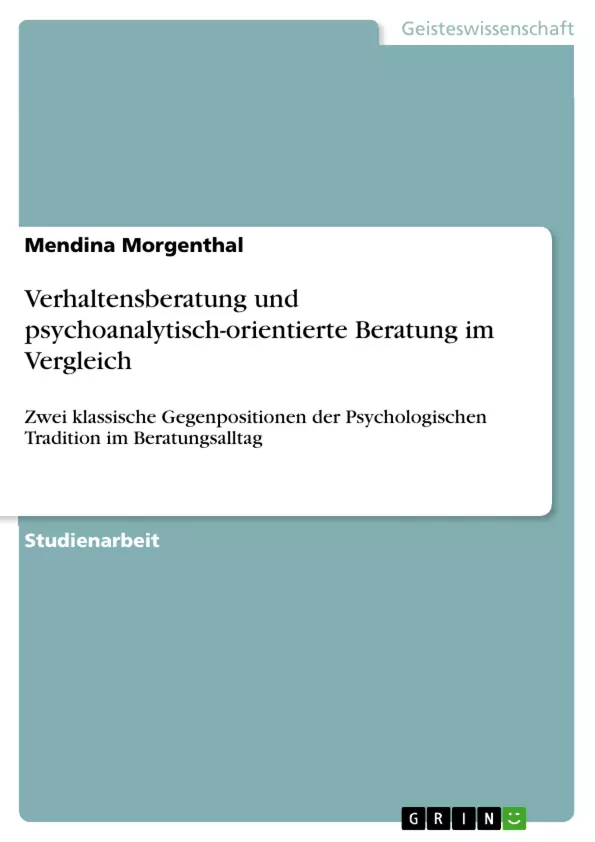Warum ist es wichtig oder sogar notwendig, sich mit verschiedenen Beratungskonzepten (bzw. deren zugrundeliegenden Theorien) auseinanderzusetzten? Kann man nicht einfach eine Theorie auswählen, weil sie die Richtige ist, um Verhalten zu erklären und den richtigen Lösungsweg vorgibt?
Das wäre natürlich einfach, aber es gibt nun mal nicht die Theorie oder das eine Beratungskonzept, denn nicht jedes Problem ist gleich.
Gegenstand dieser Arbeit ist der Vergleich zweier Beratungskonzepte, welche verschiedenen psychologischen Schulen entspringen. Zuerst werden die Grundideen bei-der Konzepte einzeln dargestellt. Anschließend folgt der Vergleich anhand ausgewählter Fragestellungen, welche das jeweilige Menschenbild, Vorstellung von Veränderung und Lernen, die Erklärung der Entstehung von Problemen, sowie die Umsetzung des jeweiligen Konzeptes in der Praxis umfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundannahmen der Verhaltensberatung
- 3. Grundannahmen der Psychoanalytisch- orientierten Beratung
- 4. Vergleich
- 4.1 Menschenbild
- 4.2 Vorstellung von Veränderung und Lernen
- 4.3 Entstehung von Problemen
- 4.4 Umsetzung in der Praxis
- 5. Zusammenfassung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht verhaltenstherapeutische und psychoanalytisch orientierte Beratungsansätze. Ziel ist es, die grundlegenden Annahmen beider Konzepte darzustellen und anhand ausgewählter Kriterien zu vergleichen. Der Fokus liegt auf dem jeweiligen Menschenbild, der Vorstellung von Veränderung und Lernen, der Erklärung von Problemursachen und der praktischen Umsetzung.
- Vergleich des Menschenbildes in Verhaltenstherapie und Psychoanalyse
- Unterschiede in den Lern- und Veränderungsprozessen beider Ansätze
- Analyse der jeweiligen Sichtweise auf die Entstehung psychischer Probleme
- Gegenüberstellung der praktischen Anwendung beider Konzepte in der Beratung
- Abgrenzung der behavioristischen und psychoanalytischen Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Vergleich zweier Beratungsansätze aus unterschiedlichen psychologischen Schulen. Sie benennt die zu vergleichenden Aspekte: Menschenbild, Vorstellung von Veränderung und Lernen, Entstehung von Problemen und praktische Umsetzung. Die Einleitung betont die Bedeutung des Menschenbildes für den Umgang mit Problemen und den Unterschied zwischen Verhaltensänderung und Ursachenforschung. Schließlich wird auf die Gegenläufigkeit von behavioristischem und psychoanalytischem Ansatz hingewiesen, der eine Fokussierung auf Beobachtbare versus innere Prozesse aufweist. Die Arbeit beschränkt sich dabei bewusst auf Ausschnitte beider Konzepte.
2. Grundannahmen der Verhaltensberatung: Dieses Kapitel erläutert die Grundannahmen der Verhaltensberatung, die im Behaviorismus wurzelt. Es betont die Bedeutung empirischer Forschung und die Abkehr von Introspektion. Der Fokus liegt auf beobachtbarem Verhalten, im Gegensatz zu inneren Prozessen. Die Etablierung der Psychologie als wissenschaftliche Disziplin wird als Ziel der Begründer des Behaviorismus hervorgehoben. Schließlich werden wichtige Termini wie Klassische und Operante Konditionierung erwähnt, welche im weiteren Verlauf vertieft werden sollen.
3. Grundannahmen der Psychoanalytisch-orientierten Beratung: Dieses Kapitel stellt die Grundannahmen der psychoanalytisch orientierten Beratung vor, beginnend mit Sigmund Freud als Begründer. Es beschreibt Freuds Persönlichkeitsmodell mit Es, Ich und Über-Ich, wobei das Unbewusste als zentrale Instanz hervorgehoben wird, welche unbewusste Motive und Triebe beinhaltet. Die Triebe werden in Eros und Thanatos unterteilt. Der Einfluss der Kindheit und der psychosexuellen Entwicklungsphasen auf die Entstehung von Konflikten und Neurosen wird ebenfalls erläutert. Der Ödipuskomplex wird als Beispiel für frühkindliche Konflikte genannt. Das Kapitel beschreibt die verschiedenen psychosexuellen Phasen und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung.
Schlüsselwörter
Verhaltensberatung, Psychoanalyse, Behaviorismus, Menschenbild, Veränderung, Lernen, Problemgenese, Empirische Forschung, Konditionierung, Unbewusstes, Es, Ich, Über-Ich, Psychosexuelle Entwicklung, Ödipuskomplex, Libido.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich verhaltenstherapeutischer und psychoanalytisch orientierter Beratungsansätze
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text vergleicht verhaltenstherapeutische und psychoanalytisch orientierte Beratungsansätze. Er beschreibt die Grundannahmen beider Konzepte und vergleicht sie anhand von Kriterien wie Menschenbild, Vorstellung von Veränderung und Lernen, Entstehung von Problemen und praktischer Umsetzung. Der Text enthält eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselbegriffe.
Welche Beratungsansätze werden verglichen?
Der Text vergleicht die verhaltenstherapeutische Beratung (verwurzelt im Behaviorismus) und die psychoanalytisch orientierte Beratung (mit Sigmund Freud als Begründer).
Welche Aspekte der Beratungsansätze werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf vier Hauptaspekte: das jeweilige Menschenbild, die Vorstellung von Veränderung und Lernen, die Erklärung der Entstehung psychischer Probleme und die praktische Umsetzung der jeweiligen Ansätze in der Beratung.
Was sind die Grundannahmen der verhaltenstherapeutischen Beratung?
Die verhaltenstherapeutische Beratung basiert auf dem Behaviorismus und betont die Bedeutung empirischer Forschung. Der Fokus liegt auf beobachtbarem Verhalten, nicht auf inneren Prozessen. Wichtige Konzepte sind die Klassische und Operante Konditionierung.
Was sind die Grundannahmen der psychoanalytisch orientierten Beratung?
Die psychoanalytisch orientierte Beratung geht auf Sigmund Freud zurück. Zentrale Konzepte sind das Unbewusste, das Persönlichkeitsmodell mit Es, Ich und Über-Ich, die Bedeutung unbewusster Motive und Triebe (Eros und Thanatos), der Einfluss der Kindheit und der psychosexuellen Entwicklungsphasen (inklusive des Ödipuskomplexes) auf die Entstehung psychischer Probleme.
Wie unterscheiden sich die Menschenbilder in beiden Ansätzen?
Der Text hebt den fundamentalen Unterschied im Menschenbild hervor: Verhaltenstherapie fokussiert auf beobachtbare Verhaltensweisen, während die Psychoanalyse das Unbewusste und innere Konflikte in den Mittelpunkt stellt.
Wie unterscheiden sich die Sichtweisen auf Veränderung und Lernen?
Verhaltenstherapeutische Ansätze betonen die Veränderung von Verhalten durch Konditionierung und Lernen am Erfolg. Psychoanalytische Ansätze legen den Fokus auf die Bearbeitung unbewusster Konflikte und die damit verbundene Persönlichkeitsentwicklung.
Wie unterscheiden sich die Erklärungen für die Entstehung psychischer Probleme?
Verhaltenstherapeutische Ansätze erklären psychische Probleme durch erlernte Verhaltensmuster. Psychoanalytische Ansätze sehen die Ursache in unbewussten Konflikten, die oft auf frühkindliche Erfahrungen zurückgehen.
Wie unterscheiden sich die praktischen Umsetzungen in der Beratung?
Der Text deutet Unterschiede in der praktischen Umsetzung an, ohne diese detailliert zu beschreiben. Es wird jedoch deutlich, dass die Methoden und Interventionen in beiden Ansätzen stark voneinander abweichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis des Textes?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Verhaltensberatung, Psychoanalyse, Behaviorismus, Menschenbild, Veränderung, Lernen, Problemgenese, empirische Forschung, Konditionierung, Unbewusstes, Es, Ich, Über-Ich, psychosexuelle Entwicklung, Ödipuskomplex, Libido.
- Quote paper
- Mendina Morgenthal (Author), 2010, Verhaltensberatung und psychoanalytisch-orientierte Beratung im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167033