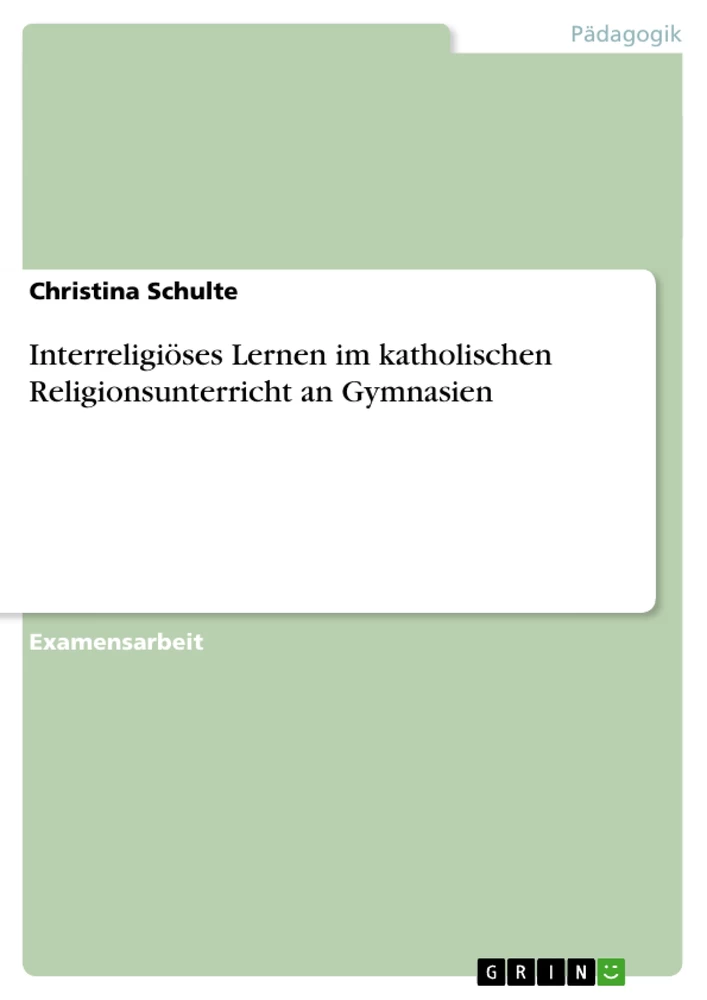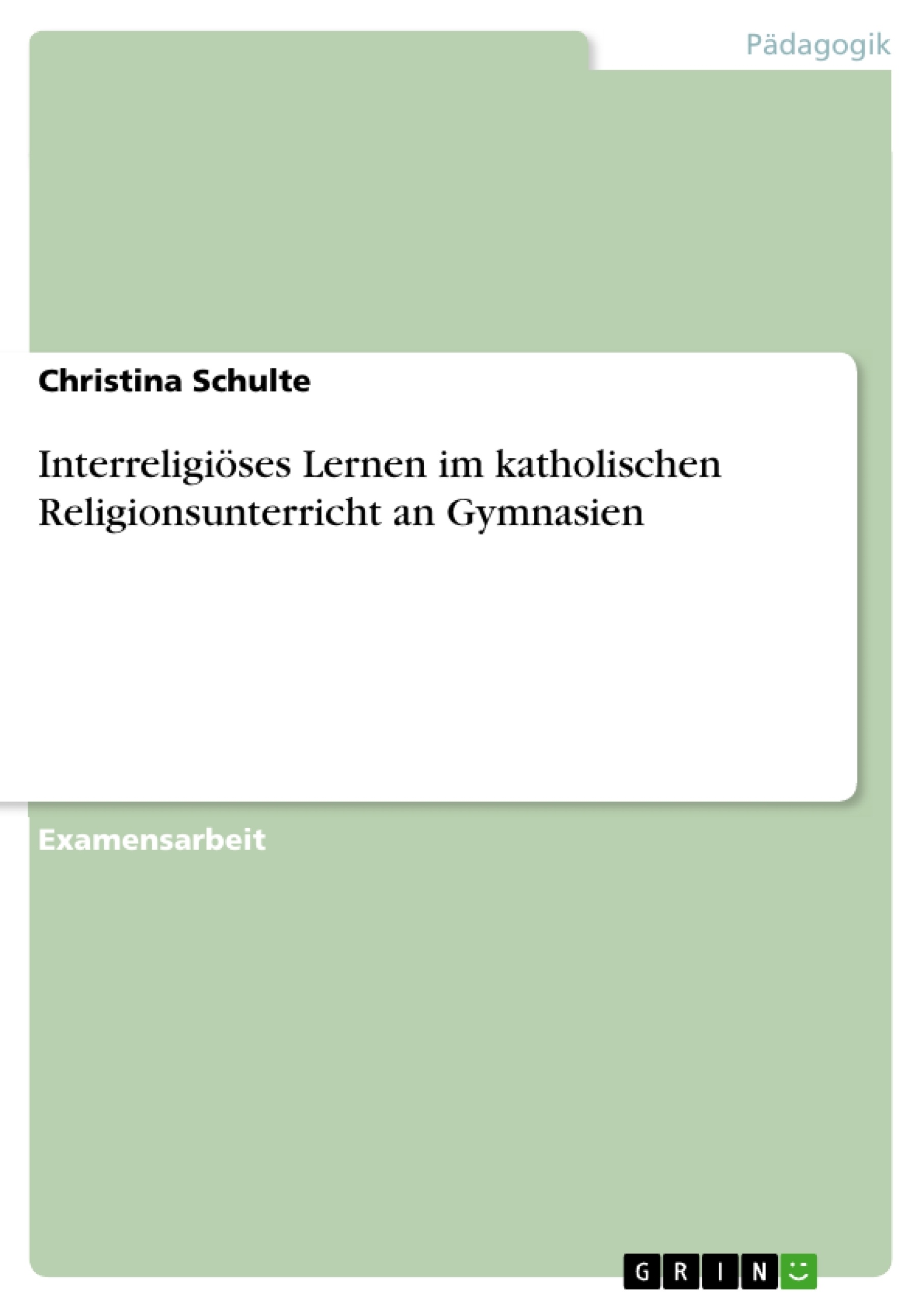Seit ein paar Jahren sticht ein schillernder Begriff in der Religionspädagogik immer stärker hervor: interreligiöses Lernen. Was ist jedoch genau damit gemeint? Wie kann man sich einen solchen Lernprozess vorstellen?
In der letzten Zeit haben sich bereits vorhandene Fragen zugespitzt und zugleich wurden neue Fragen aufgeworfen. Vor allem durch die Globalisierung, die Migration und die Pluralisierung der Gesellschaft, aber auch vor dem Hin-tergrund scheinbar durch Religion legitimierter Konflikte und terroristischer Absichten gewannen der interreligiöse Dialog und damit verbunden auch das interreligiöse Lernen zunehmend an Bedeutung.
Ist der katholische Religionsunterricht für ein derartiges Lernen ein geeigneter Ort? Ist das interreligiöse Lernen überhaupt notwendig? Wie kann es im Unterricht angeleitet werden und welche Chancen und Grenzen wirft es auf? – Dies gilt es im Verlauf dieser Arbeit zu klären, deren Aufgabe es sein soll, das inter-religiöse Lernen in Bezug auf die Unterrichtspraxis im katholischen Religions-unterricht an Gymnasien zu untersuchen und seinen Nutzen und seine Chancen zu reflektieren.
Zuerst wird eine Einführung in die interkulturelle Pädagogik, die aufgrund des gesellschaftlichen Wandels entstanden ist bzw. entstehen musste, gegeben, um von dieser Position heraus das interreligiöse Lernen in eine definitorische Eingrenzung zu fassen. Warum diese Vorgehensweise, also von der interkulturellen Pädagogik her, sinnvoll erscheint, wird im Verlauf dieser Arbeit deutlich. Dieses soll zuerst von der theoretischen Seite her geschehen, indem grundlegende Faktoren dargestellt und erläutert werden, um die Grundlagen eines solchen Lernens erfassen zu können. Danach wird die theologische Basis in die Betrachtung einbezogen, um die Position der katholischen Kirche bezüglich des interreligiösen Lernens klären zu können. Kann man einen Wandel im Selbstverständnis erkennen? In welchem Verhältnis steht die katholische Kirche zu den anderen Religionen und wie sieht sie sich selbst? Welche Grundlagen sind für sie in Bezug auf den katholischen Religionsunterricht unabdingbar? Unterscheidet sich ihre Ansicht im Vergleich zu der evangelischen Kirche? Dies alles wird in diesem Bereich zu klären sein...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaftliche Entwicklungen als Herausforderung für die Pädagogik
- Gastarbeiter in Deutschland - vom Anwerbeabkommen zum Anwerbestopp
- Aussiedler
- Flüchtlinge
- Die Lage im Bildungswesen
- Aktuelle Forschungsergebnisse
- Konsequenzen für das deutsche Schulsystem
- Interkulturelle Pädagogik - Von der Duldung zum Dialog
- Interkulturelles Lernen - Definition
- KMK Empfehlung „Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule“ (1996)
- Interreligiöses Lernen – Bereicherung durch Begegnung?
- Annäherung an das interreligiöse Lernen und seine Voraussetzungen
- Ziele und Kompetenzen interreligiösen Lernens
- Fünf Schritte interreligiösen Lernens
- Ebenen des interreligiösen Lernens
- Schule als geeigneter Ort für interreligiöses Lernen?
- Theologische Grundlagen zum Religionsunterricht und zum interreligiösen Lernen
- Die Würzburger Synode von 1974
- Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen
- Modelle für einen Dialog der verschiedenen Religionen
- Exklusivismus
- Inklusivismus
- Pluralismus
- Lehramtliche Aussagen zum interreligiösen Dialog
- Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils
- Lumen Gentium
- Nostra Aetate
- Die Päpstlichen Lehrschreiben
- Redemptoris Missio
- Exkurs: Worten folgen Taten: Johannes Paul II. und Benedikt XVI.
- Stellungnahmen der evangelischen Kirche zum interreligiösen Dialog
- Ökumenischer Rat der Kirche
- Die EKD (Evangelische Kirche Deutschlands)
- Interreligiöses Lernen im katholischen Religionsunterricht an Gymnasien
- Deutsche Bischofskonferenz und KMK Empfehlung
- RRL für die Schuljahrgänge 7-10 im katholischen Religionsunterricht an Gymnasien in Niedersachsen (2003)
- Exemplarischer Schulbuchvergleich zum interreligiösen Lernen
- Reli – Unterrichtswerk für Jahrgangsstufe 5 und 6
- Reli - Unterrichtswerk für die Jahrgangsstufe 7 und 8
- Religion vernetzt - Klasse 7
- Das Kursbuch Religion für das 7./8. Schuljahr
- Suchen und Glauben für das 5./6. Schuljahr
- Fazit
- Unterrichtseinheit zum interreligiösen Lernen in Bezug auf Christentum und Islam
- Unterrichtsequenz Christen - Muslime
- Ziele der Unterrichtseinheit
- Spezifische Lernwege für das interreligiöse Lernen in Bezug auf diese Unterrichtseinheit - eine Ideenbörse
- Eine synoptische Darstellung – Einordnung in die Unterrichtssequenz
- Entwicklungspsychologische Aspekte
- Vergleich: „Die Josefsgeschichte“ in Bibel und Koran
- Sachanalyse
- ,,Josef - Bibel und Koran als Thema in einer Unterrichtsstunde - Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
- Geplanter Unterrichtsverlauf
- Chancen und Grenzen interreligiösen Lernens im schulischen Religionsunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem interreligiösen Lernen im katholischen Religionsunterricht an Gymnasien. Sie untersucht den Nutzen und die Chancen dieses Lernprozesses vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklungen, der Pluralisierung und der Herausforderungen des interreligiösen Dialogs. Dabei wird die theologische Position der katholischen Kirche zum interreligiösen Lernen beleuchtet und ein Vergleich mit der evangelischen Kirche vorgenommen. Im Fokus stehen zudem die Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Lernens in der Unterrichtspraxis.
- Gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Pädagogik
- Theologische Grundlagen zum interreligiösen Lernen in der katholischen Kirche
- Interreligiöses Lernen in der Unterrichtspraxis
- Exemplarischer Schulbuchvergleich
- Chancen und Grenzen des interreligiösen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema interreligiöses Lernen ein und stellt den gesellschaftlichen Kontext dar. In den folgenden Kapiteln werden die Entwicklungen im Bildungswesen und die Bedeutung der interkulturellen Pädagogik für das interreligiöse Lernen erläutert. Es wird ein Überblick über die Ziele und Kompetenzen des interreligiösen Lernens gegeben sowie die theologischen Grundlagen der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche zum interreligiösen Dialog beleuchtet. Die Analyse von Lehrplänen und Schulbüchern im Bereich des katholischen Religionsunterrichts zeigt, wie das interreligiöse Lernen in der Unterrichtspraxis gelebt werden kann. Ein Beispiel für eine Unterrichtseinheit zum interreligiösen Lernen zwischen Christentum und Islam wird präsentiert. Schließlich werden Chancen und Grenzen des interreligiösen Lernens im schulischen Religionsunterricht diskutiert.
Schlüsselwörter
Interreligiöses Lernen, katholischer Religionsunterricht, interkulturelle Pädagogik, Gesellschaftliche Entwicklungen, Pluralisierung, theologische Grundlagen, Schulbuchvergleich, Unterrichtseinheit, Christentum, Islam, Chancen, Grenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter interreligiösem Lernen?
Interreligiöses Lernen bezeichnet Bildungsprozesse, in denen Schüler Kompetenzen im Umgang mit religiöser Pluralität erwerben und den Dialog zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen üben.
Welche Rolle spielt der katholische Religionsunterricht an Gymnasien dabei?
Die Arbeit untersucht, ob der katholische Unterricht ein geeigneter Ort für diesen Dialog ist und wie er den Nutzen und die Chancen dieser Begegnungen reflektiert.
Welche theologischen Grundlagen werden herangezogen?
Es werden Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils (wie Nostra Aetate) sowie Erklärungen der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD analysiert.
Wie wird das Thema Christentum und Islam im Unterricht behandelt?
Die Arbeit präsentiert eine beispielhafte Unterrichtseinheit, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede am Beispiel der Josefsgeschichte in Bibel und Koran aufzeigt.
Was sind die Grenzen des interreligiösen Lernens in der Schule?
Die Untersuchung diskutiert neben den Chancen auch Herausforderungen wie die Gefahr der Synkretismusbildung oder institutionelle Beschränkungen.
- Quote paper
- Christina Schulte (Author), 2010, Interreligiöses Lernen im katholischen Religionsunterricht an Gymnasien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167097