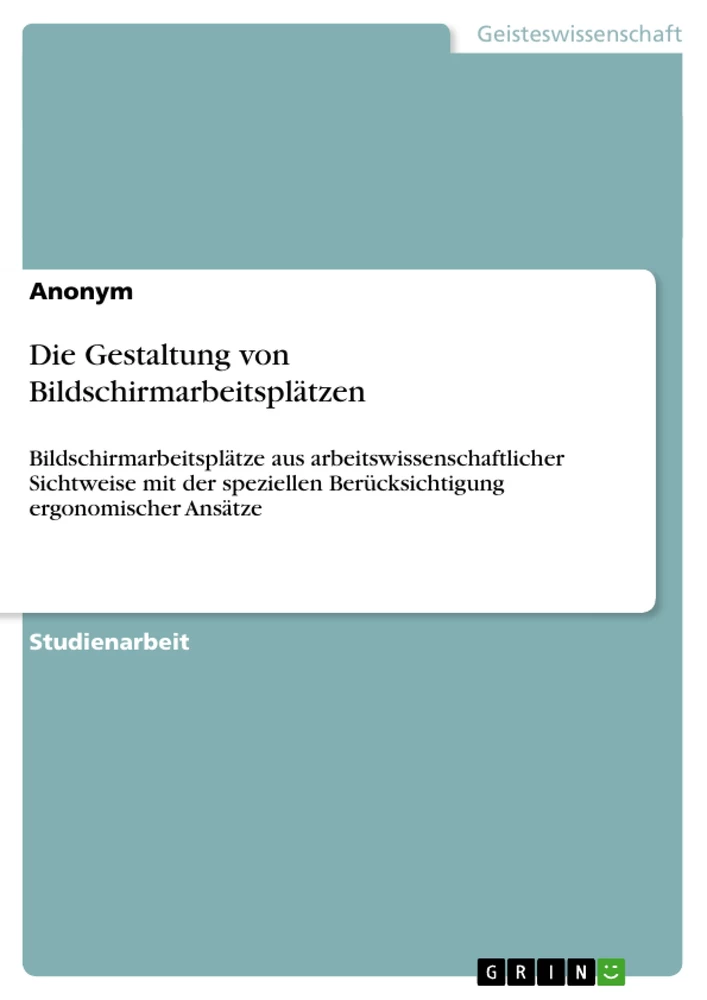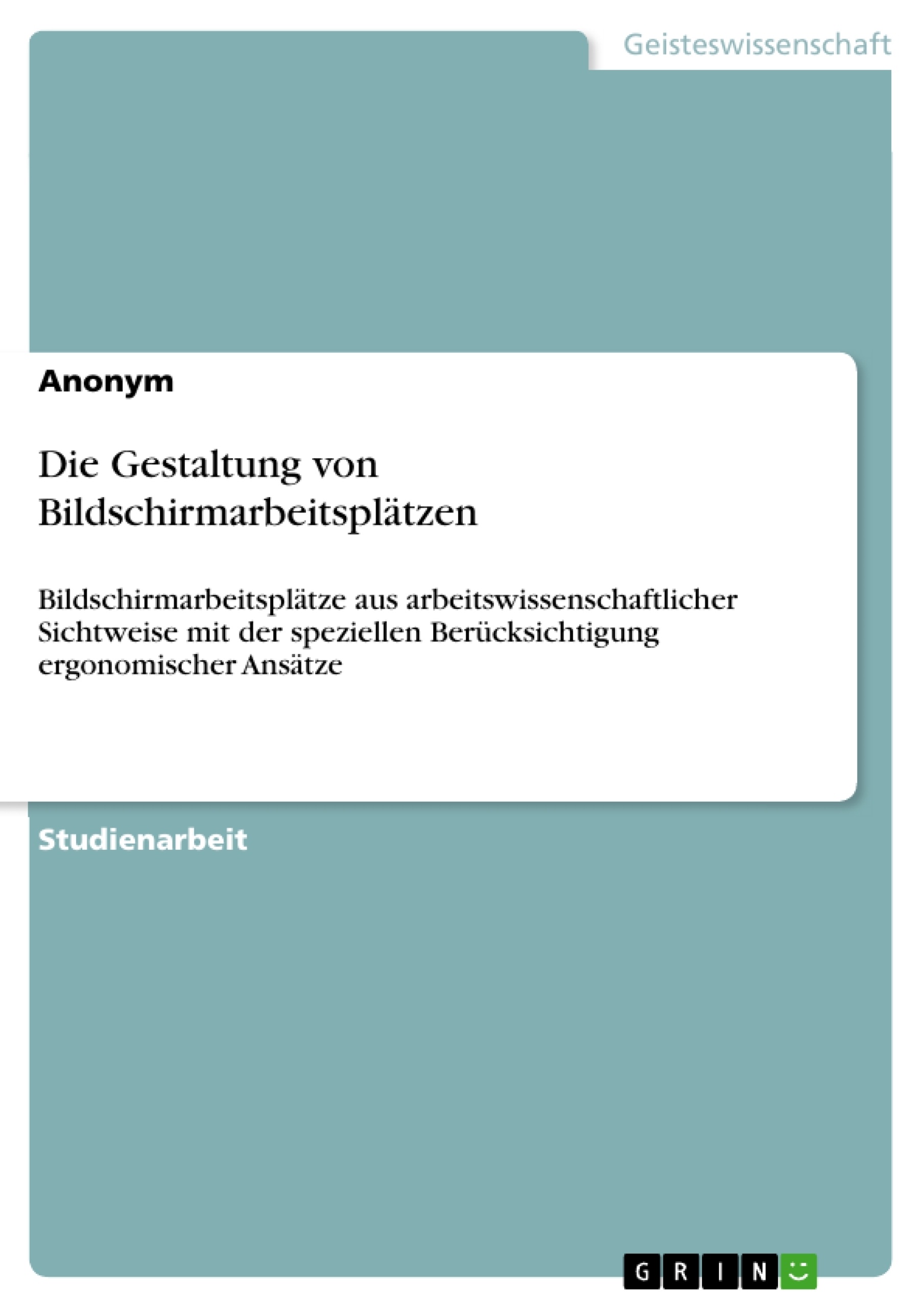1. Einleitung
Den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der menschlichen Gesundheit, Krank-heit und seiner Arbeit erkannte die Wissenschaft spätestens mit Beginn der Industria-lisierung. Daraus entwickelte sich im Verlauf der Zeit ein eigenständiger Wirtschafts-zweig, der sich mit der Problematik zwischen dem Mensch und dessen Arbeit be-schäftigt. Inbegriff dieser Wissenschaften ist eine Vielzahl von wissenschaftlich orien-tierten Disziplinen, wie beispielsweise die Ergonomie, die Arbeitsmedizin, der Tech-nische Arbeitsschutz, die Arbeitsphysiologie und –psychologie sowie die eigentliche Arbeitswissenschaft selbst.
Die Umsetzung der gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sogenannte Arbeitsgestaltung, gilt als das zentrale Ziel der Arbeitswissenschaft, d.h. die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsmitteln, -plätzen und -umgebungen sowie der Arbeitsorganisation zu erreichen.
Die interdisziplinären und komplexen Zusammensetzungen der Arbeitswissenschaf-ten stellen in der Praxis voneinander abgrenzbare Disziplinen der arbeitswissen-schaftlich orientierten Fächergruppe dar. Der bestehende Unterschied begründet sich durch diverse Blickwinkel, von welchem aus der gemeinsame und zentrale Zusammenhang behandelt wird. Dieser Blickwinkel kann aus medizinischer, techni-scher, wirtschaftswissenschaftlicher oder psychologischer Perspektive erfolgen, wobei die Ansätze erhalten bleiben. Dies wird besonders im Hinblick auf das nicht vor-handene gemeinsame bzw. einheitliche Lehrkonzept der arbeitswissenschaftlich orientierten Disziplinen deutlich.
Diejenigen Arbeitswissenschaftler, die eine medizinische oder physiologische Ausbil-dung durchlaufen haben, gehen in der Regel den Fragen der „angewandten Physiologie“, die im Zusammenhang von Mensch und Arbeit bedeutsam sind, nach.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ERGONOMIE
- 2.1 DIE ARBEITSPLATZGESTALTUNG
- 2.1.1 DER BÜRO- UND BILDSCHIRMARBEITSPLATZ
- 2.1.1.1 DER SITZARBEITSPLATZ
- 2.1.1.2 DER BÜRODREHSTUHL
- 2.1.1.3 DER BILDSCHIRMARBEITSPLATZ
- 2.2 RECHTSLAGEN ZU BILDSCHIRMARBEITSPLÄTZEN
- 3. SCHLUSS
- 3.1 ERGEBNIS
- 3.2 KRITIK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive, wobei ein besonderer Fokus auf ergonomische Ansätze gelegt wird. Ziel ist es, die Bedeutung ergonomischer Prinzipien für die Gestaltung von Arbeitsplätzen aufzuzeigen und deren Einfluss auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern zu beleuchten.
- Ergonomische Prinzipien bei der Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen
- Gesundheitsrisiken durch sitzende Arbeit und Bildschirmarbeit
- Rechtliche Vorgaben und Standards für die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen
- Optimierung von Arbeitsabläufen und Arbeitsumgebungen
- Zusammenhang zwischen ergonomischer Gestaltung und der menschlichen Leistung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung der Arbeitswissenschaft und die Bedeutung der Arbeitsgestaltung. Kapitel 2 widmet sich dem Bereich der Ergonomie und betont die Bedeutung ergonomischer Arbeitsgestaltung für die Harmonisierung von Humanität und Wirtschaftlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Belastungs-Beanspruchungskonzept geschenkt, welches die Gestaltung von Arbeitsplätzen unter Berücksichtigung der Belastungsart, -höhe, -dauer und der individuellen Eigenschaften der Arbeitnehmer fokussiert.
Im Abschnitt 2.1 wird die Bedeutung der individuellen Arbeitsplatzgestaltung hervorgehoben, wobei der Schwerpunkt auf der Vermeidung ermüdungsbedingter Leistungsdifferenzen und gesundheitlicher Beeinträchtigungen liegt. Kapitel 2.1.1 beschäftigt sich mit dem Büro- und Bildschirmarbeitsplatz und beleuchtet die Gesundheitsrisiken, die mit der vornehmlich sitzenden Körperhaltung verbunden sind.
Schlüsselwörter
Ergonomie, Arbeitsgestaltung, Bildschirmarbeitsplatz, Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Belastungs-Beanspruchungskonzept, statische Arbeit, dynamische Arbeit, Sitzhaltung, Rechtslagen, Arbeitsschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz?
Ziel ist die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsmitteln und -umgebungen, um die Gesundheit zu schützen und die Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Welche Gesundheitsrisiken birgt ständiges Sitzen?
Sitzende Arbeit führt oft zu statischer Belastung, was Rückenprobleme, Verspannungen und ermüdungsbedingte Leistungsabfälle zur Folge haben kann.
Was macht einen ergonomischen Bürodrehstuhl aus?
Ein guter Stuhl muss individuell verstellbar sein (Höhe, Lehne), dynamisches Sitzen unterstützen und eine stabile Abstützung der Wirbelsäule bieten.
Was besagt das Belastungs-Beanspruchungskonzept?
Es unterscheidet zwischen der objektiven Belastung (z.B. 8h Bildschirmarbeit) und der individuellen Beanspruchung, die je nach Konstitution des Arbeitnehmers variiert.
Gibt es rechtliche Vorgaben für Bildschirmarbeitsplätze?
Ja, in Deutschland regelt insbesondere die Arbeitsstättenverordnung (früher Bildschirmarbeitsverordnung) die Mindestanforderungen an Ergonomie und Sicherheit.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2010, Die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167160