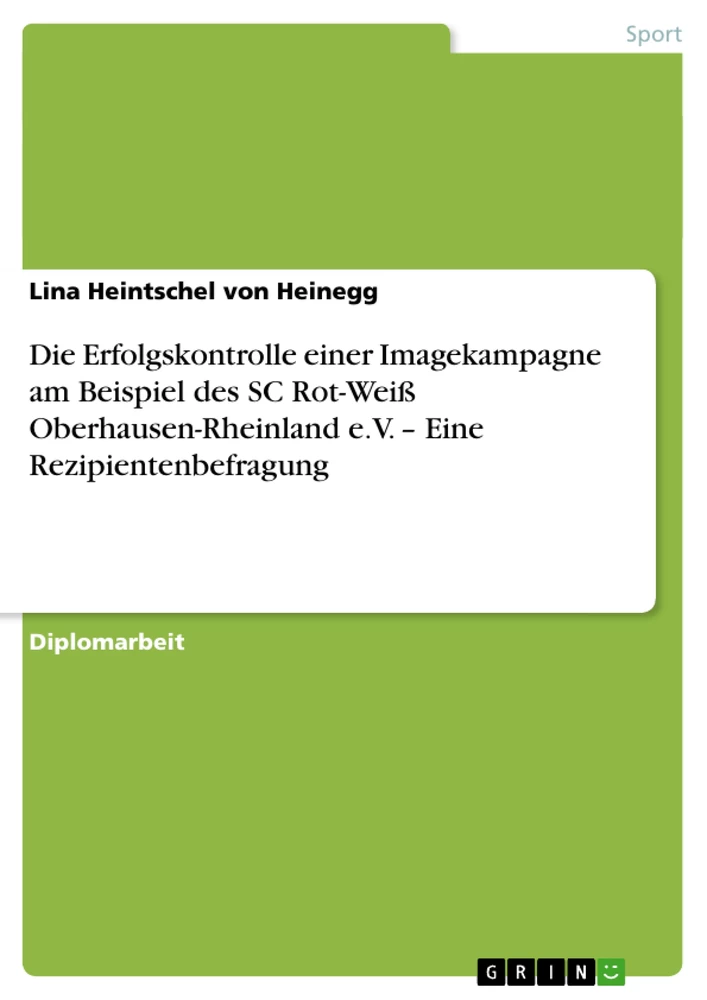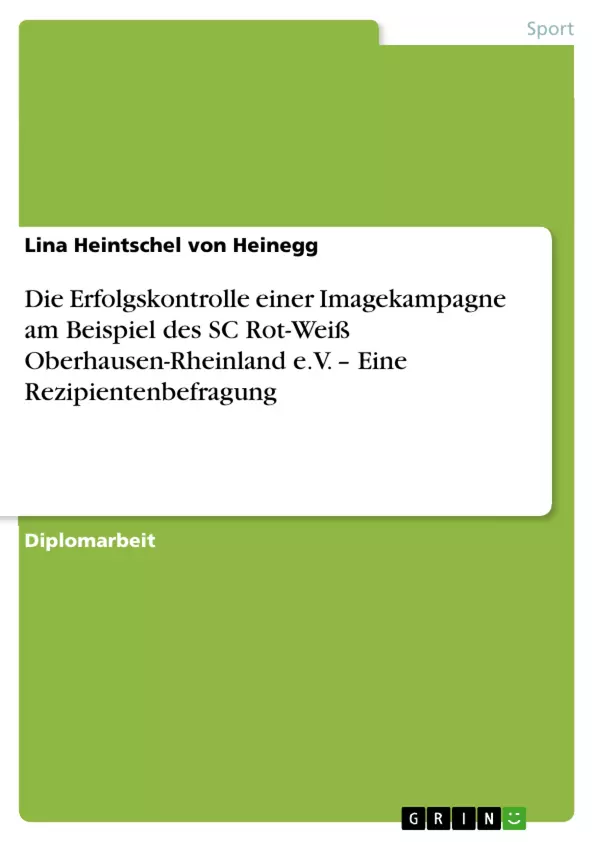In der heutigen Gesellschaft spielen neben Leistungen und Sachinformationen auch in hohem Maße emotionale Faktoren eine Rolle, um in der Fülle der Angebote und unter dem Druck der Medien wahrgenommen und akzeptiert zu werden. Besonders im Sport haben sich neben den reinen Sportleistungen längst Unterhaltungs- und Erlebniswerte etabliert, um Zuneigung und Zuspruch der avisierten Zielgruppen zu gewinnen und zu erhalten. Dies gelingt vor allem immer dann, wenn die Ausstrahlung eines Teams starke emotionale Komponenten enthält, die zu einem Teil des Markenbildes geworden sind. Insbesondere durch eine gezielte Markenführung bzw. verschiedene Formen der Vermarktung, durch adäquate Infrastrukturen und besondere Imagekampagnen können derartige Sympathie- und Bindungsvorteile generiert werden. Diese schlagen sich wiederum kurz- oder mittelfristig in Einnahmen nieder.
In den letzten Jahren entwickelten sich die Fußballbundesligisten von ehemals ehrenamtlich geführten Vereinen zu (inter-) national agierenden Wirtschaftsclubs. Es sind eindeutige Tendenzen zunehmender wirtschaftlicher Größe der Clubs zu erkennen. Einige Bundesligisten haben bei den Umsätzen durchschnittliche mittelständische Unternehmen bereits übertroffen (Hermanns/Riedmüller, 2001).
Trotz der wirtschaftlichen Größenordnung, in die das Fußballgeschäft vorgestoßen ist, zeigt sich besonders auf dem Gebiet der Kundenorientierung erheblicher Nachholbedarf (Büch/ Frick, 1999). Um dies zu kompensieren, sind professionelle Strukturen, Methoden und Konzepte speziell für Fußballunternehmen nötig. Die Fußballclubs müssen sich dem Konflikt zwischen profiorientiertem und wirtschaftlichem Handeln zum Einen und dem Agieren gemäß einem klassischen Verein zum Anderen stellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung
- 1.3. Aufbau
- 2. Grundlagen der Kommunikationspolitik
- 2.1. Bedeutung und Aufgaben der Kommunikationspolitik
- 2.2. Funktionen der Kommunikationspolitik
- 2.3. Ziele der Kommunikationspolitik
- 2.4. Instrumente der Kommunikationspolitik
- 2.4.1. Mediawerbung
- 2.4.2. Verkaufsförderung
- 2.4.3. Public Relations
- 2.5. Corporate Identity
- 2.6. Erfolgskontrolle in der Kommunikationspolitik
- 2.6.1. Erfolgskontrolle auf Basis von Wirkungsmodellen
- 2.6.1.1. Modelle der Kommunikationswirkung
- 2.7. Messmethoden zur Analyse der Kommunikationswirkung
- 2.7.1. Methoden der Kontrolle kognitiver Erfolgsgrößen
- 2.7.2. Methoden der Kontrolle affektiver Erfolgsgrößen
- 2.7.3. Methoden der Kontrolle konativer Erfolgsgrößen
- 2.8. Zusammenfassung
- 3. Die Malocherkampagne des SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland e. V.
- 3.1. Der SC Rot-Weiß Oberhausen-Rhld. e.V.
- 3.2. Die Malocherkampagne aus kommunikationspolitischer Sicht
- 3.2.1. Malocherschicht die I. – 11 Kumpel müsst ihr sein“
- 3.2.2. Malocherschicht die II. - Wir haben alles außer Kohle“
- 3.2.3. Malocherschicht die III. – Echte Kumpel“
- 3.3. Zusammenfassung
- 4. Empirische Untersuchung
- 4.1. Zielsetzung
- 4.2. Hypothesen
- 4.3. Methodik
- 4.3.1. Durchführung
- 4.3.2. Fragebogengestaltung
- 4.3.3. Untersuchungsobjekte
- 4.3.4. Pretest
- 4.3.5. Aufbereitung der Daten
- 5. Präsentation der Ergebnisse
- 5.1. Demografie
- 5.2. Verhältnis zwischen Fan und Verein
- 5.2.1. Emotionale Bindung zum Verein
- 5.2.2. Bewertung des Vereins
- 5.2.3. Bewertung von Aspekten eines Vereins
- 5.3. Verhältnis zwischen Fan und Malocherkampagne
- 5.3.1. Bekanntheit der Malocherkampagne
- 5.3.2. Einstellung zu der Malocherkampagne
- 5.3.3. Verbindung zwischen Verein und Malocherkampagne
- 5.3.4. Merkmale der Malocherkampagne
- 5.3.5. Bewertung von Vereinsfaktoren und Maßnahmen der Malocherkampagne
- 5.3.6. Saison 2010/2011
- 5.4. Hypothesenüberprüfung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Erfolgskontrolle einer Imagekampagne am Beispiel des SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland e. V. Sie untersucht die Wirkung der „Malocherkampagne“ auf die Rezipienten, analysiert die emotionale Bindung der Fans zum Verein sowie die Einstellung zur Kampagne.
- Analyse der Kommunikationspolitik des Vereins und der „Malocherkampagne“
- Bewertung der Wirkung der Kampagne auf die Rezipienten
- Untersuchung des Verhältnisses zwischen Fan und Verein
- Entwicklung und Anwendung einer Methodik zur Erfolgskontrolle
- Präsentation der Ergebnisse und Hypothesenüberprüfung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit definiert. Anschließend werden die Grundlagen der Kommunikationspolitik erläutert, inklusive der Bedeutung, Funktionen, Ziele und Instrumente. Im dritten Kapitel wird die „Malocherkampagne“ des SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland e. V. aus kommunikationspolitischer Sicht analysiert.
Das vierte Kapitel behandelt die empirische Untersuchung, wobei die Zielsetzung, die Hypothesen und die Methodik der Untersuchung dargestellt werden. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert, die Daten zur Demografie, zum Verhältnis zwischen Fan und Verein sowie zur Wirkung der „Malocherkampagne“ enthalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kommunikationspolitik, Imagekampagne, Erfolgskontrolle, Rezipientenbefragung, Fußballverein, Fanbindung, emotionale Bindung, Markenkommunikation, Wirkungsforschung und empirische Methoden. Die Studie analysiert die „Malocherkampagne“ des SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland e. V. und untersucht die Auswirkungen der Kampagne auf die Rezipienten.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der „Malocherkampagne“ von RWO?
Das Ziel war die Stärkung des Vereinsimages durch emotionale Bindung und die Positionierung als bodenständiger „Malocher-Club“ im Ruhrgebiet.
Wie wurde der Erfolg der Imagekampagne gemessen?
Durch eine empirische Rezipientenbefragung, die kognitive, affektive und konative Erfolgsgrößen bei den Fans analysierte.
Welche Rolle spielt die emotionale Bindung im Sportmarketing?
Emotionale Faktoren sind entscheidend, um in der Medienflut wahrgenommen zu werden und loyale Fans zu gewinnen, was langfristig die Einnahmen sichert.
Was sind die drei Phasen der Malocherkampagne?
Die Kampagne gliederte sich in: „11 Kumpel müsst ihr sein“, „Wir haben alles außer Kohle“ und „Echte Kumpel“.
Welche Instrumente der Kommunikationspolitik werden im Text erläutert?
Behandelt werden Mediawerbung, Verkaufsförderung, Public Relations sowie die Bedeutung der Corporate Identity.
Gibt es Nachholbedarf bei Fußballvereinen hinsichtlich Kundenorientierung?
Ja, die Arbeit stellt fest, dass viele Clubs trotz wirtschaftlicher Professionalisierung im Bereich der gezielten Kundenbindung noch Defizite aufweisen.
- Citar trabajo
- Lina Heintschel von Heinegg (Autor), 2010, Die Erfolgskontrolle einer Imagekampagne am Beispiel des SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland e.V. – Eine Rezipientenbefragung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167171