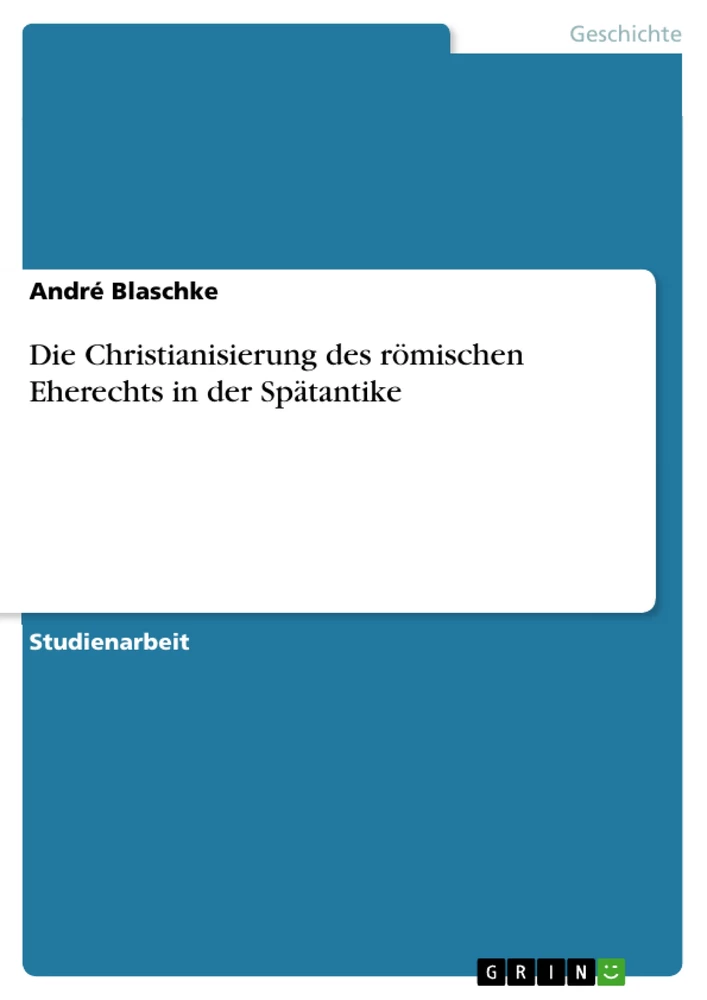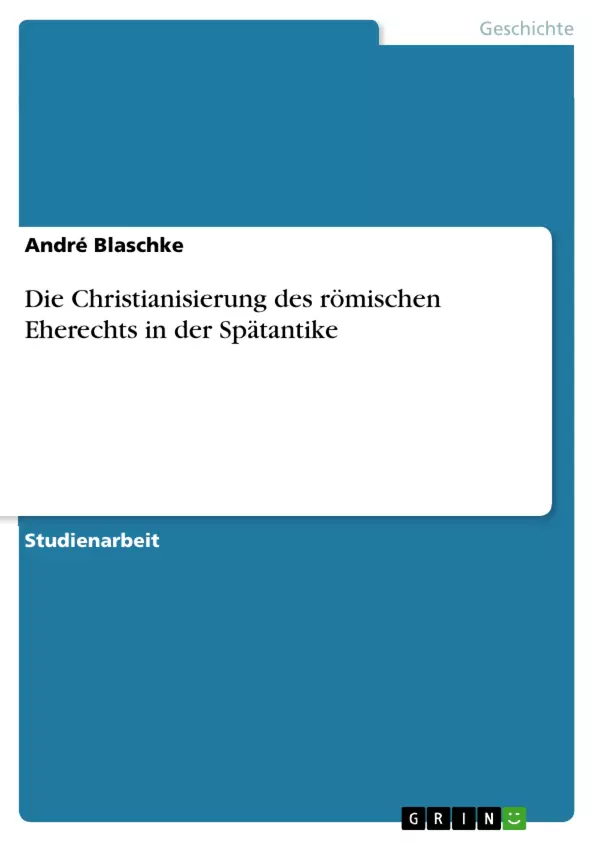Als eine der bedeutendsten christlichen Sozialisationsformen im westl. Römischen Reich zählten die Ehegemeinschaften. Wegen ihrer großen Relevanz für das alltägliche Leben und den daraus zu entnehmenden Schlussfolgerungen für die Sozialgeschichte der Ehe und der Familie sind in den letzten Jahren vermehrt Studien und Forschungen hierzu entstanden.
Daher möchte ich auf den kommenden Seiten auf die Ehe an sich mit seiner rechtlichen Bedeutung für die römische Bevölkerung, sowohl in der klassischen, weltlichen Sphäre, als auch in der vom Christentum geprägten spätantiken Lebenswelt des westlichen Römischen Reiches eingehen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aspekt der Christianisierung und welchen Einfluss der katholische Glaube und die zunehmende Macht der Bischöfe seit dem Edikt „cunctos populus“ vom 28.02.380 n.Chr. durch Kaiser Theodosius I. oder evtl. schon vorher auf das römische Eheschließungsrecht genommen haben.
Letztendlich möchte ich am Beispiel der Eheschließung verdeutlichen, dass die römische Kirche mit Zunahme von geistlicher Macht ab dem vierten Jahrhundert auch eine größere politische Machtposition erlangte.
Die Auswahl und die Verwendung der Quellen waren auf Grund vieler Umstände sehr schwierig. Um dem Leser kein vorgefertigtes Zeugnis der Geschichte zu präsentieren, lag es mir am Herzen möglichst viele Quellen gegenüber zu stellen. Vorwiegend habe ich dabei säkulare Quellen verwendet, da in christlichen Überlieferungen reale Welten meist nur sehr schwer von kirchlicher Propaganda zu unterscheiden sind. Sollte es dem Leser an primären Quellen zu römischen Eheschließungen mangeln, so steht dahinter keine grundsätzliche Absicht, sondern bloß der Mangel an richtigen und verwendbaren Übersetzungen. Auch eine bereits in der Antike und im Mittelalter eingesetzte Selektion hatte daran einen großen Einfluss. Texte, deren Inhalte und Bedeutungen nicht geachtet und geschätzt wurden und somit auch nicht abgeschrieben wurden, fielen mit der begrenzten Haltbarkeit von Papyrus dem Zahn der Zeit zum Opfer. Zudem gab es bedeutsame Umstellungen, wie zum Beispiel die der Handschrift von Majuskel auf Minuskel oder auch die Erfindung des Buchdrucks, welche zur Folge hatten, dass eine weitere Zäsur einsetzte.
Die meisten Angaben in meiner Ausarbeitung beziehen sich auf römische Rechtstexte. Erwähnenswert sind dabei die beiden ersten Abschnitte der Zusammenfassung zum „Römischen Privatrecht“ von Max Kaser und die Rechtsquellen von Iustinian und Theodosius.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das klassische, römische Eherecht – Ein Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürger
- Rechtliche Grundsätze für das Zustandekommen einer Ehe: conubium
- Vom Verlöbnis zur Eheschließung
- „Anpassung oder Umbruch“ - die Veränderungen im spätantiken Eherecht
- Spätantike Voraussetzungen für eine rechtsgültige Ehe
- Eheschließungen der römischen Bevölkerung ab dem vierten Jahrhundert
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Christianisierung des römischen Eherechts in der Spätantike. Sie untersucht den Einfluss des christlichen Glaubens und der zunehmenden Macht der Bischöfe auf das römische Eheschließungsrecht ab dem 4. Jahrhundert.
- Das klassische, römische Eherecht vor dem Hintergrund der heidnischen Staatsordnung
- Die Veränderungen des römischen Eherechts in der Spätantike
- Der Einfluss des christlichen Glaubens und der Macht der Bischöfe auf das Eherecht
- Die Rolle der römischen Kirche als politische Macht im 4. Jahrhundert
- Die Bedeutung der Eheschließung als Sozialisationsform im römischen Reich
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das klassische, römische Eherecht aus der Sicht des heidnischen Staates bis ins 3. Jahrhundert. Es werden die rechtlichen Grundsätze für das Zustandekommen einer Ehe, die Rolle des Verlöbnisses und die Bedeutung der Familie im römischen Recht dargestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Veränderungen im spätantiken Eherecht ab dem 4. Jahrhundert. Es werden die juristischen Voraussetzungen für eine Ehe und die Inhalte einer weltlichen, römischen Ehe mit dem Verlöbnis und der Hochzeit untersucht.
Schlüsselwörter
Römisches Recht, Eherecht, Christianisierung, Spätantike, Ehe, Familie, Verlöbnis, Hochzeit, Bischöfe, Kirche, politische Macht, Sozialisationsform.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte das Christentum auf das römische Eherecht?
Ab dem 4. Jahrhundert führte der katholische Glaube und die zunehmende Macht der Bischöfe zu einer Christianisierung der rechtlichen Grundlagen der Eheschließung.
Was war das Edikt „Cunctos Populus“?
Das im Jahr 380 n.Chr. von Kaiser Theodosius I. erlassene Edikt erklärte das Christentum zur Staatsreligion und stärkte die politische Machtposition der Kirche massiv.
Wie unterschied sich das klassische römische Eherecht von der spätantiken Form?
Das klassische Recht sah die Ehe primär als Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürger (conubium), während in der Spätantike kirchliche Normen und bischöflicher Einfluss an Bedeutung gewannen.
Warum sind Primärquellen zu römischen Eheschließungen oft schwer zu finden?
Viele Texte gingen durch die begrenzte Haltbarkeit von Papyrus verloren oder wurden im Mittelalter aufgrund mangelnder Wertschätzung nicht abgeschrieben.
Welche Rolle spielten Bischöfe im 4. Jahrhundert in Bezug auf die Ehe?
Bischöfe erlangten neben ihrer geistlichen Funktion zunehmend politische Macht und nahmen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung und die soziale Ordnung der Ehegemeinschaften.
- Citar trabajo
- André Blaschke (Autor), 2010, Die Christianisierung des römischen Eherechts in der Spätantike, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167228