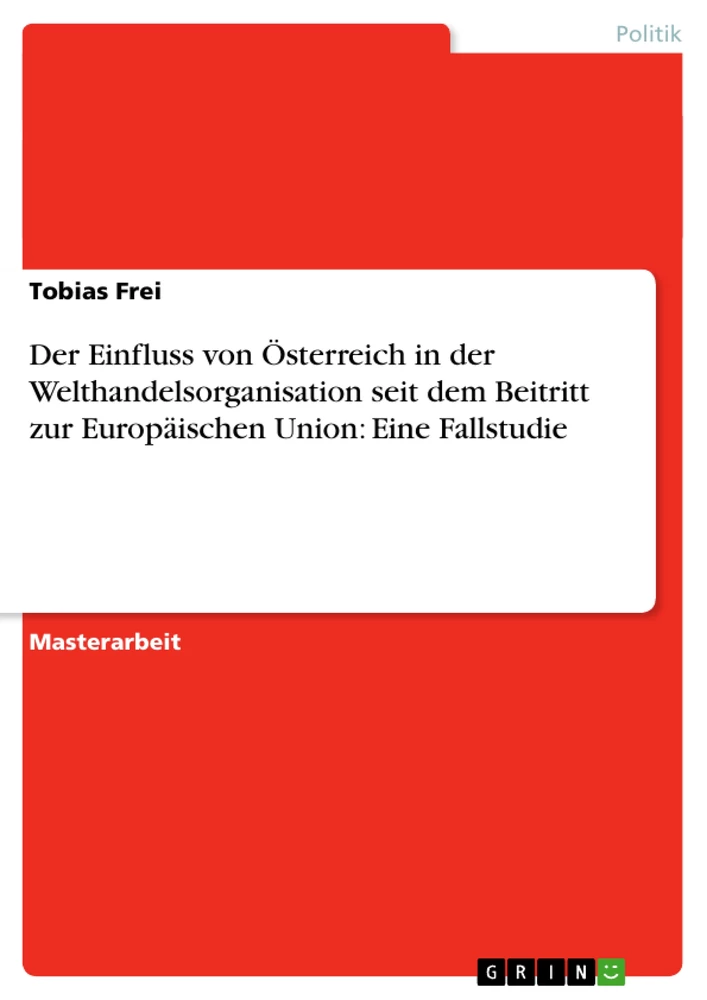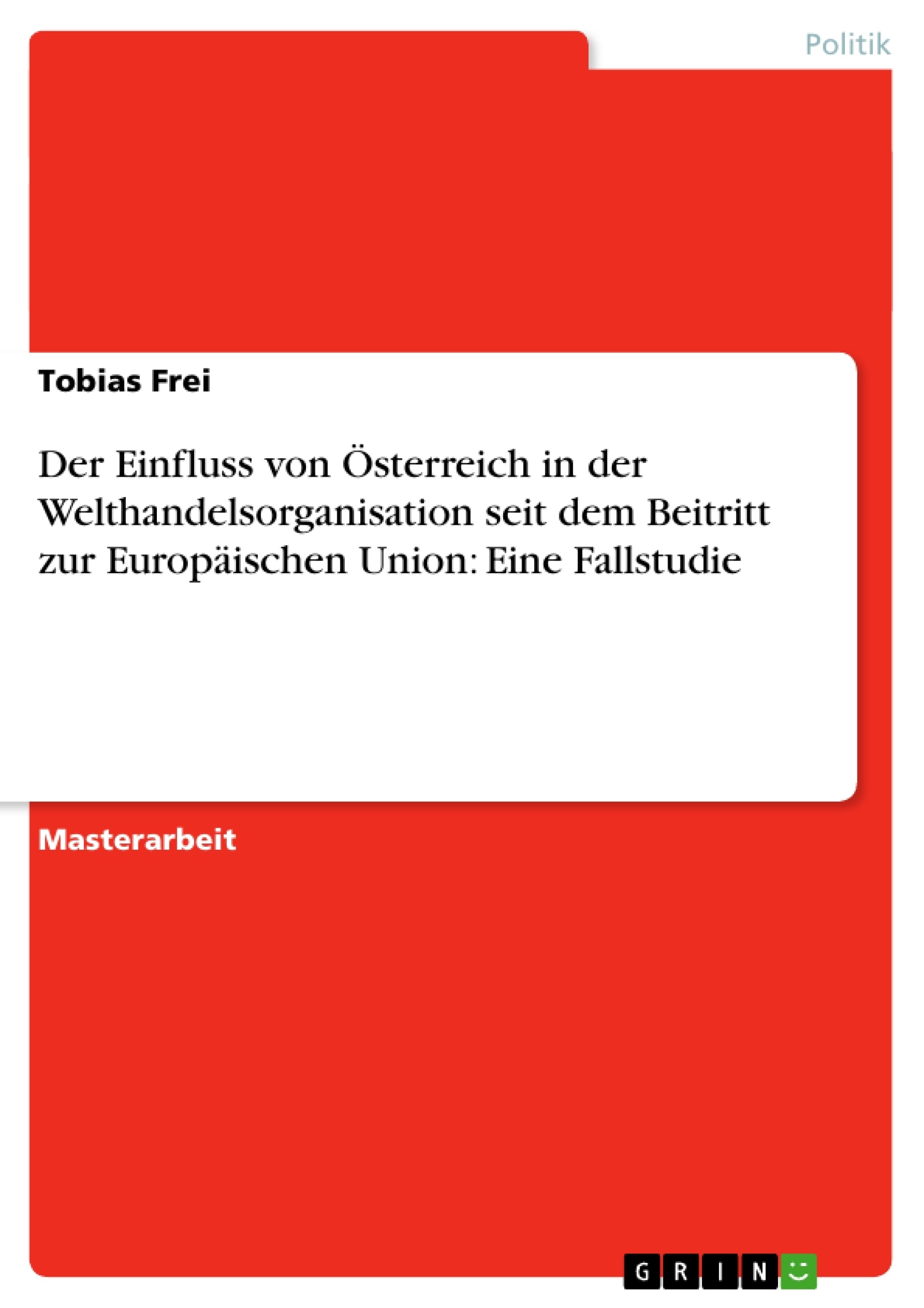Der Einfluss von Österreich in der WTO hat sich 1995 mit dem Beitritt zur EU grund-legend verändert. Österreich transferierte seine direkten Einflussmöglichkeiten in Bezug auf die Gestaltung der eigenen internationalen Handelspolitik nach Brüssel. Diese Einflussveränderung wird empirisch und mittels qualitativer Methoden aus der Neuen Politischen Ökonomie analysiert. Für die entsprechende Analyse wird der Term „Einfluss“ in eine direkte sowie in eine indirekte Komponente unterteilt.
Im GATT überwogen für Österreich die direkten Einflusskomponenten. Ein Beispiel dazu ist die Agenda-Bestimmungsmacht. Mit einem Vorstoss konnte Österreich ein-mal die Terminologie des Vertragswerks in seinem Interesse anpassen. Unter dem Strich kam Österreich aber nicht über das Dasein eines Nischenspielers hinaus. Die fehlende Vernetzung sowie das Informationsdefizit sind nur zwei Gründe dafür.
Als Österreich der EU beitrat, verbesserten sich die indirekten Einflusskomponenten, während die direkten an Gewicht verloren. Die relevanten, indirekten Komponenten sind die signifikant gesteigerte, indirekte Marktgrösse aufgrund der Zollunion sowie die neue kollektive Verhandlungsführung. Die Heterogenität der EU führt erstens dazu, dass Österreich rascher und einfacher, formell wie auch informell, Koalitionen bilden kann. Dies zeigt der „Chlorhühnerfall“ trefflich. Zweitens, bei Themen, welche speziell in Österreich von hoher Bedeutung sind, jedoch auch von generellem europäischem Interesse, kann es seine Position effizienter durchsetzen. Drittens offeriert die EU ihren Mitgliedern verschiedene Instrumente, um als Koalitionspartner in der WTO an Einfluss zu gewinnen. Diese Instrumente sind inter alia die Koordinationsmechanismen innerhalb der europäischen Wirtschaftsdachverbände oder die Inte-ressensdurchsetzungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Marktzugangsstra-tegie. Hinzu kommt, dass Österreich weniger anfällig ist, handelspolitisch von ande-ren EU oder WTO Staaten unter Druck gesetzt zu werden. Im Falle eines Handels-konflikts hat es nun Zugang zu den Ressourcen der EU (dafür designierte Komitees, Informationen, Retorsionsmöglichkeiten) und kann ihn dadurch rascher mitigieren.
Mit dem Impetus der EU und den damit verbunden verbesserten, indirekten Kompo-nenten, kann Österreich seine Interessenswahrnehmung in der internationalen Handelspolitik steigern. Insgesamt gewinnt es in der WTO an Einfluss.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fallstudie untersucht den Einfluss Österreichs in der Welthandelsorganisation (WTO) seit dem Beitritt zur Europäischen Union (EU) im Jahr 1995. Die Studie analysiert die Veränderungen im Einfluss Österreichs durch den Transfer seiner direkten Einflussmöglichkeiten in Bezug auf die Gestaltung der internationalen Handelspolitik nach Brüssel. Die Untersuchung erfolgt aus der Perspektive der Neuen Politischen Ökonomie und nutzt empirische und qualitative Methoden.
- Die Analyse des Einflusses Österreichs in der WTO, unterteilt in direkte und indirekte Komponenten.
- Die Veränderung der direkten und indirekten Einflusskomponenten durch den Beitritt zur EU.
- Die Rolle der EU als Koalitionsbildner und Einflussfaktor für Österreich in der WTO.
- Die Auswirkungen der EU-Mitgliedschaft auf Österreichs Fähigkeit, Interessen in der internationalen Handelspolitik zu vertreten.
- Die Bedeutung der Europäischen Zollunion für Österreichs Marktzutritt und Einflussmöglichkeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Zusammenfassung: Diese Zusammenfassung bietet einen Überblick über die Kernaussagen und die Argumentationslinie der Arbeit. Sie beleuchtet die Veränderungen im Einfluss Österreichs in der WTO seit dem EU-Beitritt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Welthandelsorganisation (WTO), Europäische Union (EU), Einfluss, Internationale Handelspolitik, Neue Politische Ökonomie, Direkter und indirekter Einfluss, Koalitionsbildung, Marktzutritt, Zollunion.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte der EU-Beitritt 1995 den Einfluss Österreichs in der WTO?
Österreich transferierte seine direkten Einflussmöglichkeiten nach Brüssel, gewann jedoch durch die kollektive Verhandlungsführung der EU an indirektem Gewicht.
Was sind „direkte“ und „indirekte“ Einflusskomponenten?
Direkter Einfluss bezieht sich auf eigenständige Verhandlungen (wie im GATT), während indirekter Einfluss durch die Marktgröße der EU-Zollunion und Koalitionsbildungen innerhalb der EU entsteht.
Was zeigt der „Chlorhühnerfall“ in Bezug auf Österreichs Einfluss?
Er dient als Beispiel dafür, wie Österreich durch Koalitionsbildung innerhalb der EU seine Position in handelspolitischen Konflikten effizienter durchsetzen kann.
Welche Vorteile bietet die EU-Mitgliedschaft bei Handelskonflikten?
Österreich hat Zugang zu den Ressourcen der EU, wie spezialisierten Komitees, Informationen und Retorsionsmöglichkeiten, was den Schutz vor Druck durch andere Staaten erhöht.
War Österreich vor dem EU-Beitritt ein bedeutender Akteur im GATT?
Nein, Österreich galt eher als Nischenspieler mit begrenzter Vernetzung und Informationsdefiziten, trotz punktueller Erfolge bei der Terminologie von Verträgen.
- Quote paper
- Tobias Frei (Author), 2010, Der Einfluss von Österreich in der Welthandelsorganisation seit dem Beitritt zur Europäischen Union: Eine Fallstudie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167279