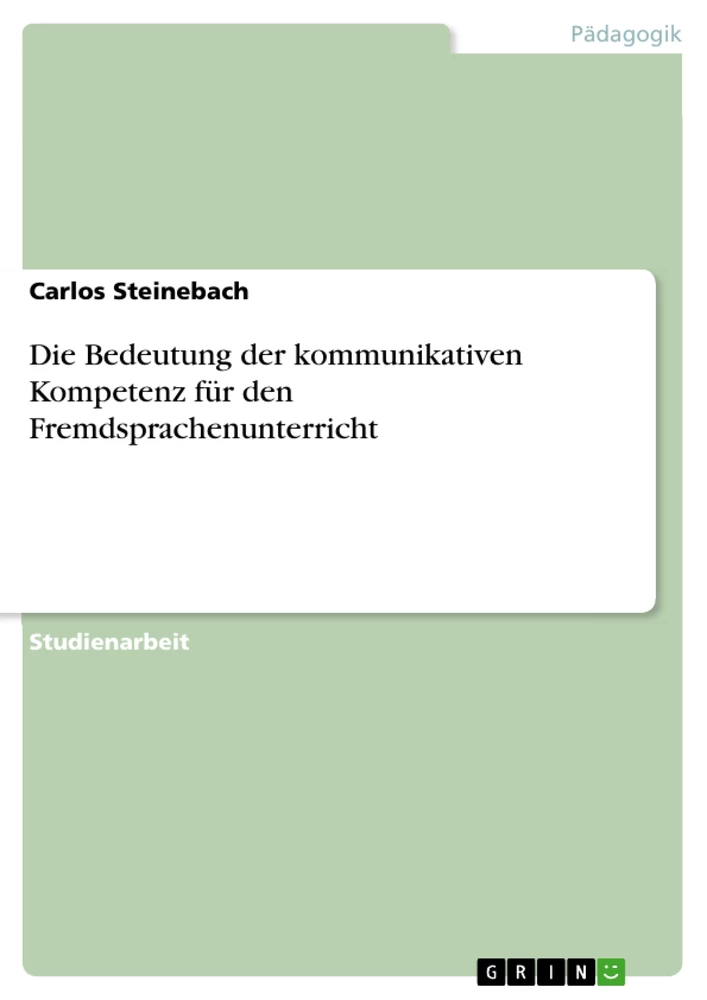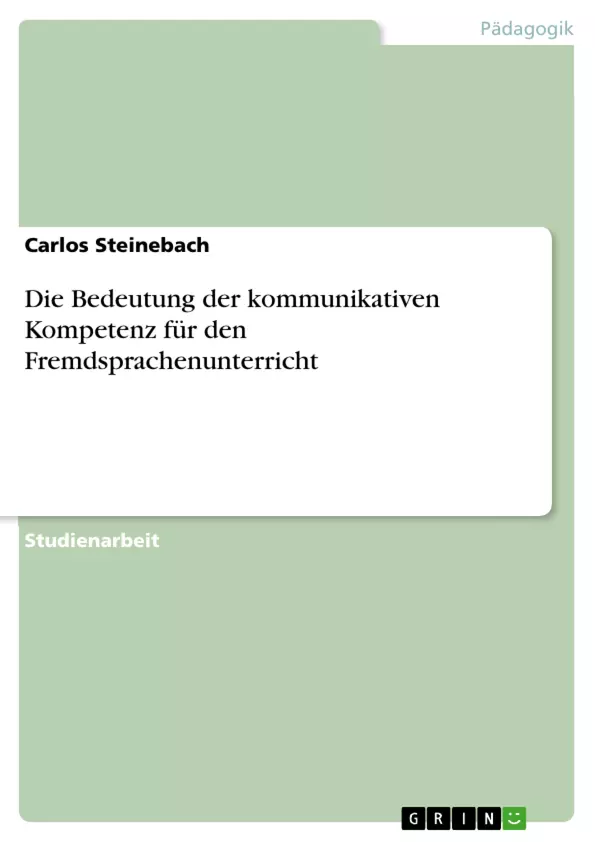In der folgenden Abhandlung wird die Fragestellung geklärt, inwieweit kommunikative Kompetenz im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt wird. Dazu wird am Anfang eine Begriffsdefinition und anhand dieser eine Untersuchung bezüglich der Verwendung kommunikativer Aufgaben im Unterricht stehen.
Weiterhin werden im aktuellen Lehrplan Spanisch für den gymnasialen Bildungsgang des Landes Hessen (G8) und im „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ das Auftreten und die Wichtigkeit kommunikativer Aufgabentypen und Kompetenzen aufgezeigt und dargestellt.
Abschließend wird der Dialog als kommunikative Aufgabe und dessen primäres Ziel des Erreichens einer kommunikativen Kompetenz in der entsprechenden Fremdsprache erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erläuterung des Begriffs: kommunikative Kompetenz
- Warum kommunikative Kompetenz im Fremdsprachenunterricht?
- Berücksichtigung der kommunikativen Kompetenz im Lehrplan des Landes Hessen (G8) und im „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen”
- Die Verwendung kommunikativer Übungen im Fremdsprachenunterricht
- Der Dialog als kommunikative Übung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Fokus dieser Abhandlung liegt auf der Bedeutung der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht. Sie analysiert, inwieweit kommunikative Kompetenz im Unterricht berücksichtigt wird und untersucht die Verwendung kommunikativer Aufgaben im Unterricht. Des Weiteren werden die Wichtigkeit und das Auftreten kommunikativer Aufgabentypen und Kompetenzen im Lehrplan Spanisch für den gymnasialen Bildungsgang des Landes Hessen (G8) und im „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen” aufgezeigt.
- Definition und Bedeutung der kommunikativen Kompetenz
- Relevanz der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht
- Analyse der Verwendung kommunikativer Aufgaben im Unterricht
- Berücksichtigung der kommunikativen Kompetenz in Lehrplänen und Referenzrahmen
- Der Dialog als kommunikative Aufgabe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht dar und führt in die Fragestellung der Abhandlung ein. Kapitel 2 definiert den Begriff der kommunikativen Kompetenz nach Canale und Swain und erläutert die verschiedenen Komponenten, die zur kommunikativen Kompetenz beitragen, wie grammatische, soziolinguistische, diskursive und strategische Kompetenz. Kapitel 3 untersucht die Bedeutung der kommunikativen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht und beleuchtet die Berücksichtigung dieser Kompetenz im Lehrplan des Landes Hessen (G8) und im „Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen”. Kapitel 4 analysiert die Verwendung kommunikativer Übungen im Fremdsprachenunterricht, wobei der Schwerpunkt auf dem Dialog als kommunikative Übung liegt.
Schlüsselwörter
Kommunikative Kompetenz, Fremdsprachenunterricht, Lehrplan, Referenzrahmen, Dialog, grammatische Kompetenz, soziolinguistische Kompetenz, diskursive Kompetenz, strategische Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist kommunikative Kompetenz im Fremdsprachenunterricht?
Es ist die Fähigkeit, Sprache in verschiedenen sozialen Situationen angemessen und effektiv zur Verständigung einzusetzen.
Welche Komponenten gehören zur kommunikativen Kompetenz?
Dazu zählen laut Canale und Swain die grammatische, soziolinguistische, diskursive und strategische Kompetenz.
Wie berücksichtigt der Lehrplan Hessen (G8) diese Kompetenz?
Der Lehrplan legt großen Wert auf kommunikative Aufgabentypen, die Schüler befähigen, reale Gesprächssituationen zu meistern.
Was ist der „Gemeinsame europäische Referenzrahmen“ (GER)?
Der GER bietet eine internationale Basis für die Beschreibung von Sprachkompetenzen und betont die Handlungsfähigkeit der Lernenden.
Warum ist der Dialog eine wichtige Übungsform?
Dialoge simulieren echte Kommunikation und fordern die Schüler auf, ihr Wissen spontan und interaktiv anzuwenden.
- Arbeit zitieren
- Carlos Steinebach (Autor:in), 2009, Die Bedeutung der kommunikativen Kompetenz für den Fremdsprachenunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167292