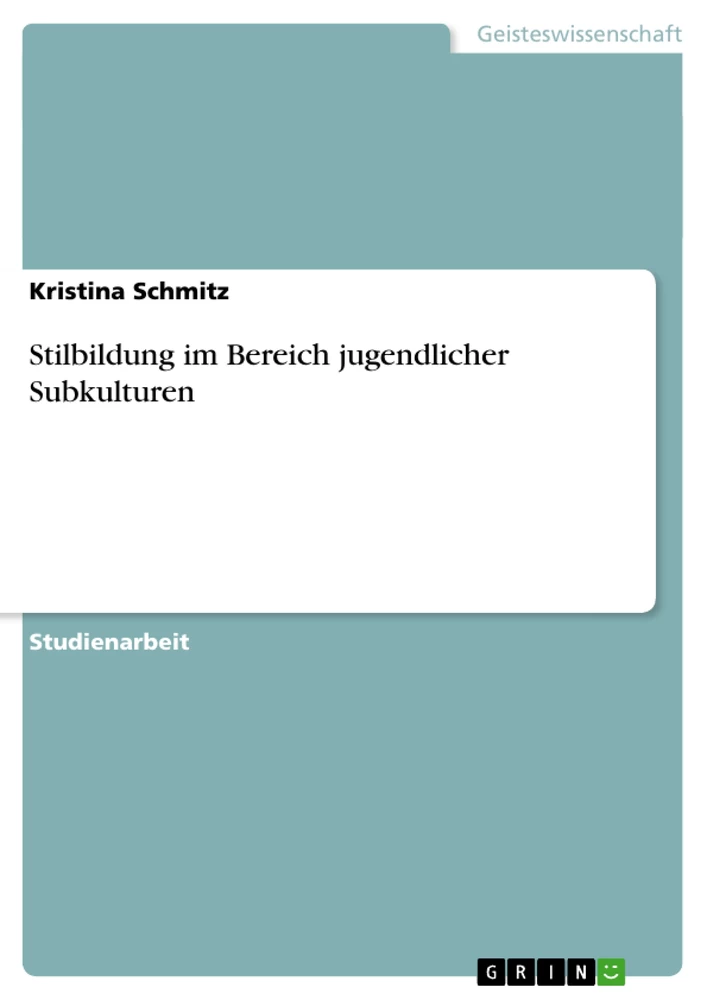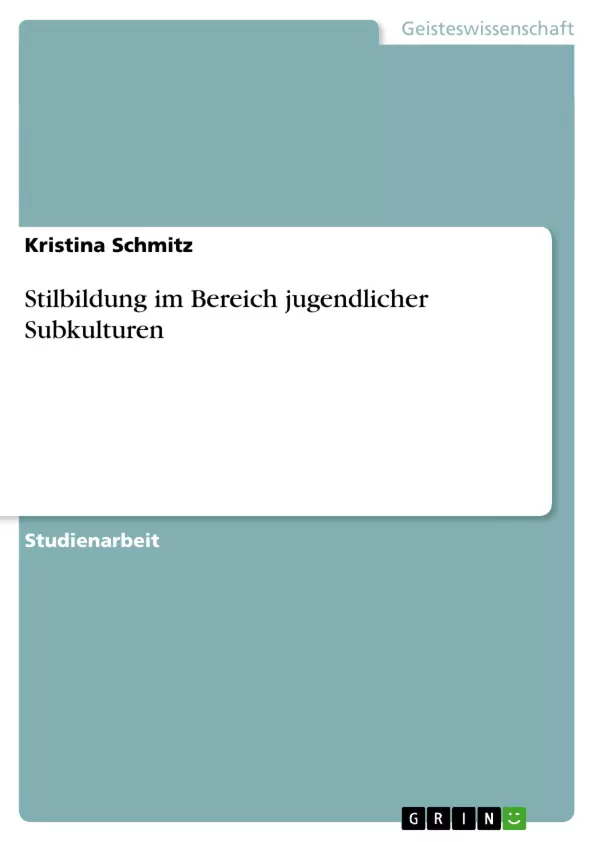Durch den Begriff „Jugendkultur“ werden zwei Sachverhalte dargestellt, die durch
ihre Gegensätzlichkeit den Begriff selbst paradox erscheinen lassen:
Einerseits wird durch ihn Alltagswelt der Jugendlichen beschrieben, andererseits
erläutert er die von den Jugendlichen selbst entwickelten Alternativ- oder
Alltagsfluchtwelten, die sich meistens als gegenkulturell definieren. Infolgedessen
kann der Begriff durchaus als problematisch angesehen werden, er soll aber trotzdem
weiterhin verwendet werden, weil er sich in der wissenschaftlichen Rede über Jugend
etabliert hat.
Die Gemeinschaft der Wandervögel war die erste Jugendkultur, die zu Anfang des 20.
Jahrhunderts entstand.
Aus dem Impuls dieser ersten deutschen Jugendkultur heraus hat sich mittlerweile eine
Vielzahl der jugendlichen Szenen herauskristallisiert, die kaum noch überschaubar
sind und sich somit einer allzu einfachen Klassifizierung entziehen. Insofern ist ein
homogener Begriff von „Jugend“, wie ihn die klassische Jugendforschung verwendet
hat, nicht mehr möglich.
In den 90er Jahren haben sich gegenüber den 80er Jahren die diversen
Jugendszenen noch einmal beträchtlich vermehrt und vielfältig ausdifferenziert,
so dass inzwischen eine kaum mehr überschaubare Pluralität von
unterschiedlichen jugendlichen Verhaltensweisen und Orientierungen,
jugendkulturellen Einstellungen, Ausfächerungen und Stilisierungen
vagabundiert (...). (Ferchhoff, 1993, S.26)
Idee und Begriff der Subkultur als „Teilkultur“ der Jugendkultur entstammen der
angelsächsischen Soziologie und Kulturanthropologie und eroberten sich von den 30er
und 40er Jahren an einen beachtlichen Platz in der wissenschaftlichen Diskussion dieser Disziplinen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Stil
- Symbol und Ritual
- Stilmischung: Bricolage
- Die Rolle der Medien
- Jugendkulturelle Stile am Beispiel von Tanzstilen zwischen 1945 und 1994
- Kurzer geschichtlicher Abriss der Tanzformen und Tanzbewegungen
- Tanzkleidung
- Die gesellschaftliche Bedeutung der symbolischen Formen des Tanzes
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung von Stilen in jugendlichen Subkulturen. Ziel ist es, die Bedeutung von Stilbildung, Symbol und Ritual für die Abgrenzung und Konstruktion jugendlicher Identitäten zu beleuchten. Dabei wird auch die Rolle der Medien in diesem Prozess betrachtet.
- Die Bedeutung von Stil für jugendliche Subkulturen
- Symbol und Ritual als Ausdruck jugendlicher Identität
- Stilmischung und Bricolage als Merkmale jugendlicher Subkultur
- Die Rolle der Medien in der Stilbildung
- Tanzstile als Beispiel für die Entwicklung jugendkultureller Stile
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Begriff der Jugendkultur und ihre Paradoxien dar. Sie beleuchtet die Entstehung und Vielfältigkeit jugendlicher Subkulturen im Laufe der Zeit, insbesondere die Entwicklung neuer Formen in den 1990er Jahren.
- Der Stil: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Stil" im Kontext jugendlicher Subkulturen und beschreibt dessen Bedeutung für die Inszenierung von Identität und die Abgrenzung von anderen Gruppen.
- Symbol und Ritual: Dieser Abschnitt untersucht die Rolle von Symbolen und Ritualen in jugendlichen Subkulturen und erklärt deren Bedeutung für die Konstruktion gemeinsamer Werte und Identitäten.
- Stilmischung: Bricolage: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Phänomen der Stilmischung ("Bricolage") in jugendlichen Subkulturen und analysiert, wie bestehende Elemente kombiniert und neu interpretiert werden, um neue Stile zu schaffen.
- Die Rolle der Medien: In diesem Kapitel wird die Bedeutung der Medien für die Verbreitung und Weiterentwicklung jugendlicher Stile beleuchtet. Der Einfluss von Medien auf die Konstruktion von Identitäten und die Entstehung neuer Trends wird untersucht.
- Jugendkulturelle Stile am Beispiel von Tanzstilen zwischen 1945 und 1994: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Tanzstilen als Beispiel für die Entwicklung jugendkultureller Stile. Es umfasst einen geschichtlichen Abriss verschiedener Tanzformen und Tanzbewegungen, eine Betrachtung der Tanzkleidung und eine Analyse der gesellschaftlichen Bedeutung von Tanzstilen als Ausdruck jugendlicher Kultur.
Schlüsselwörter
Jugendkultur, Subkultur, Stilbildung, Bricolage, Symbol, Ritual, Medien, Tanz, Jugendidentität, Identität, Abgrenzung, Gesellschaft, Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Bricolage“ im Kontext von Jugendkulturen?
Bricolage bezeichnet die Stilmischung, bei der Jugendliche bestehende kulturelle Elemente (Kleidung, Symbole) aus ihrem ursprünglichen Kontext reißen und neu kombinieren, um eine eigene Identität auszudrücken.
Welche Funktion haben Symbole und Rituale für jugendliche Subkulturen?
Sie dienen der Abgrenzung gegenüber der Erwachsenenwelt und anderen Gruppen sowie der Schaffung eines Wir-Gefühls und gemeinsamer Werte innerhalb der Szene.
Wie beeinflussen Medien die Stilbildung von Jugendlichen?
Medien verbreiten Trends rasant, bieten Vorbilder zur Identifikation und ermöglichen es Jugendlichen, Teil einer globalen Szene zu werden, während sie gleichzeitig die Kommerzialisierung von Stilen vorantreiben.
Warum wird der Begriff „Jugendkultur“ als paradox angesehen?
Weil er einerseits die alltägliche Lebenswelt beschreibt, andererseits aber oft Alternativ- oder Alltagsfluchtwelten meint, die sich explizit als Gegenkultur definieren.
Wie spiegeln Tanzstile die gesellschaftliche Bedeutung jugendlicher Kultur wider?
Tanzstile (wie zwischen 1945 und 1994) sind körperlicher Ausdruck von Freiheit und Rebellion; sie zeigen den Wandel von Normen und die Suche nach individueller Ausdruckskraft.
- Citar trabajo
- Kristina Schmitz (Autor), 2001, Stilbildung im Bereich jugendlicher Subkulturen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16729