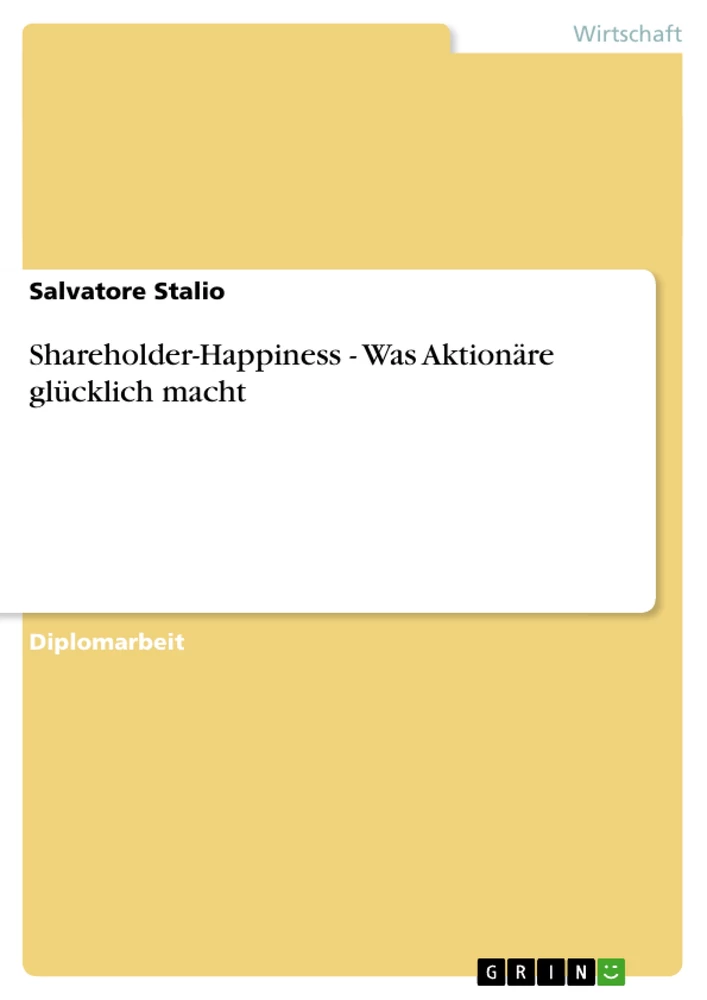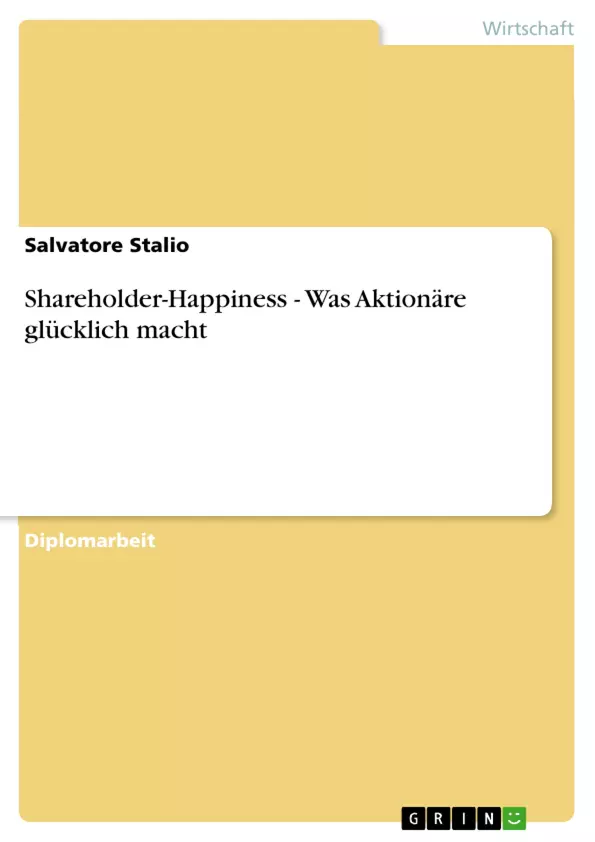Die gegenwärtige Finanzkrise, vornehmlich verursacht durch das Marktversagen der Immobilien- und Kreditmärkte, hat vor allem diejenigen Wirtschaftswissenschaftler überrascht, die stets die Selbstheilungskraft des Marktes beschworen hatten. Zudem verloren Anleger auf Kapitalmärkten nicht nur Geld, sondern auch ihr Vertrauen in Unternehmen und in das Finanzsystem. So bedingt die wirtschaftliche Krise auch eine Sinnkrise der Wirtschaftwissenschaft.
Die vorherrschende Lehrmeinung der neoklassischen Ökonomik, die in Zeiten kontinuierlichen Wirtschaftswachstums nur geringe kritische Hinterfragung erfahren hat, sieht in der Theorie weder die Entstehung spekulativer Blasen vor, noch hieraus resultierende Finanz- und Wirtschaftskrisen. Im Lichte der neuen empirischen Tatsachen steht das neoklassische Paradigma nun einer wachsenden Anzahl von Kritikern gegenüber, die die bislang geltenden Dogmen infrage stellen. Eines dieser Dogmen ist das für Aktiengesellschaften grundlegende normative Shareholder-Value-Konzept, wonach sich Unternehmen primär darauf ausrichten sollen, ihren Aktienwert zu maximieren.
Die empirische Realität der Finanz- und Wirtschaftskrise bietet insbesondere die Notwendigkeit einer breiter angelegten Erforschung von Motiven, die menschliches Handeln in ökonomischen Situationen erklären.
Eine Thematik, mit der sich die Menschheit mindestens solange wie mit der Ökonomie auseinandersetzt, ist das Glück. Die Glücksforschung betrachtet das Streben nach Glück als stärkstes Motiv, welches menschliches Handeln determiniert. Nach der Glückforschung sind alle anderen Motive einem Primat des Glücks untergeordnet. Sie identifiziert neben dem ökonomischen Streben weitere, nicht-monetäre Motive, die das individuelle Handeln begründen und liefert somit ein umfassenderes Konzept zur Erklärung menschlichen Verhaltens. Aus der Perspektive der Glücksforschung sollte der Verwendungszweck des Wirtschaftens in der Schaffung und Steigerung des persönlichen Glücks liegen. Bezogen auf Aktiengesellschaften ergibt sich die Überlegung, ob die eindimensionale Shareholder-Value-Orientierung empirisch und normativ um die Erkenntnisse der Glücksforschung ergänzt werden sollte. Derartige Überlegungen könnten in der Begründung des Konzeptes einer Shareholder-Happiness münden.
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die theoretische Notwendigkeit eines derartigen Konzepts darzustellen und diskutiert die ersten entwickelten Ansätze eines Shareholder-Happiness-Konzepts.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- ZIEL UND GANG DER UNTERSUCHUNG
- GRUNDLEGENDE PARADIGMEN DER ÖKONOMIK
- KLASSISCHE ÖKONOMIK
- NEOKLASSISCHE ÖKONOMIK
- Grundlagen
- Kapitalmarkttheorie
- Shareholder-Value-Konzept
- BEHAVIORAL ECONOMICS
- ZUSAMMENFASSUNG
- GLÜCKSFORSCHUNG
- HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND GEGENSTAND
- WESENTLICHE ERKENNTNISSE
- Ökonomische Faktoren
- Soziale Faktoren
- Ökologische Faktoren
- IMPLIKATIONEN FÜR DIE ÖKONOMIK
- SHAREHOLDER-MOTIVE
- IDEALTYPISCHE ABGRENZUNG VON SHAREHOLDERN
- Institutionelle Shareholder
- Private Shareholder
- MOTIVE INSTITUTIONELLER SHAREHOLDER
- Klassische monetäre Motive
- Finanzinvestment
- Strategisches Investment
- Nicht-monetäre Motive
- Mitsprache
- Macht
- Social Responsibility
- MOTIVE PRIVATER SHAREHOLDER
- Klassische monetäre Motive
- Existenzsicherung
- Vermögensaufbau
- Altersabsicherung
- Nicht-monetäre Motive
- Anreiz
- Mitsprache
- Status
- Social Responsibility
- ZIELKONFLIKTE
- SHAREHOLDER-HAPPINESS
- PARTIZIPATION
- SOCIAL RESPONSIBLE INVESTMENT
- SHAREHOLDER-HAPPINESS ALS NEUES UNTERNEHMENSZIEL
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, was Aktionäre glücklich macht. Ziel ist es, das Phänomen "Shareholder-Happiness" im Kontext der modernen Wirtschaft zu untersuchen. Dazu werden zunächst grundlegende Paradigmen der Ökonomik vorgestellt, insbesondere die klassische Ökonomik, die neoklassische Ökonomik und die Behavioral Economics. Die Arbeit integriert Erkenntnisse aus der Glücksforschung und untersucht die Motive von institutionellen und privaten Aktionären. Im Fokus stehen sowohl klassische monetäre Motive als auch nicht-monetäre Motive wie Mitsprache, Macht und Social Responsibility.
- Shareholder-Happiness als neues Unternehmensziel
- Integration von Glücksforschung in die Ökonomie
- Analyse von Aktionärsmotiven
- Bedeutung von nicht-monetären Faktoren für Shareholder-Happiness
- Relevanz von Partizipation und Social Responsible Investment
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beschreibt Ziel und Gang der Untersuchung. Kapitel 2 widmet sich den grundlegenden Paradigmen der Ökonomik, einschließlich der klassischen Ökonomik, der neoklassischen Ökonomik und der Behavioral Economics. Im dritten Kapitel werden die historischen Entwicklung und der Gegenstand der Glücksforschung beleuchtet, sowie wesentliche Erkenntnisse aus der Glücksforschung dargestellt. Kapitel 4 befasst sich mit den Motiven von Aktionären, unterteilt in institutionelle und private Shareholder. Im fünften Kapitel wird das Konzept des Shareholder-Happiness eingehend betrachtet, mit Fokus auf Partizipation, Social Responsible Investment und Shareholder-Happiness als neues Unternehmensziel.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Shareholder-Happiness, Aktionärsmotive, Glücksforschung, neoklassische Ökonomik, Behavioral Economics, Partizipation, Social Responsible Investment und Corporate Social Responsibility. Weitere wichtige Begriffe sind Finanzinvestment, strategisches Investment, Mitsprache, Macht, Anreiz und Status. Die Arbeit basiert auf einer Analyse von klassischen und nicht-monetären Motiven von Aktionären.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Shareholder-Value und Shareholder-Happiness?
Während Shareholder-Value auf die Maximierung des Aktienwerts zielt, ergänzt Shareholder-Happiness dies um nicht-monetäre Motive und Erkenntnisse der Glücksforschung.
Welche nicht-monetären Motive haben Aktionäre?
Dazu gehören unter anderem Mitsprache, Macht, Status, soziale Verantwortung (Social Responsibility) und der Wunsch nach Partizipation.
Was besagt die Glücksforschung über ökonomisches Handeln?
Sie betrachtet das Streben nach Glück als das stärkste Motiv, dem alle anderen Motive, auch das monetäre Streben, untergeordnet sind.
Warum wird das neoklassische Paradigma kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass es spekulative Blasen und Finanzkrisen nicht vorhersieht und menschliche Motive zu eindimensional auf Gewinnmaximierung reduziert.
Was ist „Social Responsible Investment“ (SRI)?
Es bezeichnet Investitionen, die neben finanziellen Kriterien auch soziale, ökologische und ethische Aspekte berücksichtigen, um Shareholder-Happiness zu steigern.
- Citation du texte
- Salvatore Stalio (Auteur), 2010, Shareholder-Happiness - Was Aktionäre glücklich macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167406