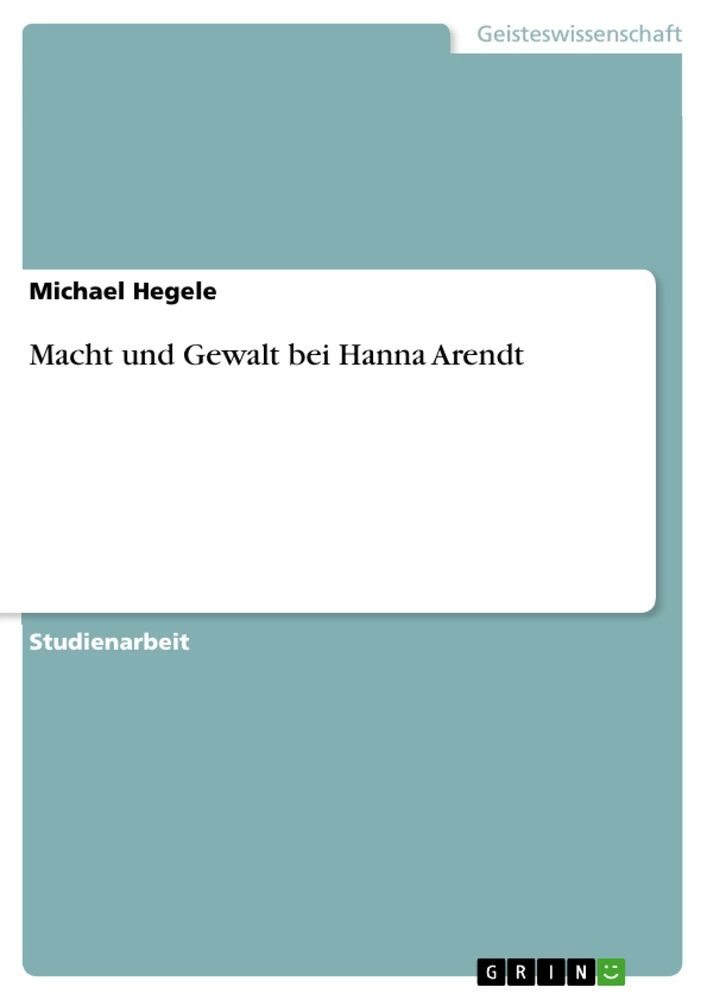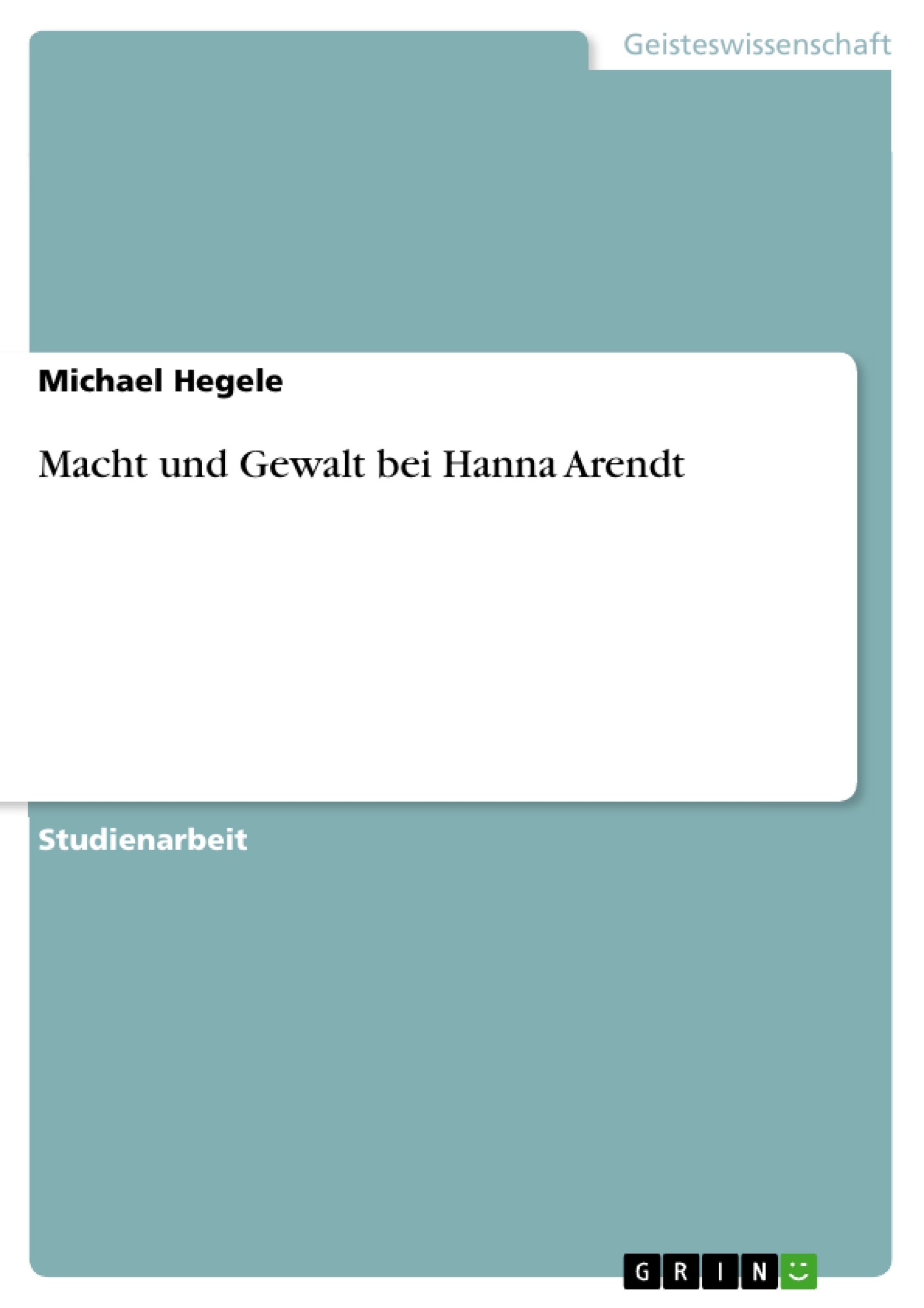„Die Gewalt ist die Geburtshelferin der Geschichte, und sie macht Geschichte oder Revolution so wenig wie die Hebamme das Kind erzeugt hat.“(Arendt 2009, S.15)
Ein Jahrhundert voller Kriege, Revolutionen und anlässlich der, durch die weltweiten Studentenproteste in den 70ern aufgeflammten Debatte „(…)über das Wesen der Gewalt, ihre Rolle in Geschichte und Politik(…)“ (Arendt 2009, S.7), veranlasst Hannah Arendt sich mit dem Bedeutungszusammenhang von Macht und Gewalt zu beschäftigen.
Beim Studieren der wichtigsten politischen Theoretiker stellt sie fest, dass ein Gros der Literatur davon ausgeht, dass Macht und Gewalt identisch sind. Weiter sind viele der Überzeugung, dass Gewalt „nichts weiter ist als die eklatanteste Manifestation von Macht“ (Arendt 2009, S.36.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Tradition des Machtbegriffes und dessen Verhältnis zur Gewalt
- Unterschiedliche Herangehensweisen zum Machtbegriff
- Macht und Gewalt bei den traditionellen Vordenkern
- Macht und Gewalt bei Hannah Arendt
- Absolute Gegenteile Macht und Gewalt
- Unterschiede von Macht und Gewalt am Beispiel der Revolution
- Macht und Gewalt in der Realität
- Absolute Gegenteile Macht und Gewalt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Hannah Arendts Werk befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt und deren Beziehung zueinander. Sie analysiert die traditionellen Ansätze zum Machtbegriff und stellt fest, dass viele Denker Macht und Gewalt als identisch betrachten. Im Gegensatz dazu argumentiert Arendt, dass Macht und Gewalt zwei völlig verschiedene Konzepte sind, die nicht miteinander verwechselt werden sollten.
- Die unterschiedlichen Definitionen und Interpretationen von Macht und Gewalt
- Die Rolle von Gewalt in der Geschichte und Politik
- Die Bedeutung von Macht für den Zusammenhalt einer Gesellschaft
- Die Unterscheidung zwischen Macht, Stärke, Gewalt, Kraft und Autorität
- Die Kritik an der traditionellen Theorie von Krieg und Gewalt als Ultima ratio
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Buches führt in die Thematik ein und stellt die zentrale These von Hannah Arendt vor: Macht und Gewalt sind zwei unterschiedliche Konzepte, die nicht miteinander verwechselt werden sollten. Sie beleuchtet die historischen und aktuellen Ereignisse, die Arendt zu ihrer Analyse der beiden Begriffe veranlasst haben.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der traditionellen Sichtweise auf Macht und Gewalt. Es werden verschiedene Denker wie Max Weber, Karl Marx und Mao Tse-tung vorgestellt, die Macht und Gewalt in unterschiedlichen Zusammenhängen betrachten. Arendt zeigt, dass diese Denker oft von einer Verbindung zwischen Macht und Gewalt ausgehen und die Rolle der Gewalt in der Geschichte und Politik betonen.
Im dritten Kapitel stellt Arendt ihre eigene Theorie von Macht und Gewalt vor. Sie argumentiert, dass Macht nicht auf Gewalt basiert, sondern aus dem Zusammenhalt und der gemeinsamen Handlungsfähigkeit einer Gruppe entsteht. Gewalt hingegen ist für Arendt eine destruktive Kraft, die niemals zur Lösung von Konflikten beitragen kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind Macht, Gewalt, Politik, Geschichte, Revolution, Autorität, Stärke, Kraft, Zusammenhalt, Handlungsfähigkeit, Tradition, Kritik, Differenzierung, Analyse, Theorie, Vietnamkrieg, Studentenproteste.
- Quote paper
- Michael Hegele (Author), 2009, Macht und Gewalt bei Hanna Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167474